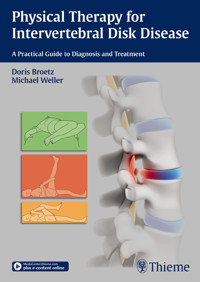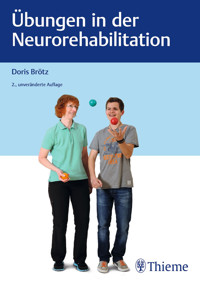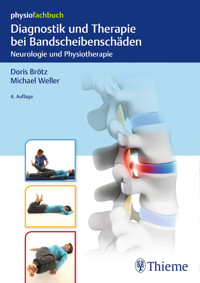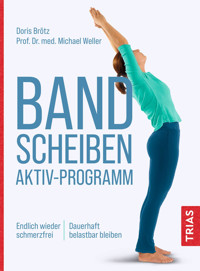
21,99 €
Mehr erfahren.
Das bewährte Konzept gegen Rückenschmerzen
Sie leiden unter sogenannten unspezifischen Rückenschmerzen? In vielen Fällen sind Bandscheibenschäden der Auslöser. Mit den Tests im Buch können Sie die Ursachen für Ihre Schmerzen bestimmen und mit gezielten Übungen lindern.
Die Physiotherapeutin Doris Brötz zeigt Ihnen, wie Hals-, Brust- und Lendenwirbelsäule wieder stabil, belastbar und beweglich werden.
Diese Übungen helfen Ihnen – auch im Akutfall
- Alltagstauglich: alle Übungen lassen sich problemlos in den Alltag integrieren
- Hochwirksam: individuell auf Ihre Situation ausgerichtete Übungsfolgen
- Effizient: schon nach 7 Tagen weniger Schmerzen und deutlich mehr Beweglichkeit
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 133
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Die Autoren
Doris Brötz ist seit 1982 Physiotherapeutin. Sie hat seit Jahren Forschungsstellen an der Universitätsklinik Tübingen und arbeitet in eigener Praxis. Auf Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse und ihrer praktischen Erfahrung in der Behandlung von Patienten hat Frau Brötz mehrere Therapiekonzepte entwickelt und beschrieben. Dabei kommen immer verhaltensorientierte, aktive, selbstkontrollierte und wissenschaftlich fundierte Strategien zum Einsatz. Frau Brötz hat zahlreiche Forschungsarbeiten zur Untersuchung der Wirksamkeit von Physiotherapie bei Bandscheibenvorfällen, nach Schlaganfall und bei Ataxie initiiert, durchgeführt und publiziert. Sie ist Autorin mehrerer Bücher und zahlreicher wissenschaftlicher Arbeiten.
Prof. Dr. med. Michael Weller ist seit 2008 Klinikdirektor der Neurologischen Klinik am Universitätsspital Zürich und war zuvor Ärztlicher Direktor an der Neurologischen Universitätsklinik Tübingen. Dort haben Doris Brötz und Michael Weller seit 1996 mehrere Studien zur Diagnostik und Therapie bei Patienten mit Bandscheibenvorfällen der Lendenwirbelsäule gemeinsam geplant und durchgeführt. Daraus haben die Autoren das hier beschriebene Konzept für Patienten mit Wirbelsäulenleiden entwickelt. Neue wissenschaftliche Erkenntnisse und Erfahrungen aus der täglichen Behandlung von Patienten werden von ihnen ständig geprüft und ggf. in das Konzept aufgenommen.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Themen Rückenschmerz und Bandscheibenleiden werden in vielen Büchern, Gesundheitsbroschüren und Fernsehsendungen behandelt. Trotz der Fülle an Informationen über rückenschonendes Verhalten leiden die Menschen der zivilisierten Welt zunehmend unter Rücken- und Nackenschmerzen. Denn es werden einige nützliche, aber ebenso viele unnütze und sogar schädliche Verhaltenshinweise, Übungsvorschläge und Therapiemaßnahmen verbreitet und angewandt.
Dieses Buch zeigt Ihnen, welche Verhaltensregeln, Übungen und sportlichen Aktivitäten für Sie persönlich am besten sind. Anhand Ihrer Geschichte und des Verhaltens Ihrer Beschwerden bei bestimmten Belastungsmanövern der Wirbelsäule sowie Bewegungen der Arme oder Beine können Sie analysieren, welcher Mechanismus Ihren Beschwerden vermutlich zugrunde liegt und welche Strategie zur Behandlung und Vorbeugung für Sie erfolgreich ist. Anhand einfacher Kriterien können Sie Ihre Fortschritte erkennen. Sie erfahren, welche Beschwerden Sie selbst behandeln können und wann Sie einen Arzt und einen Physiotherapeuten aufsuchen sollten. Als gut informierte Patientin oder Patient sind Sie in der Lage, die Behandlungen, die von Ärzten oder Physiotherapeuten durchgeführt werden, mitzugestalten und eine Mitverantwortung für Ihre Genesung zu übernehmen.
Um herauszufinden, welchem Patient welche Behandlung am besten hilft, müssen unspezifische, also keinem eindeutigen Krankheitsbild zuordenbare Beschwerden näher untersucht werden. Als diagnostische Strategie werden hier spezielle Tests mit wiederholten endgradigen Bewegungen der Wirbelsäule genutzt, die der neuseeländische Physiotherapeut Robin McKenzie als Erster beschrieb. Außerdem geben bestimmte Bewegungen von Armen oder Beinen, sogenannte Nervendehnungstests, Aufschluss über die Beteiligung der Nervenbahnen. Die muskuläre Kontrolle von Haltung und Bewegung wird geprüft und hilft zur Diagnosefindung. Aus theoretischen Überlegungen zur Anatomie, Gewebeverletzung und Heilung sowie Kenntnissen typischer Beschwerden bei bestimmten Erkrankungen wurde eine Hypothese über die Ursachen einiger Rückenschmerzsyndrome entwickelt.
So kann beispielsweise ein Bandscheibenschaden aufgrund klinischer Zeichen vermutet werden, auch wenn bildgebende Verfahren keinen Bandscheibenvorfall zeigen. Nahezu die Hälfte aller sogenannten unspezifischen, also unklaren Rückenschmerzen, wird von Bandscheibenschäden ausgelöst.
Die Vermutung über die Ursache der Beschwerden führt dann zu einer speziellen Therapie. Bei Patienten mit einem bildgebend (radiologisch) nachgewiesenen Bandscheibenvorfall lässt sich mithilfe der Tests prüfen, ob die momentanen Beschwerden von diesem Bandscheibenvorfall ausgelöst werden. Innerhalb von 5 Tagen mit konsequentem Üben lässt sich außerdem gut beurteilen, ob die Beschwerden auf die hier vorgeschlagene Therapie ansprechen oder ob andere Maßnahmen empfehlenswert sind.
An der Neurologischen Universitätsklinik Tübingen haben wir viele Jahre lang zum Thema Bandscheibenvorfall der Lendenwirbelsäule geforscht. Die Diagnostik und Therapie nach dem hier vorgestellten Konzept wird durch die Veränderung der Symptome geleitet und der Erfolg wird mithilfe festgelegter Zielpunkte geprüft. Als Maßnahmen werden vom Patienten selbstständig durchgeführte Bewegungen der Wirbelsäule genutzt. Nach der akuten Phase werden zusätzlich Bewegungen der Arme oder Beine geübt, um die Beweglichkeit des Nervensystems zu erhalten. Zur Kontrolle von Bewegung und Haltung wird die gezielte Aktivierung der die Wirbelsäule stabilisierenden tiefen Muskulatur ergänzt. Dauerhafte Beschwerdefreiheit kann durch kleine alltägliche Maßnahmen erreicht werden. Man sollte sie eher als Verhaltensänderung sehen, nicht als Übungen. Wir zeigen in diesem Buch zusätzlich ein Kräftigungsprogramm, Koordinationsübungen und Kreislauftraining zur Steigerung von Belastbarkeit und Wohlbefinden.
Das Dreigespann der Physiotherapie „Fango, Massage, Schlingentisch” wird hier ebenso kritisch betrachtet wie die „Stufenlagerung” und das „Einrenken”. Lassen Sie sich auf eine neue Betrachtung der alten Vorgehensweisen ein und prüfen Sie, ob Sie unsere theoretischen Überlegungen und Erfahrungen selbst nachvollziehen können.
WICHTIG
Das Konzept
Das hier vorgestellte Konzept beinhaltet Diagnostik und Therapie von Wirbelsäulenleiden nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Es begleitet die Patienten von der Phase akuter Beschwerden bis hin zu normaler Belastbarkeit und Beschwerdefreiheit. Diagnostische und therapeutische Maßnahmen: Bewegungen der Wirbelsäule, Bewegungen der Nervenbahnen, Stabilisierung der Wirbelsäule.
Nach einer kurzen Einführung in die Grundlagen der Schädigung und Heilung von Bandscheiben und Nerven und zu möglichen Beschwerdeursachen folgt eine ausführliche Übungsanleitung. Am Ende finden Sie einen Abschnitt zur Wiederherstellung normaler Belastbarkeit und zur Vorbeugung von Wirbelsäulenleiden. Alle Übungen sind einfach und können selbstständig und ohne Anschaffung von Geräten durchgeführt werden.
Freude an Bewegung und Belastung und die Überzeugung, dass Sie durch eigenes Handeln einen positiven Verlauf der Erkrankung herbeiführen können, will dieses Buch Ihnen vermitteln.
Doris Brötz und Michael Weller
Diagnostik
Die sorgfältige Diagnostik ist Voraussetzung für eine gezielte Therapie. Das folgende Kapitel soll Ihnen helfen, den mechanischen Hintergrund Ihres Wirbelsäulenleidens zu verstehen und gezielt die passenden Übungen zur Therapie auszuwählen.
Welches Rückenleiden haben Sie?
Ziel der Diagnostik ist die Zuordnung der Beschwerden und Krankheitszeichen eines Patienten zu einer bestimmten Erkrankung. Wenn das krankhafte Geschehen erkannt ist, kann man gezielt behandeln. Die meisten Rücken- und Nackenschmerzen haben mechanische Ursachen, sind harmlos und gut zu behandeln.
Bösartige Erkrankungen. Der Ausschluss bösartiger Erkrankungen ist ein wichtiger Bestandteil der Diagnostik. Erkrankungen wie Tumoren oder Infektionen im Bereich der Wirbelsäule oder der Bauchorgane äußern sich meist nicht ausschließlich in Form von Rückenschmerzen, sondern sind mit allgemeinem Unwohlsein, ungewolltem Gewichtsverlust und anderen Krankheitszeichen verbunden. Bei einer solchen Kombination von Symptomen sollten Sie unbedingt einen Arzt aufsuchen !
Unfall. Nach einem Unfall oder einem Sturz aufgetretene Rücken- und Nackenschmerzen sollten ebenfalls von einem Arzt untersucht werden, um einen Knochenbruch oder eine Bänderverletzung auszuschließen.
Seelische Beeinflussung. Psychische und soziale Ursachen von Rücken- und Nackenschmerzen werden intensiv diskutiert und häufig als letzte Erklärung angenommen, wenn die Beschwerden trotz zahlreicher Behandlungsversuche nicht verschwinden. Die Bewältigung von Konflikten in der Partnerschaft und im Arbeitsumfeld ist eine Anforderung des normalen Lebens. Es ist nicht die Regel, dass Krisensituationen zu körperlichen Beschwerden führen. Psychische Belastungen haben jedoch häufig eine Vernachlässigung des Körpers mit einem Mangel an Entspannung und Bewegung zur Folge. Dadurch können mechanische Beschwerden ausgelöst oder begünstigt werden, die mechanisch behandelt werden sollten. Wenn Sie sich aber sehr niedergeschlagen, hoffnungslos und antriebsschwach fühlen, wenn Sie von Ängsten gequält werden und sich von Kontakten zu anderen Menschen zurückziehen, sollten Sie einen Arzt aufsuchen.
Arthrotische Veränderungen oder Bandscheibenschäden. Im Bereich der Wirbelsäule liegen die Strukturen des Halteapparates wie z.B. Gelenke, Bandscheiben und Muskeln in enger Nachbarschaft zu den Nerven. Bei Veränderungen beispielsweise durch arthrotische Knochenanlagerungen oder Bandscheibenverlagerungen kann es zu Druckschäden und Entzündungen der Nervenwurzeln oder des Rückenmarks kommen. Ausstrahlende Schmerzen und Gefühlsstörungen in Armen, Beinen oder dem Brustkorb sowie Muskelschwächen können die Folge sein. Die einzelnen Nervenwurzeln leiten Gefühlsinformationen aus bestimmten Hautarealen (Dermatome) und Impulse zur Aktivierung bestimmter Muskeln (Kennmuskeln).
Aus der Lage einer Gefühlsstörung und der Schwäche eines bestimmten Muskels kann man also auf die Schädigung einer bestimmten Nervenwurzel schließen. Solche Wurzelsyndrome sind typisch für einen Bandscheibenvorfall. Bei einer Schädigung der Nerven, die die Blase und den Darm versorgen, kann es zur Beeinträchtigung des Wasserlassens und der Darmentleerung kommen. Wenn Sie derartige Symptome bemerken, sollten Sie einen Arzt aufsuchen.
WICHTIG
Krankheitszeichen, bei denen Sie einen Arzt aufsuchen sollten
Allgemeines Unwohlsein, ungewollter Gewichtsverlust und andere Krankheitszeichen.Unfall oder Sturz.Gefühl der Niedergeschlagenheit, Hoffnungslosigkeit und Antriebsschwäche, Angst.In Arme, Beine oder Brustkorb ausstrahlende Schmerzen, Gefühlsstörungen oder Muskelschwäche.Störungen beim Wasserlassen oder bei der Darmentleerung.Fehlbelastungen sind die häufigste Ursache
Mechanische Fehlbelastungen sind die häufigste Ursache von Wirbelsäulenleiden. Unter den mechanischen Ursachen sind wiederum Bandscheibenschäden die häufigsten Auslöser für Beschwerden.
Wie entsteht ein Bandscheibenschaden?
Wenn man sich bewegt, bewegen sich die Bandscheiben passiv mit. Bewegt man sich wiederholt einseitig oder hält sich über längere Zeit in einer Position, so weicht der Gallertkern dem einseitigen Druck aus und wandert in die Gegenrichtung. Bei gebeugten Tätigkeiten wie Sitzen, Heben oder Gartenarbeit entsteht vorne anhaltender Druck auf die Bandscheiben. Die Gallertmasse weicht nach hinten aus und drückt auf den empfindlichen Faserring. Gleichzeitig wird der Faserring hinten gedehnt. Es entstehen Rückenschmerzen. Bei wiederholter Fehlbelastung können die Faserringe Risse bekommen. Beugt man sich weiter, wandert der Gallertkern eventuell so stark nach hinten, dass er bei Aufrichtung zwischen den Hinterkanten der Wirbelkörper eingeklemmt wird. Es entsteht eine Streckhemmung.
Man fühlt sich in eine gebeugte Körperhaltung gezwungen, die man wegen Schmerzen beim Aufrichten nicht aufgibt.
WISSEN
Der Hamburgereffekt
Jeder kennt folgende Situation: Man möchte in einen Hamburger beißen. Um ihn in eine mundgerechte Dicke zu bringen, drückt man ihn auf einer Seite zusammen. Das Fleischstück mit Tomatensoße und Salat wird auf der anderen Seite herausgepresst. So etwa kann man sich die Mechanik eines Bandscheibenvorfalles vorstellen.
Durch die anhaltende Beugung kann der Gallertkern auch so weit nach hinten verschoben werden, dass der Faserring schließlich reißt. Die gallertartige Masse der Bandscheibe tritt teilweise durch diesen Riss aus, und es kommt zum Bandscheibenvorfall, je nach Ort und Größe ohne oder mit Druck auf eine benachbarte Nervenwurzel (siehe Abbildung).
Wirbel mit Bandscheibe und Nerven
Wie erkennt man einen Bandscheibenschaden?
Eine eindeutige Zuordnung von Beschwerden zu Verlagerung oder Verletzung von Bandscheibengewebe ist häufig nicht möglich. Bildgebende Verfahren sind geeignet, ausgeprägtere Veränderungen von Knochen, Gelenken und Weichteilen darzustellen. Es ist aber nicht möglich, den Schmerz selbst örtlich nachzuweisen oder mit bildgebenden Verfahren zu beweisen, dass Schmerz an einer bestimmten Stelle des Körpers ausgelöst wird. Aus dem Ausmaß der bildgebend dargestellten Veränderungen kann auch nicht auf die Ausprägung von Beschwerden geschlossen werden.
Deshalb stellt man die Diagnose zunächst aufgrund von Hinweisen aus der Geschichte der Erkrankung (Anamnese), dem Sichtbefund und den Ergebnissen der körperlichen Untersuchung. Wie bei einem Indizienprozess sucht man die plausibelste Erklärung für die Beschwerden. Wenn die daraus resultierende Behandlung erfolgreich ist, spricht dies für die Richtigkeit der ursprünglichen Hypothese zur Entstehung der Beschwerden. Nur wenn einschneidende Behandlungsvorschläge wie z.B. zu einer Operation oder dem Einsatz einer Schmerzmittelpumpe gemacht werden oder wenn die Therapie nicht erfolgreich war, sind zusätzliche, teilweise in den Körper eingreifende diagnostische Verfahren notwendig.
Im Folgenden werden die Diagnostik und ihre Ergebnisse am Beispiel von Bandscheibenschäden dargestellt. Spezielle Bewegungsanweisungen mit Abbildungen und Krafttests finden Sie in den jeweiligen Kapiteln zu den einzelnen Wirbelsäulenabschnitten. In die beiden Bogen zur Dokumentation von Beschwerden, Zeichen und Funktionseinschränkungen (siehe Anhang) können Sie Ihre persönlichen Daten eintragen. Sie dienen der sorgfältigen Prüfung der Frage, ob Störungen vorliegen, die eine ärztliche Untersuchung dringend erfordern. Außerdem können Sie selbst eine Hypothese über die Beschwerdeursachen aufstellen und den Verlauf der Genesung prüfen. Am Ende dieses Kapitels finden Sie eine kurze Auflistung von Untersuchungsergebnissen, die auf eine andere Störung (Differenzialdiagnose) hinweisen, und stichpunktartige Erklärungen zu deren Physiotherapie.
So können Sie Ihre Erfolge dokumentieren
Im Anhang finden Sie Dokumentationsbögen, die Sie kopieren und vor Beginn des Übungsprogramms, nach 5 Tagen und, falls Sie dann noch Beschwerden haben, einmal pro Woche ausfüllen sollten. So können Sie den Verlauf der Genesung verfolgen. Für die Messungen der Muskelkraft (Kennmuskeln) und der Nervendehnungszeichen brauchen Sie eventuell die Hilfe eines Therapeuten. Bitten Sie ihn, die Werte hier einzutragen.
Subjektiv sollten Sie eine Behinderung anhand von Einschränkungen in Handlungen des täglichen Lebens einschätzen. Dabei ist in erster Linie interessant, welchen Aktivitäten Sie nachgehen können, und erst in zweiter Linie, ob Sie dabei Schmerzen entwickeln.
Die Geschichte Ihrer Erkrankung
Lebensalter. Bandscheibenvorfälle treten am häufigsten im mittleren Lebensalter, d.h. um 40 Jahre auf. Die meisten Patienten können sich an wiederholte Episoden von Rückenschmerzen seit dem jungen Erwachsenenalter erinnern. Im Alter verlieren die Bandscheiben an Wasser und Beweglichkeit, sodass alte Menschen seltener einen Bandscheibenvorfall entwickeln. Bandscheibenschädigungen und damit verbundene Leiden finden sich demnach am häufigsten zwischen dem 20. und 65. Lebensjahr.
Plötzliches Auftreten. Bandscheibenleiden treten oft plötzlich auf. Leichte Beschwerden im Bereich der Wirbelsäule werden durch eine kleine Bewegung, wie z.B. Schuhe binden, schlagartig zu starken Schmerzen verstärkt. Man fühlt sich wie von der „Hexe angeschossen”.
Auslöser. Manchmal bestehen auch im Vorfeld keine Beschwerden. Dann sind langes Autofahren, schweres Heben, Gartenarbeiten, langes Sitzen und morgendliches Aufstehen mit gebeugter Wirbelsäule typische auslösende Faktoren für den plötzlichen starken Schmerz.
Eingeschränkte Beweglichkeit. Als Betroffener fühlt man sich in eine gebeugte Körperhaltung gezwungen. Die Beweglichkeit der Wirbelsäule ist eingeschränkt. Die Beschwerden ändern sich bei Bewegung. Beugung, Sitzen und längere Ruhe verschlimmern das Leiden. Die Schmerzen sind nachts und morgens meist deutlicher ausgeprägt als tagsüber. Beim Husten, Niesen und Pressen nehmen die Schmerzen zu.
Charakteristische Schmerzen. Die Schmerzen werden charakteristisch im Bereich der Wirbelsäule mit oder ohne streifenförmige ausstrahlende Schmerzen in einen Arm, ein Bein oder eine Seite des Brustkorbs empfunden. Bei Bandscheibenvorfällen kann der Rückenschmerz fehlen, und es werden nur streifenförmige ausstrahlende Schmerzen wahrgenommen.
Gefühlsstörungen. Diese verlaufen ebenfalls streifenförmig in einem Arm, einem Bein oder einer Seite des Brustkorbs. Die Gefühlsstörungen werden typischerweise in den Körperzonen am stärksten wahrgenommen, die von der Wirbelsäule am weitesten entfernt sind. Schwächen können bei einzelnen Muskelaktivitäten auftreten, z.B. beim Kämmen oder Treppensteigen.
Sichtbefund
Abweichungen der Körperhaltung und bewegung vom Gewohnten sind von außen sichtbar. Stehen oder laufen Sie anders als sonst? Eventuell sollten Sie einen Betrachter oder einen Spiegel zu Hilfe nehmen, um diese Gesichtspunkte zu beurteilen.
Gebeugte Haltung. Eine meist plötzlich einsetzende Veränderung der Körperhaltung, aus der man sich nur mit Mühe oder gar nicht befreien kann, ist ein typisches Zeichen eines Bandscheibenleidens. Dabei ist der Oberkörper oft nach vorne gebeugt bzw. der Kopf nach vorne verschoben.
Seitliche Verschiebung. Auch eine seitliche Verschiebung einzelner Körperabschnitte kann beobachtet werden. Bei Störungen im Bereich der Halswirbelsäule kann der Kopf gegenüber dem Schultergürtel, bei Beschwerden der Lendenwirbelsäule der Schultergürtel in Bezug zum Beckengürtel seitlich verschoben sein.
Hinken. Bandscheibenleiden der Lendenwirbelsäule können zum Hinken führen. Dabei wird entweder ein Bein nur sehr kurze Zeit belastet, das Bein der nicht betroffenen Seite wird schnell zum nächsten Schritt nach vorne geführt, oder der Schritt mit dem Bein der betroffenen Seite ist in seiner Schrittlänge verkürzt. Auch kann beim Gehen eine Beckenseite absinken bzw. das Gesäß zur Standbeinseite hin abweichen (Model-Gang).
Schonung eines Armes. Bandscheibenleiden der Halswirbelsäule können zu einer Schonhaltung eines Armes führen. Wegen einer Schmerzzunahme bei hängendem Arm wird der Unterarm gebeugt und mit der Hand des anderen Armes unterstützt. Dies reduziert vermutlich den Zug durch die Schwerkraft an den Nervenstrukturen.
Körperliche Untersuchung
Eine körperliche Untersuchung kann man nur begrenzt selbst durchführen. Wenn Sie die Hilfe eines Arztes oder eines Physiotherapeuten in Anspruch nehmen, wird dieser eine sorgfältige Untersuchung vornehmen. Im Folgenden werden die wichtigsten Kontrollgesichtspunkte, die beim Verdacht auf Bandscheibenleiden untersucht werden müssen, erklärt.
Beweglichkeit der Wirbelsäule
Bewegungen von Gelenken sind normalerweise schmerzfrei. Das Bewegungsende wird durch einen elastischen Widerstand markiert. Das Bewegungsausmaß in Drehung und Seitneigung ist normalerweise zu beiden Seiten gleich. Die Beweglichkeit der Wirbelsäule ist individuell unterschiedlich. Meistens kann man selbst beurteilen, ob die persönliche Beweglichkeit im Zusammenhang mit einem plötzlich aufgetretenen Schmerz beeinträchtigt ist. Entscheidend für die Diagnostik und die Therapie in der akuten Phase ist die Beobachtung, ob eine Bewegungseinschränkung besteht und ob sich die Beweglichkeit während der Übungen und im Zusammenhang mit dem Schmerz ändert.
WICHTIG
So prüfen Sie die Beweglichkeit
Führen Sie die einzelnen Bewegungen des betroffenen Wirbelsäulenabschnitts einmal aus.Bewegen Sie so weit wie möglich.Stoppen Sie die Bewegung sofort, wenn dadurch vorhandener Schmerz weiter ausstrahlt oder neuer ausstrahlender Schmerz ausgelöst wird.Gefühlswahrnehmung
Eine Gefühlsstörung kann man entweder spontan oder erst bei Berührung wahrnehmen. Man prüft das Gefühl dadurch, dass man mit den Händen über einzelne Körperabschnitte streicht und die Gefühlswahrnehmung vergleicht rechts mit links, Oberarm mit Unterarm usw. Wenn das Gefühl in einem bestimmten Bereich gestört ist, dann sollten Sie die Ausprägung der Störung beurteilen. Es sollte zwischen der Wahrnehmung der Berührung und der Empfindung von Schmerz und Temperatur hier unterschieden werden.
Es lassen sich folgende Schweregrade aufsteigend einteilen:
leicht reduziertes Gefühl wird nur bei Berührung und im direkten Vergleich mit nicht gestörten Körperabschnitten wahrgenommen
pelzig fühlt sich an, wie in Watte gepackt, man spürt Berührung
taub man spürt Berührung nicht