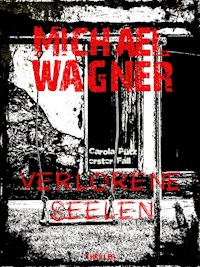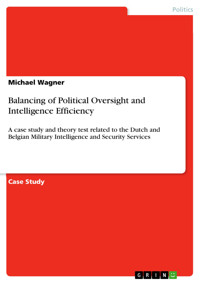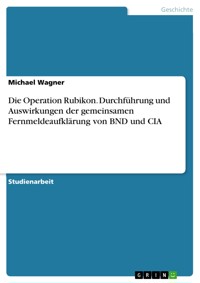Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Bär, weg mit dem Pelz ist die Geschichte einer Mannwerdung. Das Buch, das Ende der 1990er-Jahre spielt, ist in Ich-Form geschrieben. In vier Kapiteln werden die jeweiligen Entwicklungsschritte des jungen Hans Belz erzählt. Jeder Abschnitt spiegelt in Stil und Handlung die unterschiedlichen Etappen auf dem Weg ins Erwachsenenleben. Die Sprache des Romans ist direkt. Das große Thema ist die Liebe, der Sex und die Verstrickungen, die sich innerhalb von Beziehungen ergeben; sowohl in Männerfreundschaften als auch in Paarbeziehungen. Inhalt Der Hauptdarsteller Hans Belz verliert die Liebe seines Lebens nach der gemeinsamen Internatszeit aus den Augen. Sein Verhalten ihr gegenüber ist in den letzten Wochen von Gemeinheiten geprägt, nicht nur weil er sich exzessiv dem Alkohol hingibt. Noch während der Schulzeit fasst er mit seinem besten Freund Paul den Entschluss, Deutschland zu verlassen und in Irland zu leben. Nach dem Abitur erbt Paul ein Vermögen, mit dem er dem Ich-Erzähler den Lebensunterhalt finanziert. Hans Belz schreibt an einem Buch, muss feststellen, dass keine Frau die Leere ausfüllen kann, die in ihm ist; er vergeht in Sehnsucht an seine große Liebe Sara und trinkt. Er trifft eine neue Frau, Martina. Die allerdings fügt seiner geschundenen Seele nur weiteren Schaden zu. Immer wieder hat er Kontakt zu Sara, kann sie aber nie überzeugen, zu ihm zurückzukommen. Obwohl sie wieder mit ihm schläft, geht sie zu ihrem neuen Freund zurück, den sie heiratet. Zum Schluss klären sich die Fronten. Der Hauptdarsteller der Geschichte findet seine Identität.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 243
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
BÄR, WEG MIT DEM PELZ
DER ZWEITE ABSCHNITT
DER 3. ABSCHNITT
DER 4. ABSCHNITT
DER 5. ABSCHNITT
SECHSTER ABSCHNITT
SIEBTER ABSCHNITT
ZWEITES KAPITEL : ERSTER ABSCHNITT
ZWEITER ABSCHNITT
12. ABSCHNITT
13. ABSCHNITT
14. ABSCHNITT
15. ABSCHNITT – EINSCHUB
16. ABSCHNITT
17. ABSCHNITT
DRITTES KAPITEL: ERSTER ABSCHNITT
ZWEITER ABSCHNITT
DRITTER ABSCHNITT
VIERTER ABSCHNITT
FÜNFTER ABSCHNITT
VIERTES KAPITEL: ERSTER ABSCHNITT
DIE KELLERTREPPE
ZWEITER ABSCHNITT
DRITTER ABSCHNITT
VIERTER ABSCHNITT
SCHLUSS
BÄR, WEG MIT DEM PELZ
Es war an einem Freitagabend gegen halb zwölf, als ein sturzbetrunkener Mann Anfang 30 auf den Treppenstufen einer Provinzdisco saß und sich klar darüber wurde, dass er sein Leben verpfuscht hatte, dass er den Tiefpunkt erreicht hatte. Den tiefsten Punkt eines Lebens, das aus Arbeit und Alkohol besteht. Er erkannte, dass er ein verkorkstes Arschloch ist, das einen Scheiß auf seine Gefühle gibt, und auf die der anderen noch viel weniger. Schleim lief aus seiner Nase. Er wischte die Tränen ab. Leere füllte ihn aus. Tief gedemütigt, und doch nicht in der Lage, zu erkennen warum eigentlich genau, senkte er seinen Kopf. Seine Krawatte schwankte halb aufgeknöpft über dem mit Rotwein befleckten weißen Hemd. „Nein, so geht’s nicht mehr weiter“, ging es ihm durch den Kopf. Er torkelte nach draußen, um zu seinem Wagen zu kommen. „Nur heim“.
Während der Autofahrt musste der Mann anhalten. Er hatte nicht mehr dieses ungute Gefühl im Magen. Dennoch musste er sich übergeben. Nicht wegen des Alkohols. Der beruhigte seine geschundene Seele. Eher wegen des Schmerzes, den er fühlte. Seit Tagen.
Er stand gebeugt neben der Fahrertür. Das Autoradio dudelte. Und jetzt hörte er den Sänger. Zum ersten Mal seit langem fühlte er sich wieder geborgen. Ihm wurde schwindelig. Er hörte auf die Schreie in seiner Brust: „Wer denkst du, dass du bist? Jesus Christus – Superstar, wer meinst du, bist du“.
Er fiel zu Boden, sein Husten wollte nicht aufhören. Der Mann schlief auf dem Parkplatz ein, den Kopf neben einem Haufen Müll in einer Lache aus Erbrochenem.
Wie er heimgekommen ist und wie er den Weg ins Bett gefunden hat, wusste er am anderen Tag nicht mehr. Er wusste nur, er lag im Bett und krümmte sich, den Kopf auf die Hände gelegt. Den Kopf so voll, dass kein Gedanke möglich ist.
Dieser Mann war ich.
Angefangen hat die Geschichte damit, dass mich meine Eltern in ein Internat in der Schweiz geschickt hatten. Ich hatte mich gewehrt, mit Händen und Füßen. Eines Septembertages eröffnete mir meine Mutter, dass es wohl das Beste für mich sei, wenn ich den Rest meiner Schulzeit bis zum Abitur in der Schweiz verbringen würde. Eigentlich war es das Beste für sie, nur das war mir damals noch nicht klar. Mit meinem Vater lief die Ehe wohl nicht mehr so gut. Ich hatte das nicht bemerkt. Es schien alles der reinste Sonnenschein zu sein. Bis zu dem Tag, an dem sie mich ins Auto pressten. Ohne diesen Zwangsumzug wäre mein Leben wohl komplett anders verlaufen. Wie dem auch sei, die Entscheidung meiner Eltern stand fest. Wir fuhren ins Rüttikon, wo ich von nun an lernen sollte, wie ein anständiger Mensch aus mir wird.
Da stand ich nun also auf dem Campus irgendeines unwichtigen Internats im Herzen der Schweiz. Der Gebäudekomplex lag oberhalb der Stadt, die Aussicht war nicht zu verachten, die Pflanzparzellen akkurat angelegt. Küsschen von Mama, Handschlag von Vater – und weg waren sie. Es gab keine lange Abschiedszeremonie, ein neuer Teil meines Lebens hatte angefangen, und ich konnte, selbst wenn ich gewollt hätte, nichts dagegen tun. Ich fühlte mich verlassen - lange wollte ich nicht so dastehen. Es hätte mich ja einer meiner Mitschüler sehen können, wie ich neben dem Direktor auf dem Hof stand, weit davon entfernt, zu weinen - aber hilflos und alleingelassen in einer fremden Welt. Keine Menschenseele war zu sehen. Der mittelalterliche Gebäudekomplex in seiner Mächtigkeit tat sein Übriges, um mein Unbehagen zu verstärken. Der Schulleiter fasste an meine Schulter und sprach ein paar aufmunternd gemeinte Worte, im Gesicht ein aufdringliches Grinsen: „Sie werden sich hier bald wohl fühlen, Sie werden schon sehen. Sie werden sich später bei Ihren Eltern bedanken, dass sie Sie hergebracht haben.“ Er hätte mir auch aus dem Steuergesetzbuch vorlesen können. Er hätte die gleiche Wirkung erzielt. „Ja, bestimmt“, sagte ich und folgte ihm die steinernen Treppen hinauf, um mein Zimmer zu inspizieren. Immer wieder drehte sich der Schulleiter um und blickte mich mit seinem militanten Lächeln an.
„So, hier ist es, ich lasse Sie jetzt allein, seien Sie herzlich willkommen“. Und weg war auch er. Ich öffnete die Tür von Zimmer 134 und trat ein, immer noch mit einem bleiernen Gefühl im ganzen Körper.
Er saß da im Schneidersitz mit blankem Oberkörper und einer Halskette, die indianisch aussah. Seine Stoffhose war gebatikt. Das Haar kurz geschoren. Er wirkte sympathisch, mein Zimmergenosse. Zwei Betten, zwei Zonen. Die eine war kahl und hatte den Charme eines Krankenhausganges. Sein Bereich des Zimmers hingegen war mit Traumfängern, Tüchern und Figuren indischer Gottheiten geschmückt. „Ein netter Paradiesvogel“, dachte ich. Keines Blickes hat er mich gewürdigt. Er sprang auf und tänzelte aus dem Zimmer, kaum, dass ich den Raum betrat. Schüchtern und zurückhaltend trat ich ein. „Na, an mir soll’s nicht liegen“, sagte ich zu mir selbst und begann, nun schon etwas forscher, meine Kleider aus dem Koffer zu räumen.
Beim Blick aus dem Fenster wurde mir weh ums Herz. Am Ende des Himmels thronte eine Bergkette, kleine Städte lagen auf dem Weg zum Horizont. Ich lehnte mich aus dem Fenster, zündete eine Zigarette an und inhalierte tief. „Das wird schon“, munterte ich mich selbst auf. „Du bist fast 18 und wirst denen schon zeigen, wie stark Du bist.“
Der Unterricht begann erst in einer Woche. Genug Zeit, um meine neue Umgebung kennen zu lernen. In der ersten Zeit erlebte ich nicht viel. Ich schlief lange und sprach nicht viel. Nachts hielt mich Paul vom Schlafen ab. Den Namen meines Zimmernachbarn hatte ich in der Raucherecke auf dem Gang erfahren. Die anderen kannten ihn nicht gut, aber sie machten Andeutungen, dass er viel mit Frauen habe und die auch mal heimlich ins Internat schleuse. Alles in allem sei er ein „Spinner“. Er sprach im Schlaf. Ich konnte zwar nicht viel verstehen, aber Paul schien lebhafte Träume zu haben. Er diskutierte mit sich selbst über den Sinn und Unsinn, beim Fliegen einen Sturzhelm zu tragen und ab und an lachte er auch. Eigentlich war es mehr ein Glucksen.
Die Stunden gingen vorbei. Mittags rief uns der Gong in den Speisesaal, der Rest des Tages stand zur freien Verfügung, wobei wir angehalten waren, zu lernen und den Stoff des vergangenen Schuljahres noch einmal durchzugehen. Ich lag meist im Bett. Diese fremde Sprache, dieses Schweizerdeutsch, das die meisten sprachen, war mir zuwider. Ich fühlte mich einsam und verloren, wenn ich diese Sprache hörte.
An einem der ersten Abende im Internat schrieb ich Briefe und ging früh zu Bett. Gegen 2 Uhr kam Paul ins Zimmer gepoltert. Er stöhnte und ließ sich ins Bett fallen. Er hatte einen Ferienjob in der Stadt und an diesem Abend blieb er länger unten als bis 23 Uhr. Bis dahin hatten wir das Licht zu löschen. Er hatte sich verbotenerweise betrunken, das konnte man riechen. Bis zu diesem Abend hatten wir nicht viel oder eigentlich gar nichts miteinander gesprochen. Paul schien mich zu meiden, er zeigte mir die kalte Schulter. In dieser Nacht sollte das anders sein.
„Hi“, sagte Paul.
„Hallo“, sagte ich. „Du solltest leiser sein, wenn sie Dich erwischen“.
Er lachte. „Ach was. Was sollen die mir denn anhaben. Ich habe schon mehr als eine Ermahnung weggesteckt. Du musst lockerer werden, sonst gehst Du hier drin ein. Nun erzähl erstmal, wo kommst Du eigentlich her?“
Ich sagte ihm, dass ich aus einer kleinen Stadt in Deutschland komme. Und dass er schon recht habe, ich fühle mich hier elendig verloren.
„Ach was, das kann auch ganz spaßig hier sein“, sagte er: „Ich heiße Paul“.
Wir gaben uns die Hand. „Hast du dich schon ein wenig eingewöhnt?“ Ich sagte Ja, senkte dann aber den Kopf.
„Ach komm, du musst dich mehr disziplinieren, es hilft nichts, wenn du deine Zeit hier nur verschläfst“.
„Sehr richtig“.
„Stell dich nicht so mimosenhaft an“
„Du hast ja leicht reden“
„Am Anfang ist es immer schwer“.
„Ich weiß nicht, was hier so viel besser werden soll.“
„Wirst schon sehen, es ist cool hier, das kann es zumindest sein, wenn Du dich mit deiner Situation anfreundest“.
„Na ja, mal sehen.“
„Was soll denn aus Dir mal werden, wenn Du fertig bist mit der Schule?
„Ich weiß nicht.“
Ich schwieg. „Na, was ist jetzt“, sagte er.
„Nun, ich schreibe gern und könnte mir auch vorstellen, Schauspieler zu werden.“
„Na, das ist doch was.“
„Und Du, was willst du machen?“
„Ist mir egal. Ich mache das, was ich will. Ist mir gleich, ob ich viel Geld verdiene. Ich will leben, fertig“
„Ich habe einen Traum. Wenn ich mit 35 noch nicht einen Gnadenhof für Schafe in Irland habe, dann ist alles zu spät“, sagte ich etwas schüchtern.
Er lächelte. Dabei wurden seine Lippen so lang, wie ich es nie zuvor gesehen hatte. Seine Mundwinkel zeigten nach oben, aber erst in einem Bereich, wo eigentlich keine Lippen mehr sind. Es tat gut, ihn lächeln zu sehen. Er habe reiche Eltern, erzählte Paul. Ein Haus gehöre schon heute nahezu ihm. Es stehe leer und er habe wohnrecht. „Da gehen wir am Wochenende gemeinsam hin und lassen die Kuh fliegen, das ist fürs erste besser als auszuwandern“, sagte er und zog ein in Folie gepacktes Bündel heraus, das aussah wie Blätter eines Baumes. „Bestes Gras“, sagte er. Ich wollte mir meine Unwissenheit nicht anmerken lassen und grinste.
Dann rauchten wir. Es brannte in meinem Hals. Zigaretten war ich gewöhnt, aber ich musste dennoch husten. Mir wurde wohl. Und ich erzählte von daheim und von Annabelle, mit der ich immer Indianer gespielt habe, der ich schwor, sie zu meiner Frau zu nehmen.
Dabei musste ich so lachen wie lange nicht mehr. Ich konnte nicht mehr aufhören. Kaum, dass ich dachte, ich beruhige mich, schüttelte mich eine neue Lachattacke.
Paul saß und hielt den Kopf leicht schräg. Er lächelte. Als ich wieder zur Ruhe gekommen war, erzählte er mir von sich.
„Weiß du, was die anderen sagen, das kannste alles vergessen. Ich gebe einen Scheiß darauf, was die von mir denken.“
„Da hast du recht. Es ist unglaublich, wie sich manche Leute das Maul verreißen.“
Paul nahm regelmäßig Drogen. Das tue seiner Seele gut. Ab und an halte er mit Bekannten Sessions ab, während denen sie kifften und auch andere Drogen nahmen.
Ich dachte immer, wer Drogen nimmt, ist süchtig, ungepflegt und steht nahe vor dem Tod. Paul belehrte mich eines bessern.
„Was reizt Dich so an Irland“, fragte er mich.
„Die Wiesen sind grün und saftig, das Wetter rau und die Menschen nett. Außerdem geht dort alles ein bisschen gemütlicher zu als hier bei uns. Ich stelle mir dort ein unglaublich freies Leben vor. Stell Dir vor, Du könntest jeden Morgen aufstehen und wissen, Du tust es nur für Dich. Nicht für den Lehrer oder den Chef“
Er grinste in einer sehr angenehmen Art: „Willst Du ohne Geld nach Irland und die Schafe ernähren? Womit willst Du ein Haus und Grundstück zahlen, was willst Du essen?“
Das machte mich wütend. „Weißt du, wie mir hier alles stinkt. Was fange ich denn an mit meinem Leben? Ich sitze den ganzen lieben langen Tag nur rum und höre mir den Schwachsinn an, den andere verzapfen. Ich muss weg. Ich habe das Gefühl, entweder ich gehe weg oder hier ein.“
Ja, das wollte ich. Das Problem war nur, ich bekam einfach den Hintern nicht hoch. Im Pläne schmieden war ich gut, Pläne die sich fern jedweder Realität bewegten - nur um eine Entscheidung umzusetzen, dazu fehlte mir der Mumm.
Paul hatte an diesem Abend schon recht, es waren eigentlich nichts als Flausen, die ich mir selbst in den Kopf gesteckt hatte. Vermutlich würde ich nie auf die Insel ziehen. Und doch, in meiner Brust fühlte ich ein Sehnen. Ich hatte das Gefühl, alles zurücklassen zu müssen oder vor die Hunde zu gehen.
Paul riss mich aus meinen Gedanken an weite Wiesen und strömende Brandung. „Hast Du keine Frau, die Dich zurückhält?“
Ich zögerte mit der Antwort, es war mir äußerst unangenehm über Frauen und Gefühle zu sprechen, sagte dann aber: „Nein, ich habe keine Freundin. Sieh mal, ich sitze hier in diesem verschissenen Internat, weit weg von Zuhause. Was sollte mich schon zurückhalten? Ich könnte ein neues Leben anfangen.“ Zögerlich stellte ich die Frage: „Und Du bist ein Frauenheld, habe ich recht?“
Pauls Lachen endete in einem hässlichen Husten. Ich weiß heute nicht, ob Paul wegen der Dummheit der Frage lachte oder weil ihm die Vorstellung, ein Frauenheld zu sein, so amüsant vorkam.
Nur, in diesem Moment fiel mir nichts Besseres ein und ich wollte das Gespräch auf jeden Fall vom Thema „Frauen und ich“ weglenken. Paul stieg ein: „Ich weiß noch nicht, ob ich schwul bin, also vögele ich erstmal jede Frau, die mich lässt und das könnte ich meinetwegen auch in Irland tun“.
Die Unverfrorenheit dieser Antwort war mir damals nicht bewusst, ich dachte nur, dass ich diesen Paul erst seit sehr kurzer Zeit kannte und fand ihn in dieser Sekunde zum Kotzen. Ich wurde konservativ erzogen, über Sex wurde nicht geredet. Ich war baff. Und was Paul kurz darauf sagte, widerte mich an. Er berichtete davon, wie ihm einmal ein Bekannter während einer Kiff-Session einen geblasen hatte, und dass das ziemlich geil gewesen sei.
Mir war das nicht geheuer und antwortete ihm: „Ich habe nichts gegen Schwule, ich kann sie nur nicht ausstehen“. Er lachte.
An diesem Abend wurden wir Freunde.
In den folgenden Tagen sprachen wir viel, rauchten heimlich im Zimmer, tranken jede Menge Bier und schon war es soweit: Die Schule fing an. Mittlerweile war auch mein Bereich des Zimmers wohnlicher geworden. Kunstdrucke mit nackten Frauen, Karten, die mir meine Freunde aus der Heimat geschickt hatten, und eine Blume hatte ich aufgestellt.
Am Abend vor Schulbeginn dachte ich, ich könne vor Nervosität kaum einschlafen. Paul döste, ich hörte ihn nebenan schwer atmen. Ich nahm meine Kopfhörer, die ich an mein Radio angeschlossen hatte, und träumte vor mich hin. Seit dem Abend, an dem ich mit Paul Gras geraucht hatte, schien in meinem Gehirn eine Tür aufgestoßen worden zu sein, von der ich zuvor nicht einmal wusste, dass sie existiert. Lieder berührten mich auf einmal viel intensiver. Ich konnte mich in ihre Geschichte einklinken und jeden Ton spüren, jede Zeile ließ ein Bild entstehen. Phil Collins sang „True Colors“. Ich glaubte in diesem Moment, niemals zuvor ein solch perfektes Lied gehört zu haben. Ich wusste es noch nicht, aber auch ich würde bald jemanden treffen, dessen wahre Farben ich erkennen konnte. Ich genoss das Lied. Als es vorbei war, fühlte ich mich geborgen, träumte von einer perfekten Zukunft und nahm kein Problem, das mich vorher noch so stark belastet hatte, mehr wahr. Es war ein unglaubliches Gefühl der Sicherheit, das mich übermannte. Kurz darauf war ich eingeschlafen. Mit der Gewissheit, dass es kein unlösbares Problem auf dieser Welt gab.
DER ZWEITE ABSCHNITT
Am nächsten Morgen fühlte ich mich wie gerädert. Als ich aufwachte war das Zimmer leer. Mit einem Satz war ich aus dem Bett, sobald mir klar war, dass der Unterricht in zehn Minuten beginnt. Hektisch zog ich mich an, putzte die Zähne und rannte die Korridore hinunter, um nicht zu spät zu kommen. Ich war pünktlich.
Die anderen nahm ich nicht weiter wahr. Sie saßen grüppchenweise zusammen und unterhielten sich, bis der Lehrer den Raum betrat. Die erste Stunde begann und war unerträglich. Dem Lehrer konnte ich in keiner Weise folgen. Meine Lieder waren schwer. Ich stützte meinen Kopf mit meinen Armen und fragte mich, wie ich diesen Tag herumkriegen sollte. Dann drehte ich meinen Kopf ein wenig nach links.
Alle Mattigkeit wich aus meinen Gliedern. Es war ein unglaublicher Anblick. Da war es, mein neues Leben. Da saß sie, die Frau aus meinen Träumen.
Ich konnte die Augen nicht mehr abwenden und wenn ich überhaupt was dachte, dann, dass ich nie eine schönere Frau gesehen habe. Ihre Haare waren schwarz und schimmerten. Sie waren lang und fielen immer wieder in Strähnen über ihr Gesicht. Es war etwas länglich und ihre Nase lief spitz zu. Sie hatte ein klein wenig die Form eines Adlerschnabels und sie hatte genau die richtige Größe. Ihre Augen leuchteten. Alle Worte sind nicht in der Lage zu beschreiben, was ich empfand, als ich Sara das erste Mal sah. Es war wie nach Hause kommen. Es war wie ein Aufwachen aus tiefem Schlaf. Es machte mich glücklich, sie anzusehen. Mehr wollte ich nicht. Und ich hoffte, diese Stunde würde nie vorüber gehen, für ewig andauen.
Ich sah sie einfach nur an und fühlte mich wohl. Der Lehrer stellte ihr eine Frage. Sie sprechen zu hören ließ mich beinahe platzen vor Glück. Hilflos war ich ihr ausgeliefert. Kein Gedanke an Zukunft oder Vergangenheit, nur sie. Es war die reinste Freude. Irgendwann bemerkte sie, dass ich ununterbrochen zu ihr hinüberschaute. Sie lächelte. Und ich war zufrieden. Es war der Himmel auf Erden.
Aber auch diese Stunde ging vorbei. Wir packten unsere Sachen ein und gingen zur Pause auf den Gang.
Dort kam sie zu mir.
„Hallo“.
„Hallo“, die Begrüßung kam geradeso aus meinem Mund heraus. Mir schwindelte.
„Du scheinst mir sympathisch zu sein. Lass uns doch mal eine Cola trinken gehen“.
Der Boden unter mir schien nachzugeben. Ich versank irgendwo darin. Mein Körper schien durchlässig zu sein. So stand ich da.
„Ich bin nur ein Träumer, aber Du bist einfach ein Traum. Schön, dass Du mit mir was trinken gehen willst. Klar gehe ich mit, es gibt nichts Schöneres für mich“.
Die Antwort ist irgendwo zwischen Bauch und Hals stecken geblieben. Ich sagte nichts. Ich schaute nach rechts und auf den Boden. Es war so, als könnte ich mich für keinen der tausend Buchstaben in meinem Kopf entscheiden. Ich sagte nichts, einfach nichts.
Und irgendwann hörte ich mich sagen: „Ok, bis dann“.
Ich ging weg, einfach weg. Und ich hoffte, dass ich mir diesen Moment nur erträumt hatte, dass er einfach nicht real ist. Doch er war es. Ich hatte also ihre „Farben“ erkannt, doch war nicht in der Lage, es ihr zu zeigen. Ich hatte Angst sie könnte mich verletzen.
Ich konnte nicht mehr zurück in die Klasse. Es ging nicht, so meldete ich mich beim Lehrer und sagte, dass es mir unglaublich schlecht geht. Ich ging in mein Zimmer, um mich unter der Bettdecke zu verkriechen.
Gegen Mittag kam Paul ins Zimmer.
„Was ist los, plötzlich warst Du leichenblass, bist du krank?“
„Komplett kaputt“, sagte ich und erzählte ihm, was passiert war.
Paul riss die Augen auf.
„Was hast Du gemacht, bist Du noch zu retten? Du Idiot, jetzt hält sie dich für ein totales Arschloch. Was ist nur los mit Dir?“
Ich sagte nichts, sondern schaute betrübt auf den Boden.
„Oh Mann, das kann ich nicht verstehen“.
„Weiß doch auch nicht.“
„Lass uns einen trinken“, hauchte Paul mir mit rauer Stimme zu.
Er griff in seinen Nachtischschrank und holte eine Flasche Whiskey hervor. Das tat gut, Nachmittag hin, Nachmittag her. Mein Magen wurde warm und ich konnte wieder klare Gedanken fassen. Nach zwei Gläsern war ich soweit: „Ich gehe zu ihr und erkläre ihr alles, sofort. Sie ist der beste Mensch, den ich jemals gesehen habe“.
„Das halte nicht für eine gute Idee. Nimm dir Zeit und schlaf eine Nacht, bevor Du mit ihr redest“. Vielleicht hatte Paul recht. Vielleicht war es keine gute Idee, am frühen Nachmittag mit einer Alkoholfahne durch das Internat zu laufen und sich vor Sara zum Affen zu machen.
„Warte ab, am Wochenende gebe ich eine Party in meinem Haus, dann wird sich alles einrenken“, sagte Paul und schenkte mein Glas wieder voll. Ich willigte ein. Das war ein Hoffnungsschimmer. Sofort schmiedete ich Pläne, wie ich mich verhalten würde und was ich ihr alles sagen würde.
„Wenn ich Sara nicht bekomme, dann werde ich nie mehr eine Frau lieben, in meinem ganzen Leben“, sagte ich zu Paul. Der schrie mir seine Antwort entgegen: „Weiber sind’s Grab, ficken bringt’s“. Ich schaute verdutzt. Es war mir bitterernst in diesem Moment: „Sara bedeutet mir mehr als das“. Paul lächelte: „Komm, wir rauchen einen“.
Ich winkte ab: „Nö, lass mal, für mich lieber nicht, halte mich lieber an dieses braune Getränk hier in meinem Zahnputzbecher.“ Das tat ich. Der Pegel der Flasche nahm ab, während Paul sich einen Joint nach dem anderen reinzog. Die Sonne ging unter und auch der Verstand ließ mehr und mehr nach: „Paul, du hast keine Ahnung. Ich will nicht nur eine Affäre mit Sara, ich will mehr von ihr.
Aber das kannst du mit deinem Spatzenhirn vermutlich gar nicht begreifen. Dir geht es ja nur ums Bumsen. Du fickst vermutlich alles, was zwei Beine hat.“ Paul wurde ein wenig sauer. „Meinst wohl, du bist der Einzige, der weiß, was Liebe ist, hä. Meinst wohl, du bist was Besseres, weil du aus Deutschland kommst und so“.
„Ach, lass mich in Ruhe“.
Ich wollte mich nicht streiten. Was ich eigentlich wollte, weiß ich nicht.
Es gab keine Worte, die das Gefühl, das ich bei ihrem Anblick hatte, beschreiben können. Dabei kannte ich sie gar nicht. Einen Vormittag hatte ich sie bewundert und konnte nur noch an ihr Gesicht denken. „Paul, sei mir nicht böse, es tut mir leid, ich war blöd“. Er reagierte nicht, sondern fragte mich: „Was fasziniert Dich so an ihr, hattest Du überhaupt schon eine Frau“.
Mit meiner Klassenkameradin Eva hatte ich nach einem Fest rumgeknutscht und ihre Titten geknetet. Geschlafen hatte ich noch mit keiner Frau, das wollte ich Paul gegenüber aber nicht zugeben.
„Na klar, ich hab schon mit drei Mädels gefickt“, sagte ich zu ihm.
Paul nahm einen Zug von seinem Joint und blies den Rauch in mein Gesicht.
„Gut.“ Mehr sagte er nicht.
„Ich habe bei ihr das Gefühl, das alles passt, weißt du. Sie scheint mein exaktes Gegenstück zu sein. Ich kann nichts gegen meine Gefühle machen, sie sind einfach so wie sie sind.“
Er sagte nichts. Wir sprachen nichts mehr. Ich dachte an den Samstag und das Fest in Pauls Haus, bei dem ich Saras Herz gewinnen wollte.
Ich hatte keine Ahnung, wie ich mich verhalten sollte. Keinen blassen Schimmer, was ich sagen sollte und auch nicht wie ich mich am nächsten Tag ihr gegenüber geben würde. Die Aktion auf dem Gang war einfach zu peinlich gewesen. Entweder dachte sie, ich bin ein arrogantes Ekel oder ein verklemmtes Arschloch. Meine Nerven lagen blank.
„Gib mir was von deinem Gras“, forderte ich Paul auf.
Paul drehte einen Joint, wir rauchten und schwiegen.
Bis Paul nach einer halben Stunde mit ernstem Gesichtsausdruck in die Stille hinein sagte: „Wir gehen beide nach Irland“. Ich blickte auf, das konnte er nicht wahrhaftig gemeint haben. „Paul, das meinst Du doch nicht ernst. Ich habe es satt, diese ewige Träumerei und Schwätzerei nach genügend Alkohol, was man alles machen könnte, was man alles verwirklichen könnte. Das ist alles nur heiße Luft, wenn man es nicht wirklich tut“.
„Ich meine es ehrlich. Wir kaufen uns ein Haus und kümmern uns um Schafe. Ich habe gehört, dass dort alte, verlassene Häuser stehen, die niemand mehr bewohnt, aber auch niemand niederreißt. Da setzen wir einen Giebel drauf, bessern die Mauern aus und ziehen ein.“
Ich lachte: „Wer von uns beiden ist denn jetzt naiv“?
„Wieso, wir könnten es schaffen. Wir packen unser Erspartes zusammen, hauen unsere Eltern an und schon kann es gehen.“
Er goss uns Whiskey nach: „Komm, lass es uns versuchen.“ So schweigsam wir vor wenigen Minuten noch waren, wie sehr ich auch an Sara gedacht hatte – es war alles nichtig. Nur noch Irland stand im Mittelpunkt. Im Bauch ein Kribbeln, den Kopf vernebelt – so schmiedeten wir unsere Pläne. Wir redeten an diesem Abend über nichts anderes mehr. Wir taten es so lange, bis wir beide überzeugt waren, gehen zu wollen. Per Handschlag wurde der Pakt besiegelt. „Wenn du willst, kann ich morgen meine Koffer gepackt haben“, sagte Paul. Auf einmal wurde es mir wieder unheimlich. Ich kannte diesen Menschen einfach nicht gut genug. Doch dieses Gefühl hielt nicht lange an. Bald war ich wieder vom Reisefieber gepackt. War es auch noch so utopisch, ich war überzeugt, dass wir es schaffen können. „Das einzige richtige Problem ist das Geld“, sagte ich. „Wir nehmen einen Song auf, verdienen Geld und sind sofort auf der Insel“, erklärte Paul und das mitnichten mit einem lächelnden Gesicht. Es war Unsinn, doch mir erschien es möglich. Pauls Euphorie steckte mich an. Ich ließ mich treiben, der Rausch mag seinen Teil beigetragen haben. Doch an diesem Abend schliefen wir beide mit der Gewissheit ein, das Land zu verlassen. Was hatten wir schon zu verlieren. Kein Auto, keinen Job, keine Freunde und keine Frau. Ich schlief ein und träumte, wie es wäre mit Sara in Irland zu leben - es war ein schöner und unschuldiger Traum.
Doch mit dem Morgen sah die Welt wieder anders aus. Ein Kater plagte mich und ich hatte mehr als ein mieses Gefühl im Bauch. Wie sollte ich Sara jemals wieder in die Augen sehen können. Ich versuchte, sie zu meiden. Ich getraute mich während des Unterrichts nicht, sie anzuschauen.
Es war ein Kampf. Der Weg zum Kaffeeautomaten wurde zur Qual. Nur sie nicht sehen. Zudem fühlte sich mein Gehirn an wie eine breiige Masse. Ich konnte keinen klaren Gedanken fassen. Mit Paul sprach ich nicht mehr über Irland. Auch er zeigte keine große Lust, auf das Thema einzugehen. So schleppte ich mich durch den Tag. Den Kopf voller Gedanken, die zwischen großer Liebe und Angst abwechselten. Im Bauch ein unangenehmes Drücken. Dieses Gefühl hielt an, nichts passierte groß. Es war so, als packe ich alle meine Träume, Wünsche und Hoffnungen in eine Schublade meines Gehirns. Die wurde verschlossen und nichts erinnerte mich mehr daran. Ich fühlte mich beschissen.
DER 3. ABSCHNITT
An einem der nächsten Abende saß ich im Zimmer und hörte ein wenig Musik. Paul war wieder in der Stadt, um zu arbeiten. Ich war nicht müde und langweilte mich ein bisschen. Da klopfte es an der Tür.
„Ja, komm rein, ist offen“
Sara stand in der Tür.
„Darf ich reinkommen?“
Ich stand auf. „Ja, klar“. Mann, mein Herz pochte wie wild. Sie setzte sich auf mein Bett.
„Was machste so?“
„Ach nichts groß. Schön, dass du gekommen bist“
„Weißt du, ich würde Dir gerne etwas zeigen.“
„So, was denn?“
Ich habs hier dabei“.
Sie hatte eine Plastiktüte mitgebracht.
- „Was meinst Du, brauchen Frauen sexy Wäsche, um Männer verführen zu können?“
Mir stockte der Atem, mein Kopf schien sich zu drehen.
- Ja, ich weiß nicht“.
Sie fasste in die Tüte und sagte „Dreh dich um“. Ich wendete mich in Richtung Fenster. Was konnte sie nur vorhaben? Ich hörte, wie sie ihre Hose auszog.
Ich hielt es kaum noch aus und schwankte von einem Bein auf das andere. Als ich mich schließlich umdrehen durfte, glaubte ich, meinen Augen nicht trauen zu dürfen. Da stand Sara, angezogen mit einem Nichts. Sie stand auf und kam auf mich zu.
„Na, wie findest du es?“
Ich war sprachlos. So etwas Schönes hatte ich nie zuvor gesehen. Ihr Körper hatte eine unbeschreibliche Anziehungskraft auf mich. Sie sah so gut aus, dass es fast schmerzte. Ich ging wie in Trance auf sie zu, fasste ihren Kopf an und küsste sie. Danach ging alles wie von selbst. Bis zu einem gewissen Punkt. Wir streichelten und küssten uns. Unvermittelt stand sie auf.
- „Ich muss gehen“.
„Bleib doch, es ist doch gerade so schön“.
- „Nein, ich kann nicht“.
Sie zog sich schnell an und verließ den Raum.
Total verdattert ließ sie mich zurück. Ich konnte mein Glück gar nicht fassen. Ich trat unwillkürlich einen Schritt zurück und musste mich am Vorhang festhalten, um nicht umzufallen. Wie gern hätte ich sofort Paul von dem Erlebnis erzählt. Ein Kribbeln zog von den Füßen bis zu meinen Schläfen hinauf. Ich packte mich auf meine Matratze. Ich lag auf dem Bett und um nichts auf der Welt hätte ich woanders sein wollen. Mit einem verklärten Grinsen betrachtete ich den Raum. Die Sonne schickte ihre letzten Strahlen ins Zimmer. Das Licht flackerte auf dem Boden hin und her. Ich atmete bewusst tief ein und aus. Mein Puls ging deutlich schneller als gewöhnlich. Das Leben kam mir leicht vor, ich hatte das Gefühl, dass es nichts gab, was ich nicht schaffen konnte, alles war möglich. Ob Irland oder nicht, hier oder dort – das war egal. Ich wusste, dass das Leben überall und an jedem Ort gut ist solange es Sara gab.