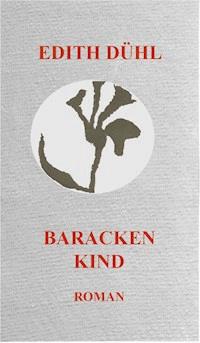
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Roman "Barackenkind" ist in drei Teile gegliedert: Im Prolog schildert die Hauptperson Elisabeth das Leben ihrer Mutter. "Leokadia, meine Mutter, ist heute vor allem eine Stimme in meinem Kopf, eine Stimme, die singt" und eine Stimme, die erzählt: "Weißt, Lischen…." Es waren schwere Erfahrungen, von denen Leokadia erzählte. Sie hatte das Schicksal vieler Russlanddeutscher in den beiden Weltkriegen erlitten: Als Kind war sie nach Sibirien verschleppt worden und am Ende des 2. Weltkriegs mit ihren sieben Kindern von Ostpreußen nach Niedersachsen geflüchtet, wo sie als Kriegerwitwe schwer arbeitete, um ihre Kinder durchzubringen. Elisabeth, noch ein Kleinkind zu der Zeit, litt sehr darunter, dass ihre Mutter selten zu Hause sein konnte. Sehnsucht nach ihr war das Grundgefühl ihrer Kindheit. Der Hauptteil spielt in den 90er Jahren. Elisabeth, Anfang 50, geschieden, Lehrerin und Schriftstellerin, besucht in ihren Herbstferien ein Treffen der Menschen, mit denen sie die Kindheit in einem Flüchtlingslager der Nachkriegszeit verbracht hat. Auf dem Weg dorthin holen sie die Schrecken von damals wieder ein. Lange hat sie gezögert, die Einladung zu dem Treffen in Herbstede anzunehmen, wo sie als kleines Kind mit ihrer Familie 1945 gelandet war. Sie möchte nichts zu tun haben mit den Gespenstern ihrer Kindheit. Aber als immer häufiger Erinnerungen an das Barackenlager in ihre Ferienwoche einbrechen, beschließt sie, loszufahren und vor dem Treffen Herbstede wiederzusehen und ihre dort lebenden Geschwister zu besuchen. Nachts sind alle Erinnerungen wieder da: Einsamkeit, Schuldgefühle, Angst in vielfältiger Form: vor dem Teufel, vor Spuk, vor Gewalttätigkeit und sexuellen Übergriffen. Der alte Bubi aus dem Altersheim zahlte fünfzig Pfennig, wenn ein Mädchen die Hose auszog. Das Ledergesicht hat Gundel vergewaltigt. Aber am schlimmsten für sie war das tägliche lange Warten auf die Mutter.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 468
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Edith Dühl
Barackenkind
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Vorwort
Titel
Leokadia
1
2
3
Barackenkind, 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Epilog
Leseprobe WUNDROSE
Impressum neobooks
Vorwort
In „Barackenkind“ trifft die 51jährige Lehrerin und Schriftstellerin Elisabeth die Menschen wieder, mit denen sie als Kind, nach der Flucht aus Ostpreußen am Ende des 2. Weltkriegs, lange Jahre in einem Barackenlager verbracht hat; Jahre voller Einsamkeit und Angst: Die Roggenmuhme wollte einen fangen, der alte Bubi zahlte fünfzig Pfennig, wenn ein Mädchen die Hose auszog, das Ledergesicht vergewaltigte Gundel… Am schlimmsten aber war die Sehnsucht nach der Mutter, das endlose Warten, bis sie von der Arbeit kam. Vieles, dem Elisabeth lange ausgewichen ist, muss sie noch einmal durchleben.
Bei dem Treffen erfährt Elisabeth eine unerwartete, große Nähe zu den ehemaligen Barackenkindern, die sie jahrzehntelang nicht gesehen hat. Ihr Leben erhält eine überraschende Wende.
Edith Dühl hat ihrer Romanfigur Elisabeth ihre eigene Kindheitsgeschichte gegeben, und die im Prolog beschriebene Geschichte einer Russlanddeutschen, die im ersten Weltkrieg mit ihrer Familie nach Sibirien verschleppt wurde, erzählt die Geschichte ihrer Mutter Leokadia.
„Barackenkind“ ist der erste von vier zusammengehörenden Romanen, die durch ihre Frauengestalten miteinander verbunden sind, Freundinnen, die sich seit dem Studium durch das Leben begleitet haben.
Jeder der vier Romane „Barackenkind“, „Wundrose“, „Unterwegs“ und „Bleiben“ erzählt eine unabhängige Geschichte, doch zusammen ergeben sie ein Panorama dessen, was die Lebensjahre zwischen 40 und 50 bereit halten: Liebeskonflikte, Trennungen, Probleme mit Kindern, Tod von Angehörigen – und die Möglichkeit des Neubeginns.
Titel
Edith Dühl
BARACKENKIND
Für Christian und Benjamin
Leokadia
Wege. So viele, so lange Wege. Dabei begann Leokadias Weg in freundlichen Landstrichen, wo der weiße Weizen sich im Sommerwind wellte und Schlangen mit goldenen Augen zu den Menschen kamen und von ihrer Milch tranken. Aber dann schwangen Soldaten Nagaijkas und jagten die Bewohner fort aus dem weizenumwogten Haus, trieben sie durch Sümpfe, in denen Seuchen brüteten. Weite Flüsse mussten sie hinunterfahren, durch Steppen und Wüsten ziehen, hin und zurück durch den Krieg, wo Hunger so grausam wütete, dass Menschen Menschen fraßen. Keine Bleibe bot ihnen das Land, nur Notlager, Erdhöhlen, Schuppen, um den kahl geschorenen Kopf auszuruhen oder seuchenkrank still zu liegen, zu sterben.
Dann gab es für Leokadia ein paar Jahre Rast in einem Land, wo im Frühling die Saat gesät, im Sommer das Wachstum betreut, im Herbst die Ernte eingebracht und im Winter die Lieder ins Reine geschrieben wurden, die die Arbeit des Jahres begleiteten. Und wo sie ihre Kinder gebar. Dort fühlte es sich an wie zu Hause. Aber das Böse breitete sich aus bis zu ihnen, man tat nichts, es zu verhindern, bis Panzer heran rollten und sie aus dem neuen Zuhause flüchten musste. Da führten die Wege weiter durch gespurten Schnee, über scholliges Eis breiter Flüsse, weiter, weiter...
und manche führten in die innere Wüste und die Not und der Durst nach dem Wasser des Lebens waren groß. Und irgendwann führten sie in den Tod. Oder gab es Erlösung, führten alle Wege nach Haus, immer nach Hause? Wer alles hat nicht behauptet, dass es so sei! Auch Leokadia war sich ganz sicher, dass ihr Weg über den Tod hinaus in die himmlische Heimat führen würde. Trotz mancher Zweifel gab es für sie in jeder Wüste Wasser des Lebens zu trinken und das Ziel aller Wege stand für sie fest.
Ich wünschte so sehr, dass sie angekommen ist in der himmlischen Heimat und getröstet in Abrahams Schoß ruht.
1
Leokadia, meine Mutter, ist heute vor allem eine Stimme in meinem Kopf, eine Stimme, die singt, in warmem, vollem Alt, erstaunlich füllig für den kleinen Körper, aus dem sie strömt.
„Weil ich Jesu Schäflein bin,
freu ich mich nun immerhin
über meine grüne Weide,
dass ich keinen Hunger leide,
und sobald ich durstig bin,
führst du mich zur Quelle hin. ...“,
das passte zur kleinen Leokadia. Ihre Dankbarkeit dafür, dass sie keinen Hunger und Durst leiden musste, war nicht nur Singsang, so viel verstand ich schon als Kind. Aber dann ertönte auch voll und sicher „Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, die du geschaffen durch dein Allmachtswort...“ oder „Ich bete an die Macht der Liebe, die sich in Christus offenbart ...“, und ich staunte sie an wie eine Predigerin.
Mehr eine Erinnerung des Gehörs als des Gesichts, jedenfalls in den frühen Kinderjahren, aber doch steht meine Mutter auch in Bildern vor meinem inneren Auge, rotglühend und verschwitzt, wenn sie von der Feldarbeit nach Hause kommt, später am Abend blass am Spinnrad, nur in den Äderchen auf den Wangen hat die Röte überlebt. Immer hat sie zu tun, selten darf ich auf ihren Schoß. Ich sehe sie in der Nacht am Bett knien und beten und der tagsüber aufgesteckte Zopf läuft lang das Rückgrat hinab. Leokadia am Wäschetrog. Ein Hemd zwischen den rubbelnden Händen, durchdringt ihre Stimme den Wasserdampf und füllt die ziegelgemauerte Waschküche mit hallendem Gesang. Dann neben mir auf dem Sofa die schwache, alte Leokadia, verstummt, mit zart gewordenen, blau geäderten Händchen im Schoß. Und plötzlich betrachtet sie mich prüfend.
„Lokaddja“, so nannten sie ihre ostpreußischen Schwägerinnen und ihre Nachbarinnen. Frauenstimmen habe ich im Ohr, wenn ich diesen Namen meiner Mutter höre, „Lokaddja“.
Mit ihren vielen Kindern lebte sie zwischen Frauen, die wie sie viele Kinder geboren hatten. Männer gab es in ihrer Welt wenige, seit der ostpreußische Gewaltgauleiter die letzten bis dahin Unabkömmlichen und dann auch Jungen und Greise aufbot, um Erdwälle aufzuschaufeln als Schutz gegen die Panzer und Geschütze der Sowjetarmee. Nicht zu fassen, dass Gauleiter Koch an die Wirksamkeit dieser Wälle glaubte. In seinem letzten Fronturlaub hatte Rudolf, ihr Mann, einen Leiterwagen mit einem Dach versehen und ihn so eingerichtet, dass alle Kinder in Federbetten, dem wie sich herausstellte kostbarsten Besitz, warm sitzen und Leokadia warm liegen konnte. Denn Leokadia war krank, als sie losfuhren, war schon lange krank gewesen und wurde erst unterwegs während der zwei Monate dauernden Flucht langsam wieder gesund. Aber sie fuhr los, ob krank oder nicht, machte sich nach einigen Jahren der Rast wieder auf den Weg, ohne die Verwandten aus dem Nachbardorf, die zauderten und gehorsam auf die Order des Gauleiters warteten. Sie fuhr, als die Geschütze in der Ferne zu donnern begannen, den einen Tag eher los, der über Wegkommen oder Bleiben entschied. Ihre Verwandten fielen der einrückenden Armee in die Hände.
Ihr Mann blieb dort, wohin ihn der Volkssturm zuletzt, April 1945, noch geweht hatte, an der Samlandküste. Die Nummer des Soldatengrabes wurde Leokadia ins neue Zuhause geschickt zusammen mit den paar persönlichen Gegenständen, die von ihm geblieben waren: dem Wehrpass, den Familienfotos und einer Uhr mit zerbrochenem Glas. Auf den Fotos existiere ich nicht. In den letzten Kriegsmonaten, als es mich auch schon gab, wurde nicht mehr fotografiert.
Leokadia konnte den Soldatenfriedhof, wo man ihn neben vielen anderen eingegraben hatte, nie besuchen, unzugänglich lag er im russischen Sperrgebiet. Sie blieb im Westen, in dem Dorf, in dem die Flucht geendet hatte. Blieb auch, als heimreisende russische Kriegsarbeiter sie aus dem zerstörten Deutschland mit zurücknehmen wollten, als ihnen auffiel, wie fließend die kleine Frau russisch und ukrainisch sprach. Sie blieb, getrennt vom ukrainischen Land ihrer ersten Lebensjahre, dem kirgisischen ihrer späteren Kindheit und dem polnisch gewordenen ihrer Jugend, Witwe seit ihrem 38. Jahr, mit ihren Kindern in einem Dorf in Niedersachsen.
Für keins unter meinen Geschwistern, glaube ich, ist „die Mutti“, „unse Mutti“, so deutlich Leokadia geworden wie für mich. Alle meine Geschwister erlebten die frühen Kinderjahre im Osten, im Schoß einer großen Familie, die es zu einigem Ansehen und Wohlstand gebracht hatte, nicht im Barackenlager im Westen. Die Mutter, die meine Geschwister ins Leben begleitete, musste nicht von früh bis spät rackern, um die notwendigsten Lebensmittel zu verdienen. Während der ganzen Kindheit im „Wir“ der großen Geschwisterschar untergegangen, bin ich jetzt eine Einzelne. Wenigstens in dieser Geschichte ist „unse“ Mutti meine Mutter, ich muss nicht mehr teilen. Leokadias Geschichte ist ganz ihre und doch ein bestimmender Teil meiner eigenen. Nicht umsonst hat mein Gedächtnis viele Einzelheiten aus ihrem Leben so genau aufbewahrt, an die meine Geschwister, obwohl alle älter als ich, sich nicht erinnern. Vielleicht habe ich immer geahnt, dass ihre Geschichte für mich lebensnotwendiger Stoff ist. Stoff, um mich zurechtzuerzählen, um mir eine Bleibe zu schaffen in der Wüste der Welt, ein Zuhause.
Die Augen schließen. Der Stimme lauschen. Nicht immer sang sie, sie hatte auch viel zu erzählen.
„Weißt, mein Kind“, so begann meine Mutter oft. Wenn auch nicht auf dem Schoß, so hockte ich doch auf dem Fußbänkchen neben dem Spinnrad nah bei ihr. Wir waren beide eingehüllt vom Geruch des fettigen Schafwollebuschs auf der Spindel. „Das war ja die Ukraine. Da hatten ja meine Eltern einen Hof. Aber da waren auch noch andere Deutsche und noch sonst viele verschiedene Leute: Ukrainer und Russen und Polen und Kosaken und Juden. Das war ja ein ganz anderes Land als hier. Der Fluss war so breit, nicht wie die Delme, und da wuchs ja der Weizen, Felder, weiß, so weit wie du sehen konntest, und der Wind fuhr da immer so rein und machte Wellen und dazwischen waren auch Felder mit Mohn, lila und weiß und rosa.“
„Und im Sommer war es lange Monate warm. Da brauchtest du für Wochen keine Schuh. Aber im Winter, da musstest du aufpassen, dass dir die Nase und die Zehen nicht abfrieren. Einmal kam bei uns ein Nachbar über Land gegangen, und als er die Mütze abgesetzt hat, da fiel ihm ein Stück ab vom Ohr, da hatte er nicht richtig alles zugedeckt gehabt.“
Ihre Stimme, die dem Kind vom Kindheitsland erzählte.
Von den vielen Schlangen, die es dort gab und die tödlich bissen, erzählte sie immer wieder, weil ich schaudernd immer wieder davon hören wollte. „Na du weißt doch schon, dass sie ans Haus kamen, manchmal bis in die Küche. Und einmal, da hatte ich draußen so ein kleines Schüsselchen Milch wo hingestellt und stehen lassen, und als ich später wieder hinkam, hat eine Schlange draus getrunken. Die Schlangen lieben ja die Milch von den Kühen. Na, und da hab ich ja oft extra Milch auf ein Tellerchen getan und hingestellt, so bisschen versteckt, dass keiner es sah, und da kamen sie immer und haben getrunken und ich hab zugesehen und die haben mich angesehen mit ihre goldene Augen, ich glaub, die haben schon immer gewartet, dass ich was bring.“
Und dann hatte Leokadias Mutter, meine Großmutter mit den kastanienbraunherrlichen Haaren, die ich niemals gesehen habe - unsere Lebenszeiten überschnitten sich nicht, auch unsere Orte waren so weit entfernt, fern die Ukraine, noch ferner Sibirien - meine Großmutter Emilia entdeckte das Schlangenspiel eines Tages und sie verbot dem Kind, die Schlangen ans Haus zu locken, manche seien gefährlich, tödlich gefährlich, „und ich habs ja nicht mehr gemacht“, sagte Leokadia.
Das war nicht als Kritik an der Mutter Emilia gemeint. Im Gegenteil, wie leuchteten die blauen Augen auf, wenn Leokadia ihre Mutter erwähnte. Bis zum Ende blieb es ihr wichtig, ob Menschen schön waren, und wenn sie von ihrer Mutter erzählte, stand immer am Anfang: „Ach weißt, meine Mutter, die war ja eine große, schöne Frau, die hatte so rotbraune Haare, weißt, wie die frischen Kastanien. Und ihre Stimme! Die machte alle still, sie war ja selbst so still und lieb mit all den Kindern. Und sie war fromm. Sie hat ja gewusst, dass sie so früh sterben wird ...“
Leokadias volle Stimme wurde dünn, wenn sie darauf zu sprechen kam, und sie machte mir das Herz ebenso schwer, wie ihr eigenes wohl immer noch war.
Später, als ich groß genug war, erzählte Leokadia nicht nur vom Kindheitsparadies. Da saß ich neben meiner Mutter an den Weidenkörben und schälte mit ihr zusammen Birnen und Äpfel, die vom Herbstüberfluss der Bauernhöfe zu uns geschwemmt waren. Ich schälte mit Eifer und gern, zusammen zu arbeiten war Nähe, wenn auch meine Mutter viermal so flink war wie ich, die Schalenspirale kringelte sich von ihren schnellen Fingern bis in den Schoß. Während wir schälten und schnitten und Kerngehäuse entfernten, eingehüllt in die Wolke von Obstduft, erzählte sie auch das andere, ich wollte es wieder und wieder hören und bald entstand eine fest gefügte Erzählung in meinem Gedächtnis, die ich auch heute noch abrufen kann, wenn ich will. Manchmal wartet die Geschichte auch nicht auf mein Rufen, manchmal erzählt sie sich von selbst, aber immer ist es Leokadias dunkle, melodische Stimme, die spricht:
„Weißt, mein Kind, da war ich ja erst acht Jahre alt. Da hab ich so im Graben gesessen beim Haus, da war so weiches Gras, und dahinter war das Korn noch grün und es wehte so schön, den Wind hab ich so gerne gehört, und da kam ein Polizist in Uniform, das kannte ich gar nicht. Irgendwo war ja Krieg, davon haben wohl die Eltern mal gesprochen, aber bei uns war alles so wie immer, sie haben gearbeitet und wir Kinder haben gespielt und manchmal auch gearbeitet und ich hab ja jeden Tag nach den Schlangen gesehen. Und jetzt, was denkst du, jetzt sollten die Eltern auf einmal weg vom Hof. Drei Tage war Zeit, da konnten sie alles verkaufen, auch was einpacken, und dann sollten sie weg. Die dachten wohl, wir Deutsche wollten mit den deutschen Soldaten zusammengehen, wenn die in die Ukraine kommen.“
„Aber meinst, die haben uns drei Tage gelassen? Nach anderthalb Tagen kamen Kosaken auf Pferden und die hatten Nagaijkas und klatschten damit so gegen die Stiefel, na schnell, schnell, und der Vater konnte das Geld für seinen Hof nicht mehr abholen, die Eltern konnten nur das Wichtigste auf den Wagen laden, da war nicht viel Platz, da lagen schon viele Sachen von den Nachbarn, und wir alle Kinder kriegten noch was zu tragen aufgepackt. Das war erst leicht, aber später wollt ich’s am liebsten wegwerfen. Und so ging’s los: Gepäck auf dem Rücken und mit allen anderen Deutschen aus dem Dorf der Fuhre hinterher. Zu Fuß. Wohin, das wussten wir nicht.“
„Da sind wir viele Tage so gelaufen. Manchmal, da konnte man ja wo einen Pferdewagen mieten, da konnten wir ein Weilchen fahren, aber das mussten die Eltern selbst bezahlen und dann war es ja zu teuer. Da liefen wir.“
„Übernachtet haben wir da, wo wir gerade waren, das waren so provisorische Lager, keine Toiletten, kein richtiges Essen, keine Medizin, und dann das ungewohnte Wetter, vor allem, wo wir durch die Sümpfe mussten. Wenn wir wo in ein Dorf kamen, da jagten uns die Leute weg. Manche brachten uns auch was, aber in vielen Dörfern konnten wir nicht mal Wasser aus dem Brunnen schöpfen. Die hatten Angst, dass wir ihr Wasser verseuchen. Da wurden ja auch immer mehr Leute krank. Alle waren schwach vom vielen Laufen und wenig Essen. Da brachen Seuchen aus, Typhus, Diphtherie, Rote Ruhr, Malaria. Und meine Mutter war schwanger.“
„Als meine erste Schwester starb, da kamen so Leiterwagen und Männer packten erst die toten alten Leute auf und dann die Kinder. Der Vater ging mit, wollte sein Kind ja bis zum Grab begleiten. Nie wieder geht er mit, hat er gesagt, als er zurückkam, selbst wenn alle sterben. 'Da werden Fuder von Leuten auf einen Haufen geworfen'.“
„Dann starb das zweite Geschwister und dann wurde ich auch krank. Wenn die Träger kamen, um die Kranken irgendwo in die Isolierung wegzuholen, lief ich schon von Weitem und meine Eltern versteckten mich. Wer erst weg war, kam auch nicht wieder. Und wirklich, ich wurde wieder gesund.“
Von der Gewitternacht erzählte meine Mutter mir zum ersten Mal, als ich in der Pritsche hinter ihr an der Bretterwand der Baracke, unserem „Behelfsheim“, lag und ihr, wie sie es liebte, den Rücken rieb. Ob meine beiden Geschwister im zweiten Bett zuhörten, weiß ich nicht mehr. Ich kannte kein anderes als ein Behelfsheim, ich lernte kein anderes als das Nachkriegs-Behelfsleben kennen. Ich war das Muttikind, hätte mich am liebsten in sie hineingebohrt, war, wann immer es ging, in ihrer Nähe.
Die Gewitternacht. Wie von den Schlangen wollte ich davon immer wieder hören. Wiederholung, Wiederholung, möglichst wortwörtlich, ohne Variation. Wochenlang waren Leokadia und ihre Familie da schon unterwegs gewesen. Nachdem sie viele Tage zu Fuß marschiert waren, fuhren sie mit der Eisenbahn, kurze Strecken, lange Strecken, immer wieder unterbrochen von stundenlangem Warten auf die Weiterfahrt. Platzmangel, Hunger, Durst, ein Loch im Boden für die Notdurft. Viele Tote, die an den Bahnhöfen ausgeladen wurden. Mancher Waggon wurde irgendwo auf einem Abstellgleis vergessen. Später zog man die Toten heraus und karrte sie irgendwohin.
Dann ging es zu Wasser weiter. Auf einem offenen, schwarzen Schiff, das sonst Holz trans-portierte, fuhren sie die Wolga hinunter. „Seitdem bin ich nicht fürs Wasser“, sagte meine Mutter. „Wenn Leute gestorben sind, wurden sie einfach ins Wasser geworfen. Ich konnt’ nicht aufhören zu zittern, wenn sie da trieben.“
„Und dann machte das Schiff ja wo fest. Russen kamen ans Schiff, mit Ochsenkarren waren sie vorgefahren. Da stiegen wir auf, ein Kutscher sollte uns fahren, der wusste wohl, wohin.“
„Am Abend, da zog ein großes Gewitter auf, der Himmel war ganz schwarz. Da hielten wir an. Der Bauer schirrte die Ochsen aus und wir haben uns ein kleines Lager gebaut halb unter dem Karren, wir wollten das Gewitter abwarten. Da schlug auf einmal ein Blitz ganz nah neben dem Wagen in die Erde. Die Ochsen rannten wie verrückt ins Dunkle weg. Mein einer Bruder lag wie tot. Und der Regen schüttete auf uns runter. Der Vater und der russische Bauer liefen den Ochsen nach und wir andern krochen nah zusammen, nass und verfroren, wie wir waren. Und wir froren immer mehr. Aber die Männer kamen und kamen nicht zurück. O wie hatten wir da Angst. Und was hat wohl meine arme Mutter ausgehalten, der eine Sohn lag noch immer besinnungslos und die Kleinen haben geweint und gezittert. Die ganze Nacht haben wir auf dem Feld gelegen.“
„Der Vater und der Bauer kamen erst gegen Morgen zurück. Sie hatten die Ochsen in der Nacht schon bald eingefangen, aber im Dunkeln konnten sie unser Lager nicht wieder finden und mussten warten, bis es hell wurde. Aber jetzt war auch der besinnungslose Bruder wieder zu sich gekommen und wir konnten weiterfahren.“
„Dann kam endlich ein Dorf in Sicht. Der Russe und der Vater gingen zusammen in ein Haus, da wurden wir aufgenommen. Die Mutter trocknete alle Kleider, wir bekamen warmes Essen und wir durften da auch schlafen. Ich werd nie vergessen, wie gut die Russen waren.“
„Aber am nächsten Tag ging es wieder weiter. Wir waren noch nicht da, wo wir hinsollten.“
Wie die Orte hießen, durch die sie kamen und wohin sie denn eigentlich verschleppt wurden, war mir nicht wichtig. Aber meine älteren Brüder fragten immer wieder, wenn die Rede auf die Verschleppung kam, gerade danach. Ungeduldig, ungläubig, wie konnte man das Wichtigste nicht wissen? Wie konnte man auch mitten in den Wirren eines Landes herumreisen ohne zu wissen, dass es eine Revolution gegeben hatte. Aber die Zeit, wie unsere Mutter sie bestimmen konnte, hieß einfach Krieg und der Ort hieß Sibirien. Höchstens etwas genauer: Kirgisensteppe.
Irgendwann kamen sie an. Wo? Heute möchte auch ich es gerne wissen, hätte die Orte sicher längst aufgesucht, so wie ich auch nach Polen gereist bin. Aber ich weiß nicht, wo in den Weiten der Kirgisensteppe sie war. Weiß nur, dass sie dort, wo sie ankamen, leben konnten. „Einigermaßen“, so hatte Leokadia gesagt. Was ich mir darunter vorstellen soll, weiß ich nicht, ich habe nicht rechtzeitig nach mehr Einzelheiten gefragt. Ich weiß nur, weil auch das zu den fest gefügten Sätzen meiner Mutter gehörte, dass sie in guter Nachbarschaft zu den Russen und auch den Tartaren lebten. Der Vater fand gelegentlich Arbeit, so dass sie etwas zu essen hatten, und auch Leokadia machte sich nützlich, hütete Kinder und kroch im Winter mit ihnen auf die hoch gebauten Öfen der einheimischen russischen Familien. Da hatten sie es neben Großmutter und Großvater und den anderen Kindern warm und die Hühner gackerten unten im Zimmer. Sie bekam zu essen, es reichte fast immer, um satt zu sein.
„Das ging eine Zeit gut.“ Da war sie wieder, die Stimme meiner Mutter. An ihrer dünnen Klanglosigkeit hörte ich schon, was bevorstand. „Gerade war die kleine Elsa geboren“, das war das einzige Kind, das meine Mutter mit Namen aus der Geschwisterschar hervorhob, „da starb wieder ein Bruder. Und nicht lange danach merkte meine liebe Mutter, dass sie sterben wird. Sie hatte schon eine Zeit schwere Kopfschmerzen gehabt und wusste, was das bedeutete. Ihre Brüder waren auch an Kopfschmerzen gestorben. Da hat sie uns alle an ihr Bett gerufen. Die älteste Schwester und die beiden größeren Brüder, so sagte sie, die könnten sich ja schon selbst helfen und die kleine Elsa, die käme ihr ja bald nach. Und dann legte sie die Hand auf meinen Kopf und sagte: 'Aber wie wird es dir wohl gehen, mein liebes Kind?' Und sie hat mir ihre 'Wasserquelle' gegeben. Das war das Buch, aus dem sie jeden Morgen und Abend ein Gebet vorgelesen und dann ein Lied mit uns gesungen hat. 'Das behalt', hat sie gesagt, 'dann bin ich immer bei dir.' Und ich hab dieses Buch immer bei mir gehabt, nachdem sie gestorben war. Es war mein Trost. Auch wenn ich nicht lesen konnte, wir gingen ja in keine Schule, die Lieder konnte ich alle auswendig, ich hab immer in der 'Wasserquelle' geblättert und die Lieder gesungen, ich hab ja immer gerne gesungen.“
„Und wie meine Mutter gesagt hatte, so war’s auch. Die kleine Elsa starb bald nach ihr. Über ein Jahr lebten wir dann ja noch so weiter in der Kirgisensteppe. Und dann war der Krieg zu Ende, dann kam ja die Freiheit, wer da wollte, der konnte fahren nach seiner Heimat. Jeder musste selbst sehen, wie er das schaffte. Meine älteste Schwester hatte sich inzwischen verheiratet und so hat sich Vater mit uns wieder auf den Weg zurück gemacht, der Schwager kam auch mit.“
Rückwege sind nicht immer leichter als der Weg ins Unbekannte.
„Das Geld reichte nicht weit, dann sind wir tagelang zu Fuß gelaufen, wieder musste jeder auch noch was tragen. Einmal sollte ich am Morgen aufstehen, aber ich konnte keinen Fuß vor den anderen setzen. So mussten alle wegen mir zurückbleiben. Da haben mich die Großen unter die Arme genommen und mich stundenlang rumgeführt, bis endlich wieder Leben in meine Beine kam.“
„So ging es immer weiter. Aber nach paar Wochen machten wir alle für eine ganze Zeit halt. Es war Erntezeit und so gingen der Vater und mein älterer Bruder, der war ja schon siebzehn, und die Schwester und der Schwager in die Ernte arbeiten, um Geld zu verdienen für die Weiterreise. Zum Schlafen kamen sie nicht zurück. Mein Bruder und ich mussten alleine bleiben. Es war ja Sommer und wir hatten einen Unterschlupf gefunden in einem offenen Bretterschuppen. Da lag bisschen Stroh auf der Erde und ein Laken und eine Zudecke hatten wir auch.“
„Was haben wir da beide ausgehalten. Es verging nicht ein Tag, wo wir nicht geweint haben, weil wir so Heimweh nach unserer lieben Mutter hatten. Und nun waren auch noch der Vater und alle anderen weg. Mein Bruder war ja älter als ich, er hatte ja lesen gelernt, dann hat er’s so gemacht, wie’s zu Hause gewesen war: Er hat jeden Abend und jeden Morgen aus der 'Wasserquelle' gelesen und dann haben wir zusammen gesungen.“
„Und am Sonntag kamen Vater und alle nach Hause. Er brachte Brot mit und auch Krapfen. Das war eine Freude, da waren wir nicht mehr allein und konnten uns wieder einmal satt essen.“
„Aber mein Bruder, der mit in der Ernte gearbeitet hatte, der sah so elend aus. Er wollt auch nicht essen und sagte so im Spaß: 'Montag bin ich krank, dann brauch ich nicht mit zur Arbeit.' Vater wollte nichts davon wissen. 'Ich werd dir helfen krank sein', sagte er. Am Morgen, als sie wieder zur Arbeit aufbrechen wollten, konnte der Bruder fast nicht aufstehen. Aber der Vater bestand darauf, mein Bruder musste mitgehen. Es dauerte aber nicht lange, da brachte Vater ihn wieder zurück, er konnte wirklich nicht. Vater ging allein wieder los.“
„Was wir da ausgehalten haben, das weiß nur Gott allein.
Mein Bruder bekam hohes Fieber und große Schmerzen. Er musste auf der Erde im offenen Schuppen liegen. Das Laken, das über das Stroh gedeckt war, war sehr grob und er hat sich immer so darauf herumgewälzt. Er hat immer nach Singen und Lesen verlangt, dann war er ein Weilchen ruhig. Wir taten das auch zu jeder Zeit. Was anderes konnten wir ihm ja nicht tun. Nachts haben wir uns ja neben ihn ins Stroh gelegt, weil sonst kein Platz war.“
„Nach ein paar Tagen kamen die Pocken. Es war nicht eine Stelle auf seinem Körper, wo nicht eine Blase war. Zuletzt hat sich die ganze Haut zusammengezogen und er lag auf dem nackten Fleisch. Sehen konnte er auch nicht mehr. Und dann so ohne Hilfe. Aber er behielt seine Gedanken bis zuletzt. Er hat noch eine Stunde vor seinem Tode gebetet: 'Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid, damit will ich vor Gott bestehn, wenn ich zum Himmel wer eingehn. Amen.' Vater war zum Glück gerade nach Hause gekommen, wir haben alle bei ihm gesessen und haben geweint. Aber der Bruder schlief ganz friedlich ein.“
„Mein anderer Bruder und ich bekamen auch die Schwarzen Pocken, aber nicht so schlimm, ich noch weniger als mein Bruder. Wir blieben beide am Leben.“
„Nun, damit war die Not noch nicht zu Ende. Nach ein paar Wochen ging die Reise weiter, aber dann brach die Typhuskrankheit aus. Einer nach dem anderen von meiner Familie wurde in eine Krankenstation irgendwo weggebracht, so dass ich allein blieb.“
„Vorrat zum Essen war nicht da. Ich musste jeden Tag sehen, wo ich etwas bekam. Wenn wo Leute gegessen haben, blieb ich stehen und schaute zu. Oft waren da welche, die Mitleid hatten und mir etwas von ihrem Essen abgaben, aber oft musste ich auch hören: 'Geh weg, was lauerst du hier, wir haben selbst nichts!'“
„Ich weiß noch so wie heute, ich hatte großen Hunger und von niemand bekam ich was, da ging ich hinaus unter den freien Himmel und habe zu Gott gebetet: 'O Gott, erbarm dich meiner!', und dann ging ich bis zum Markt. Da kam ein Soldat auf mich zu und fragte mich so aus, wo mein Vater und meine Mutter sind. Ich sagte ihm dann mein Leid. Und da schenkte er mir drei Rubel. Da brauchte ich doch paar Tage nicht zu hungern.“
„Aber eines Morgens wollte ich wieder aufstehen, da fiel ich um, und als ich wieder zu mir kam, da lag ich in einem Krankenhaus und sogar dicht mit meinem Bruder zusammen. Das war eine Freude für uns.“
„Als wieder alle gesund waren, ging die Reise weiter bis nach Saratow. Das ist an der Wolga. Und da sind wir auseinander gekommen. Ich weiß wirklich nicht, wie es kam. Wir haben gesucht und gesucht, meine Schwester und mein Schwager sind auch die halbe Nacht noch unterwegs gewesen. Aber da waren so viele Leute in der Stadt, die sind ja herumgezogen so wie wir, und viele Soldaten waren auch dazwischen, aber wir haben meinen Bruder und Vater nicht gefunden.“
„Ich bin dann bei meiner Schwester geblieben, bis wir wieder in unserer Heimat waren. Aber bei dem ganzen Hin und Her in Saratow habe ich meine 'Wasserquelle' verloren, das Buch war doch von meiner Mutter, das wollte ich mein ganzes Leben lang behalten. O was habe ich da geweint, es war, als ob ich jeden Boden unter meinen Füßen verloren hatte. Ich kannte ja keine anderen Bücher, auch nicht die Bibel, und konnte auch in keinem anderen Buch lesen. Die 'Wasserquelle' kannte ich auswendig. Ich habe mich oft so verlassen gefühlt, dass ich mir den Tod gewünscht habe. Aber es geht nicht immer nach unserem Willen und Wünschen. Gott hatte noch etwas anderes mit mir vor, denn seine Wege sind nicht unsere Wege und seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken.“
Später, als verheiratete Frau, fand Leokadia mit Hilfe des Roten Kreuzes ihren Vater wieder. Nicht mehr ihren letzten Bruder, er war noch in Russland gestorben. Der Vater war nach Argentinien ausgewandert und lebte in der Nähe von Buenos Aires in noch einmal erarbeitetem, wenn auch wohl eher bescheidenem Wohlstand. Er hatte ein zweites Mal geheiratet, in dieser zweiten Ehe gab es auch eine Tochter, die aber schon als junges Mädchen starb. So hatte es in der Fremde eine neue Mutter für Leokadia gegeben. Aber auch sie starben, als ich Kind war, ohne dass Leokadia ihren Vater wiedergesehen und die Stiefmutter kennen gelernt hätte. Ein Foto kam, auf dem Frauen in schwarzen Kopftüchern und Männer mit großen Schnurrbärten ebenso steif hinter dem offenen Sarg standen, wie der Tote in ihm lag. Starr blickten sie aus dem Bild. Das war der Tod des Vaters. Einer von so vielen Toden, so vielen Toden in Leokadias Leben.
Aber sie, Leokadia, lebte und war mit ihrer ältesten Schwester nach Wolhynien zurückgekehrt.
„Na ja, in unserer Heimat war es nicht viel besser als in Sibirien. Auf meine Eltern ihrem Hof saßen Polen und vom Schwager seiner Seite war es genauso. Da durften wir nicht einmal übernachten. Aber über den Winter durften wir bei einer russischen Familie aus dem Dorf wohnen. Die hatten auch nur ein Zimmer, da haben wir auf dem Fußboden geschlafen.“
„Es war zwei Wochen vor Weihnachten, da kam die Frau nach Hause und erzählte, dass ein Mann aus Ostpreußen gekommen ist, der sucht ein Mädchen für den Haushalt und einen kleinen Jungen oder ein kleines Mädchen zum Kühehüten für seinen Hof in Ostpreußen.“
„Da bin ich gleich hingegangen. Der Mann sah mich immer wieder an, aber dann sagte er: 'Ja, ich nehm dich mit.'“
„Ich muss doch schrecklich ausgesehen haben. Die Haare waren ganz kurz geschoren von der Typhuskrankheit und mein ganzer Körper war voll Wasser, besonders der Bauch stand dick vor. Und wie ich angezogen war, das kann ich dir gar nicht beschreiben: Ein paar Schuhe hatte ich ja geschenkt bekommen, aber die behielt meine Schwester und gab mir solche, die viel zu groß waren. Außerdem hatte ich noch ein altes Jackett von meinem Vater und sonst nicht viel anderes als Lumpen.“
„So bin ich am nächsten Tag mitgefahren, es waren siebenhundert Kilometer von uns weg. So bin ich nach Ostpreußen gekommen.“
„Wie es mir zu Mute war, als wir da ankamen, das kann ich dir nicht beschreiben. Das andere Mädchen, das auch mitfuhr, war schon über zwanzig, sah gut aus und war auch gut angezogen und die Leute im Haus alle genauso. Alles war sauber und schön eingerichtet, auf den Sessellehnen im Wohnzimmer lagen sogar Spitzendeckchen. Es gab gutes Essen, jeden Tag Fleisch und Soße, aber mir tat davon der Bauch weh. Die ersten Tage war ich so ängstlich, ich mochte mich nicht bewegen. Die ganzen Jahre war ich doch nur zwischen solchen armen Leuten wie wir selber gewesen. Ich kannte auch keine Spiegel, so wusste ich auch gar nicht, wie ich aussah. Ich war ja schon dreizehn Jahre alt, im vierzehnten. Ich merkte es doch genau, dass ich da nicht reinpasste und dass mich alle so übrig und von der Seite ansahen.“
„Einmal war ich draußen und als ich ins Flur kam, hörte ich, dass von mir die Rede war. Ich blieb eine Weile stehen. Die Frau sagte: 'Warum hast du solch ein Kind mitgebracht, was soll ich damit anfangen?' Die Frau war ja jung und unerfahren. Da fragte der Mann: 'Das weißt du nicht, was du mit dem Kind anfangen sollst?' Das war auch kein Wunder, sie kam aus einer reichen Familie. Aber der Mann hatte auch schon Not mitgemacht. 'Jedenfalls wirst du dich ab heute um das Kind kümmern. Es steht doch geschrieben: Was ihr einem der Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan.'“
„Als ich das mit angehört hatte, bin ich in die Scheune gegangen und habe auf der Erde geweint. Nun war ich von der Schwester so weit weg und so alleine in der Fremde. Schreiben konnte ich nicht, wie es mir geht. So habe ich nur Gott gebeten, dass er mich zu sich nehmen soll, zu meiner Mutter und den Geschwistern. Aber der Tod kam auch da nicht.“
„Als ich dann in die Küche kam, da sahen wohl alle, dass ich sehr geweint hatte. Und dann kam die Frau zu mir, umarmte mich und sagte, ich soll doch nicht weinen, sie will mir eine Mutter sein. Da weinte ich noch viel mehr. Die Frau sagte mir dann später, dass Gott zu ihr geredet hatte, sie waren ja Gläubige und gehörten zur Pfingstgemeinde.“
Und ich bin bis heute froh über diesen Mann und lasse einmal das Machtwort, das ein Mann gegen seine Frau sprach, liebend gern gelten.
„Von der Stunde an war es anders. Die Bäuerin gab mir jetzt Essen, das ich vertragen habe. Sie ging zu ihrer Mutter, denn sie hatte noch eine jüngere Schwester, die war genauso alt wie ich, aber kein Vergleich zu mir, viel größer und schöner. Später wurde sie meine liebste Freundin. Von da brachte die Bäuerin viele Sachen mit, die ihrer Schwester zu klein waren. Aber ich sah vor Weihnachten nichts davon. Dann machte sie mir einen festen Gürtel aus Leinwand, da verschwand auch mein dicker Bauch, weil das Essen doch gut war, und ich hab’s ja jetzt auch vertragen.“
„Und am Heiligen Abend, da kam die große Überraschung, da wurden mir die alten Lumpen ausgezogen und ich wurde gebadet, was ich gar nicht kannte. Die Bäuerin und der Bauer hatten ein ganz neues Kleid und ganz neue Schuhe für mich gekauft und dann durfte ich den gleichen Abend mit zur Weihnachtsfeier in der Gemeinde. O die Freude kann ich dir nicht beschreiben. Wie ich mich gefühlt habe. Ich konnte es gar nicht glauben, dass ich das war.“
Leokadia war in einen sicheren Hafen gelangt. Immer, wenn wir in der Baracke meiner Kindheit abends um den Tisch saßen und sangen „Die Wellen kommen näher, mein Schifflein ist in Not“, dachte ich an das, was meine Mutter aus ihrem Leben erzählt hatte. Das Lied wurde mein tief gehätscheltes Lieblingslied.
Bei der Weihnachtsfeier in der Gemeinde sah mein Vater Leokadia zum ersten Mal und beschloss auf der Stelle, sie später zu heiraten. Er war fast sechzehn Jahre alt. Liebe auf den ersten Blick setzte sich in der frommen Gemeinde, in der sie lebten, sofort in Heiratsabsicht um – aber solch kritische Gedanken kamen mir erst später.
Leokadia war durch Sturm und Wellen in einen Hafen gelangt, so sicher, wie ein Hafen im zwanzigsten Jahrhundert sein konnte.
Ich hätte es am liebsten, wenn Leokadias Geschichte hier endete. Im sicheren Hafen. Rosig blühten Wolken am Himmel der nahen Zukunft. Aber ihre Geschichte endete nicht. Sie erlaubte nur ein Atemholen.
2
Als wüsste sie, dass sie die Jahre der Rast in Ostpreußen nutzen musste, band Leokadia sich ganz fest. Sie liebte die Bäuerin, den Bauern und deren Kinder, die nach und nach geboren wurden, arbeitete von morgens früh bis abends spät, bald schon nicht mehr nur als Hütemädchen, sondern überall im Haus und auf dem Feld, sie war geschickt, gefällig, und - Leokadia wurde hübsch. Der aufgedunsene Körper war schlank und fest geworden, das Stoppelhaar inzwischen lang gewachsen. Dunkelbraun und füllig umgab es den kugeligen Kopf, umrahmte eine hohe und doch runde Stirn, war als Knoten festgesteckt, wie es sich schickte, und die Augen aus dem von der ersten Frühjahrssonne bereits gebräunten, flächigen, trotz mancher deutscher Vorfahren slawischen Gesicht konnten verloren blicken, aber auch blitzblank und fröhlich strahlen. Es war nicht immer leicht, die Balance zu halten. Manchmal war sie plötzlich wieder die Fremde, dann waren ihr die vielen Toten, die in Sibirien oder auf dem Weg dorthin und von dort zurück geblieben waren, näher als alle Lebenden in der ostpreußischen Gegenwart.
Das alles wusste ich. Nicht nur Leokadia hatte davon erzählt, auch die wenigen Fotos, die es aus dieser Zeit gab, sprachen eine deutliche Sprache und Verwandte und Bekannte hatten Erinnerungen beigesteuert — es gab noch einige wenige Menschen, die Leokadia in diesen Jahren gekannt hatten.
Doppelt gebunden hielt besser. Außer der Bauernfamilie, bei der sie arbeitete, gab es die Pfingstgemeinde im Dorf. Eine mächtige Erweckungswelle rollte über das Land. Viele Jugendliche entschieden sich für ein Leben in den engen, streng bewachten Grenzen dieser pietistischen Gemeinschaft. „Ich ging dann auch fleißig zur Versammlung und an einem Sonnabend, es war in einer Gebetsstunde, hat Gott machtvoll zu meinem Herzen geredet. Es wurde es auf einmal so hell in dem kleinen Saal, ich sah mein ganzes Leben in dem Licht und dann hörte ich eine Stimme zu mir sagen: 'In diesem Licht sollst du bleiben.'“
Nun war nicht nur eine Gemeinschaft für die Arbeit, sondern auch eine für die wenigen freien Stunden gefunden. Gebetszeiten am Sonnabendabend, Gottesdienst am Sonntagmorgen, Jugendstunde am Nachmittag und vor allem wurde ein Chor gegründet und es gab Chorproben während der Woche.
Leokadia war glücklich, wenn sie abends nach dem Melken die letzten Handgriffe getan hatte und zum Singen laufen konnte. Sie wurde dem Alt zugeteilt, ihre Stimme gehörte eindeutig dorthin, tief und voll, tragend und weich auch noch in höheren Lagen, erstaunlich, dass dieser Klang aus einem so kleinen, zierlichen Körper strömte, der erst später, nachdem sie Kinder geboren hatte, Fülle gewann. Die Stimme besaß diese Fülligkeit von Anfang an.
„Ich habe mich immer gefreut, wenn ich singen konnte. Das habe ich für mein Leben gern getan. Aber für mich war es die erste Zeit sehr schwer, ich konnte ja nicht schreiben und nicht lesen und gedruckte Bücher kannte ich auch nicht. Aber ich habe sehr schnell auswendig gelernt; bis wir ein Lied vorsingen mussten, konnte ich es auswendig.“
„Meine liebste Freundin hat dann für mich die ganzen Lieder aufgeschrieben, ich konnte bald ihre Schrift lesen. O was habe ich mich da gefreut! Mit dem Schreiben war es nicht so leicht zu lernen, denn ich musste ja viel arbeiten und hatte keine Zeit für mich.“
Leokadias Stimme. Stimme, die erzählte, aber vor allem Stimme, die sang. Alle ihre Kinder trugen sie im Ohr, über die Jahre hin, auch als sie den vollen Klang verloren hatte und dann mit dem Verfall ihres Geistes ganz verstummte. Ich höre sie über ihren Tod hinaus, ebenso wie sie manchmal unverhofft vor mir auftaucht, in der blauen Schürze in der Küche hantiert und singt. Sie sang beim Geschirrwegstellen, beim Fegen, beim Abwaschen, ließ, aufgequollen und schweißtriefend, in der Waschküche ihre Stimme schallen, während sie auf dem Waschbrett die Wäschestücke rubbelte. Auch wenn sie strickte und stopfte, sang sie leise vor sich hin, aber meistens saßen dann andere bei ihr, um sie versammelten sich ja abends die Nachbarn zum Reden, Erzählen. Vielleicht kamen sie gerade deshalb, weil sie zu allen Abstand hielt, mit niemandem ganz nah sein wollte und konnte, schon gar nicht mit einem der Männer. Auch wenn es nicht allzu viele von ihnen in der Baracke gab, um Leokadia versammelten sie sich. Abends war Leokadias Mund mit Reden gefüllt, für mich hatte sie dann keine Zeit.
Aber es blieb ja ganz sicher der Abendtrost. Lauter Lieblingslieder sangen wir dann, selten fehlte jemand von den Geschwistern, auch die älteren versammelten sich nach dem Abendbrot zum Abschluss des Tages am Tisch. Wir sangen „Die Wellen kommen näher, mein Schifflein ist in Not“, mein Lieblingslied, oder „Wer zieht als Sieger durchs Perlentor, bald, ja bald“, oder „Denk, ich weiß ein Schäfelein, das wollt gar nicht folgsam sein“ oder
„Vöglein im hohen Baum,
klein ist’s, man sieht es kaum,
singt doch so schön,
dass wohl von nah und fern
alle die Leute gern
horchen und stehn,
horchen und stehn“,
das war Leokadias Lieblingslied. Selten sangen wir auch „Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, die du geschaffen durch dein Allmachtswort“. Wenn meine Mutter die getragenen Töne dieses Liedes schweben ließ, kam sie mir wieder vor wie eine Predigerin.
Bei einer Chorprobe hörte einmal ein Musikprofessor aus Königsberg die siebzehnjährige Leokadia singen. Er war von ihrer Stimme beeindruckt und wollte ihr in seiner Stadt eine kostenlose Gesangsausbildung ermöglichen. Aber Leokadia hatte ja gerade erst begonnen, sich zu Hause zu fühlen, hatte sich so schwer an alles Fremde gewöhnt. Konnte auch niemanden um Rat fragen, auch ihre Schwester in Wolhynien war gestorben. Der Schwager hatte es geschrieben, er war mit zwei Kindern allein geblieben. Leokadia blieb als Magd im Dorf.
In den ersten Ehejahren lernte Leokadia bei ihrem Mann flüssiger lesen, sogar Gedrucktes gelang ihr allmählich zu entziffern. Und einigermaßen, wenn auch für andere nur schwer lesbar, schreiben lernte sie auch. An langen Winterabenden, wenn in seiner Schlosserei und auch auf den Feldern nichts mehr zu tun war, schrieb Rudolf in einer feinen Handschrift mit langen Ober- und Unterlängen alle Lieder ab, die sie im Laufe des Jahres im Chor gelernt und bei der Arbeit gesungen hatten. So wuchs eine ganze Reihe Liederbücher heran, allein für sie. Abends blätterte und las sie darin und dann begann sie zu singen und er begleitete sie auf seiner Geige oder auch auf der Mandoline oder der Gitarre. Er lernte jedes Instrument, das er in die Hand nahm, leicht.
Wie gut, dass ihr kleiner, nur allmählich nachreifender Körper nicht gleich, nachdem sie geheiratet hatte, Kinder empfangen konnte. Wären sie gleich gekommen, so wäre auch das bisschen, was sie neben der vielen Haus- und Feldarbeit lernte, nicht möglich gewesen. Und wie dringend nötig war es ihr später, als sie nach dem zweiten Krieg ohne ihren Mann die Kinder durchbringen musste, als sie Rente einreichen, Rentenbescheide entziffern, verlorene Geburtsurkunden nachfordern, Lehrverträge durchlesen und immer wieder viele, viele Papiere ausfüllen musste. Und wie viel bedeuteten ihr die Briefe, die sie in reicher Zahl erhielt und so recht und schlecht schrieb an die Verwandten ihres Mannes und an Freundinnen und Bekannte von Zuhause, die in der neu entstandenen Bundesrepublik verstreut lebten. Wenn Leokadia am Sonntagnachmittag am Küchentisch saß und auf der sonntäglichen Tischdecke Briefe schrieb, saß ich, seitdem ich zur Schule ging, neben ihr und buchstabierte ihr die besonders schweren Wörter, die beim Schreiben vorkamen.
In den letzten Jahren ihres Lebens, als sie nicht mehr singen, nicht mehr lesen und schreiben und auch nicht mehr sprechen konnte, waren ihr die Gesangbücher immer noch wichtig. Diesmal hatten die Trostquellen die Flucht überstanden, keine war verloren gegangen. Die alte Bibel war irgendwann neu eingebunden worden und hatte nun kaum noch einen Rand, er musste weggeschnitten werden, weil er so zerlesen war. Obwohl es inzwischen für sie, ganz für sie allein, ein Wohnzimmer mit bequemen Sesseln und einem Sofa gab, saß sie oft in der Küche am Resopaltisch und blätterte mit ihren verarbeiteten, schmächtigen Händen eins der von ihrem Mann geschriebenen Gesangbücher nach dem anderen durch. Die alten, vergilbten Seiten wurden immer brüchiger, manche Seiten rissen ein bei ihrem steiffingerigen, aber auch erregten Blättern. Die Lippen bewegten sich manchmal dazu, aber es war nicht zu entscheiden, bildeten sie noch Wörter oder berührte nur noch die Erinnerung ans Sprechen ihr Verstummen.
Mit neunzehn hatte Leokadia Rudolf geheiratet, der seit fünf Jahren darauf gewartet und zielstrebig darum geworben hatte. Für sie war die Entscheidung nicht so klar gewesen. Da hatte es außer ihm einen anderen gegeben. Der war viel größer gewesen als Rudolf und groß zu sein war für die 1, 49 kleine Leokadia die wichtigste Eigenschaft der Schönheit. Es hatte sie gelockt, den anderen zu nehmen, auch wenn man im Dorf sagte, dass er nicht viel taugte. Aber dann entschied sie sich doch für den zielstrebigen, klugen Rudolf, der sie liebte, seitdem er sie das erste Mal gesehen hatte, der ihr ein Zuhause schaffen wollte mit allen Kräften, die er einsetzen konnte.
Gemeinsam schufen sie es nach Art der Schwaben, von denen der auch in Wolhynien geborene, aber schon seit seiner Kindheit in Ostpreußen lebende Rudolf herstammte. Unermüdlich arbeiten, schaffen, schaffen, erst noch von einem Zimmer bei den Eltern aus, dann gab es ein eigenes Haus, nach Rudolfs Meisterprüfung auch eine eigene Schlosserwerkstatt, und Land, bald noch mehr Land. Und abends saß Leokadia neben Rudolf, auch wenn ihr die Augen manchmal zufielen, und lernte besser lesen, lernte schreiben, statt einen Säugling zu stillen, wie sie es so gerne gewollt hätte.
Beide warteten sie auf Kinder. Kinder waren ein Segen Gottes. Ohne Kinder war das Leben nichts. Fünf Jahre lebten sie beide in der Furcht, Leokadia könne unfruchtbar bleiben. Eines Sonnabendabends stand in der Gebetsstunde eine alte Frau auf, die die Gabe der Weissagung besaß. „Leokadia wird eine reiche Kindermutter sein und der Segen des Herrn wird in besonderem Maße auf allen ihren Kindern ruhen“, sagte sie. Beschämt darüber, der Gegenstand einer Weissagung und damit für eine Zeit der Mittelpunkt der Gemeinde zu sein, aber auch glücklich und voller Hoffnung ging Leokadia an diesem Abend eng neben Rudolf nach Hause.
Und wirklich war meine Mutter kurz darauf schwanger. Bald kam das erste Kind und bald gab es auch ein größeres Haus, die Zukunft gestaltete sich so, wie sie es sich gewünscht hatten. Rudolf war ein angesehener Mann.
Mitte der dreißiger Jahre machte sich dann auch in Ostpreußen der Nationalsozialismus breit. Anfangs bejahten Rudolf und Leokadia ihn als eine Macht, die dem Osten Deutschlands Bedeutung verschaffte, für alle verstreuten Deutschen in der Welt die Arme offen hielt, sogar Volksdeutsche konnte Leokadia werden, als ihr Mann in die Partei eintrat.
Bald aber wussten sie, was den Juden drohte. Leokadia packte Lebensmittelpakete für die jüdische Familie in der Mühle, bei der sie seit Jahren das Korn hatten mahlen lassen und der man nun die Mühle schloss und allen übrigen Besitz wegnahm. Rudolf schwamm nachts über den Fluss und brachte ihnen, was Leokadia für sie zusammengepackt hatte. Nicht einmal genug zu essen hatten sie jetzt. Aber eines Nachts lag die Mühle verlassen da, die Juden waren abgeholt worden.
Rudolf und Leokadia fuhren nicht mit den Nachbarn nach Litzmannstadt, wo man billig schönes Porzellan und Silber aus den aufgelösten jüdischen Haushalten kaufen konnte. Leokadia hielt auch später noch, im Westen, Abstand zu denen, die sich dort bereichert hatten und nun wieder ihre Nachbarn waren.
Ich brachte erst viel später zusammen, dass das, was ich von Litzmannstadt und das, was ich von Lodz erfahren hatte, sich auf die gleiche Stadt bezog.
Noch heute hängt eine weiße Batistgardine in meinem Zimmer vor dem Fenster. Eine Lyra spielende, griechisch gewandete Frau mit nackten Füßen ist in Lochstickerei in den hauchdünnen Stoff gezaubert, schönlinige Ranken umgeben die Griechin und duftige Rosen. Jedes Licht, das hindurch fällt, wird mild. Leokadia und Rudolf kauften die zarte Handarbeit der jüdischen Schneiderin ab, die jahrelang zu ihnen ins Haus kam und für die Erwachsenen und die Kinder Kleider nähte. Der hohe Preis, den sie dafür zahlten, verhalf ihr zur Flucht über Königsberg nach Dänemark. Sie ließen den russischen Arbeiter entgegen Führers Gebot mit am Tisch essen, obwohl Rudolf sich zur Leitung des Ortsbauernverbandes hatte erpressen lassen, die Alternative wäre der Fronteinsatz gewesen. Und sie wussten, was in den Lagern geschah, sie hatten zugehört, als der Freund ihres Dienstmädchens im Urlaub von seinem Lagerwachdienst erzählte. Sie hatten verstanden, was ihn freiwillig an die Front trieb statt dorthin zurück, wo der Dienst doch viel sicherer war. Sie wussten, was Giftgas, was Verbrennungsöfen waren. Ich wusste es auch von klein auf. Und Leokadia, als Rudolfs Rückstellung dann doch nichts nützte und er im letzten Kriegsjahr zum Volkssturm gezogen wurde, wusste, er würde nicht zurückkommen, denn sie hatten, was sie erst zu spät erkannten, mit dem Antichrist paktiert. „Das steht ja geschrieben, dass er wird kommen, der Antichrist. Und weißt, mein Kind, der Hitler, der war es und wir waren blind.“
Rudolf konnte in den ersten Kriegsjahren also zu Hause bleiben. Seine Schlosserei galt als kriegswichtiger Betrieb, bediente eine Instandsetzungskompanie, die im Dorf stationiert war. So war er doppelt unabkömmlich und ihr Leben schien nicht unmittelbar betroffen von all dem, was zu hören und mitzuerleben war. Immer mehr Todesnachrichten brachte der Briefträger ins Dorf. Auch die Söhne von Rudolfs älteren Brüdern fielen an der russischen Front.
Für Leokadia blieb, ob Frieden oder dann Krieg, das Leben vor allem das Austragen, Gebären, Aufziehen der Kinder und viel, viel Arbeit obendrein im Haus, im Garten, auf dem Feld. Es kamen Knechte und Mägde ins Haus, Scheune und Keller füllten sich. Endlich war Fülle, war Wohlstand da, wie sie ihn ersehnt hatte, seitdem sie ihn bei den Bauern kennen gelernt hatte. Wohlstand war Sicherheit, zusätzlich zu der, die der beständige und kinderliebe Rudolf ihr gab. Zu den Kindern, den Knechten und Mägden hinzu kam hin und wieder die Schneiderin, in Erntezeiten eine Köchin. Tanten und Onkel und der Großvater aus der Nachbarschaft waren oft zu Besuch, sie halfen bei der Arbeit und sie liebten die Kinder. Nicht selten saßen sechzehn Personen um den doppelt ausklappbaren Küchentisch.
Aber am liebsten wollte Leokadia immer noch alle Arbeit selber machen, schnell schnell, und einmal legte sie, abgerackert und schlafgierig, wie sie war, ihr zweites neugeborenes Kind nach dem nächtlichen Stillen im November auf den eisigen Fußboden statt in die Wiege neben ihrem Bett. Es wurde schwer krank und blieb jahrelang das Sorgenkind, rachitisch, langsam, erst spät entwickelte es sich zu dem klugen, ernsten ältesten Sohn. Da erst wurde ihr schuldbeladenes Herz leichter. Auch das erzählte sie mir, während ich im Bett hinter ihr lag und ihren Rücken kraulte.
Zuletzt waren es genug Kinder. Zwei Töchter und vor allem vier Söhne. Söhne waren ein besonderer Segen. Immer noch war Krieg. Die siebte Schwangerschaft bedeutete keine Freude mehr, war zu viel. Bei dieser Geburt verlor Leokadia so viel Blut, dass sie lange krank lag und sich nur schwer wieder erholen konnte. Eine Nierenerkrankung kam hinzu. Aber weil ich nun einmal ans Licht der Welt gekommen war, wurde ich auch versorgt, wurde einmal von dem, dann von jenem in dem menschenreichen Haus umhergetragen, von den älteren Geschwistern, dem Dienstmädchen, den Tanten, der Schneiderin. Sogar der Großvater, der als junger Soldat in der ungarisch-österreichischen Monarchie die Prinzessin auf einem Wagen begleitet hatte und deshalb mit „Ihr“ anzusprechen war, ließ sich das Bündel manchmal in den Arm legen. Zehn ein halb Monate meines Lebens umgab auch mich das menschenreiche Haus, wenn auch mein Vater zum Ende hin fehlte, weil er dem Krieg nicht länger ausweichen konnte.
Mein Vater nannte mich wegen meiner auffallend dunklen Hautfarbe den Murchel und er tröstete Leokadia wegen dieses letzten, ungewollten Kriegskindes und prophezeite: „Gerade an diesem Kind wirst du später eine Freude und eine Stütze haben.“ Auch dieser Satz ist tief eingeritzt. Wieder und wieder ließ ich ihn mir von Leokadia vorsagen.
Als Kind liebte ich meinem Vater dafür, so gut man jemanden lieben kann, den man nicht kennt. Dreizehn Monate alt war ich, als ihm im Krieg ein Bein abgeschossen wurde und er auf dem Weg ins Lazarett verblutete. Da war seine Familie schon seit ein paar Wochen im Westen. Ein Mitsoldat kam Jahre später und berichtete. Dankbar war ich für den Satz, der meine Existenz bejahte. Erst spät begriff ich, wie viel Verpflichtung, wie viel Schuldzuweisung er auch in mein Leben gebracht hatte. Ich sprach das Wort Papa zwischen meinen vom Vater schwärmenden Geschwistern nicht aus, vergaß aber nie die Einzelheiten, die ich ihnen abgelauscht hatte: dass er Tee am liebsten im Glas trank, dass er Geige spielte trotz der Arbeit in seiner Schlosserei, dass er an den Abenden nicht nur zur Gebets- oder Chorstunde ging, sondern auch Plato und andere Philosophen las oder den Schäferhund dressierte und seinen Söhnen Weitsprung beibrachte und mit dem Browning zu schießen. Ich hatte auch gehört, dass es immer er war, der bei Auseinandersetzungen um Verzeihung bat. „Die Sonne soll über keinem Streit untergehen!“ Das ist bis heute für mich eine Lehre meines Vaters.
Seit Oktober 1944 war Leokadia allein mit ihren sieben Kindern, Rudolf war Soldat. Der sichere Hafen war nicht sicher genug. Ende Januar 45 ließ sie das Dienstmädchen und die größeren Kinder den Wagen beladen, den die polnischen Knechte nach genauer Anweisung Rudolfs für sie mit einem Verdeck versehen hatten, die gleichen Männer, die sich ein paar Tage später beim Einzug der russischen Soldaten an den Racheakten gegen die zurück gebliebenen Deutschen beteiligten, bei denen auch Rudolfs Bruder Michel zu Tode kam. Den Frauen erging es schlimm. Es gab später ein Kind in der Familie, das ein russischer Soldat gezeugt hatte.
Leokadia, zu schwach und krank, um den Wagen auch nur beladen zu helfen, machte sich wieder auf den Weg. Diesmal war sie die Mutter, nicht eins der Kinder.
Sie fuhr über das schon brüchige Eis der Weichsel in Richtung Westen, traf, als ein Rad des Wagens brach, auf polnische Männer, die es reparierten, sah jeden Morgen nach, ob ihr todkrankes, knapp Einjähriges noch lebte, fürchtete, irgendwann das mager gewordene Körperchen in den Schnee des Straßenrands legen zu müssen. Manch anderen Frauen blieb nichts anderes übrig, eingereiht in die Kolonne des Trecks, konnte kein einzelner Wagen aus der festgefahrenen Spur im Schnee ausscheren. Verlor beinahe zwei Söhne, die Milch für das Kleine besorgen gegangen waren, während der Treck in einem Dorf zum Stehen kam, in dem Menschen noch ganz behaglich wohnten — und dann musste der Wagen plötzlich weiter, Männer vom Volkssturm trieben mit Peitschen die Pferde an und es gab kein Ausscheren. Aber dann kamen die Jungen doch noch hinterhergelaufen und hatten sie am Ortsende eingeholt.
Die älteste Tochter verlor Leokadia dann wirklich, als es wieder einmal Schwierigkeiten mit dem Wagen gab und sie sie losschickte, um Hilfe zu holen. Wieder konnte sie nicht auf die Rückkunft eines Kindes warten, wurde unbarmherzig in der Reihe anderer Gespanne in den vereisten Spuren zwischen Schneewällen weitergetrieben. Fand die Tochter dann nach Wochen in einem Auffanglager wieder, in dem der Treck für die Nacht untergebracht wurde.
Und dann, am Ende der Irrfahrt, musste sie noch einmal erleben, dass sie „übrig“ war, genauso übrig wie nach der Ankunft in Ostpreußen. Als Letzte stand sie noch auf dem Marktplatz des Ankunftsortes, wo die Bauern aus den angekommenen Flüchtlingen die arbeitsfähigsten ausgesucht hatten. Leokadia stand noch nachts in der Kälte, nicht mit kurz geschorenem Kopf und in alter Männerjacke und zu großen Schuhen, aber klein und von Krankheit geschwächt und mit sieben Kindern zwischen vierzehn und einem Jahr, stand im Dunkeln, bis sich jemand erbarmte. Allerdings wurden sie getrennt: die drei kleinen Kinder mit der Mutter zum einen, die vier großen zum anderen Bauern. Zwei Tage später wurde Leokadia achtunddreißig Jahre alt.
3
In einer Nacht im April, ein Jahr später, erschien ihr Mann ihr im Traum. Seitdem wusste sie, dass Rudolf tot war. Sie widerstand der Versuchung, ihn von einer spiritistischen Nachbarin herbeirufen zu lassen. Die Nachbarin besaß das Siebte Buch Moses, sie besprach Warzen, erkannte Verwünschungen und wagte sich mit Hilfe der Anleitungen des Buches auch ins Totenreich. Zu gerne hätte Leokadia ihren Mann gefragt, was sie nun machen sollte, hier im fremden Land, wo alle Deutsch sprachen, wo sie aber unwillkommener war als in Sibirien. „Weißt, die reichen Bauern hier denken nur an sich, so ist es, wenn man selbst noch keine Not erlebt hat“, sagte sie oft. Sie kannte das Muster aus ihrer Jugend.
Sie fing noch einmal ganz von vorn an, allein. Arbeit, Arbeit bis zum Umfallen beim Roden der verwüsteten Wälder, auf den Feldern der Bauern für Milch und Brot und Kartoffeln. Die Phantasie, ins Wasser zu gehen, peinigte sie, der Fluss war nicht weit entfernt. Den Anblick der in der Wolga treibenden Toten trug sie seit der Kindheit tief in sich, jetzt wurde er zum Bild für den gewünschten eigenen Tod. Es endlich untergehen lassen, das bedrängte Schiff. Sie bekam für sich und die Kinder Räume in einem Barackenlager, wo sie wieder alle zusammen wohnen konnten. Dort gab es Gemeinschaft mit anderen Flüchtlingen, fast jeden Abend saß Leokadias Küche voll, es wurde geredet und geredet. Die Schrecken der Kriegsjahre formten sich durch Wiederholung, Wiederholung und noch mal Wiederholung zu einer Gestalt, die sich dem Inneren irgendwann glatter einfügte, nicht mehr so kratzte und schmerzte. Sie steht bis heute für mich, die Zuhörerin, zur Erinnerung bereit.
In der Baracke begann Leokadia auch wieder zu singen.





























