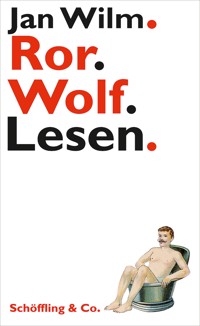Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Seit den Sauriertagen leben Bärtierchen auf der Erde, und während die Riesenechsen ausstarben, harrten sie aus. Zeit genug hatten sie, sich an diese Welt anzupassen: Die mikroskopisch kleinen Überlebenskünstler überstehen die dantesk glühende Hitze von Vulkanen und die heillose Kälte der Arktis, lange Perioden der Trockenheit können ihnen kaum etwas anhaben, und selbst das Vakuum des Alls haben sie schon unbeschadet überstanden. Anstatt sich jedoch Science-Fiction-Fantasien hinzugeben, denkt Jan Wilmin seinem literarischen Essaydie mehr als tausend Arten umfassende Lebensform des »kleinen Wasserbären«, wie diese einst liebevoll genannt wurde, im posthumanistischen Sinn aus sich selbst heraus: Besitzen diese Kleinstlebewesen etwa ein Zeitgefühl? Und was könnte es heißen, ein Bärtierchen zu sein? Vom Winzigkleinen bis zum großen Ganzen erzählt der Essay die biologische Herkunft und die vielfältige Darstellung der Bärtierchen in der Popkultur. Und er zeichnet die bisherige Berührung von Menschen und Bärtierchen nach, um aus ungewohnter Perspektive auf das zu linsen, was das Leben auf der Erde ausmacht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 65
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jan Wilm —
Bärtierchen —
Naturkunden
füra.
naturkundenno. 116
herausgegeben von Judith Schalansky bei Matthes & Seitz Berlin
Inhalt
1 · Bärentaufe
2 · Lento e largo – Tranquillissimo
3 · Zäh und süß
4 · Lebenshilfe mit Bärtierchen
1 · Bärentaufe
In den frühen Morgenstunden des 10. Juni 1767, einem Mittwoch, lag die Stadt Danzig unter dichtem Nebel. Blickte man von oben auf die Hafenstadt herunter, stachen nur die Kirchtürme durch die Nebeldecke – wie Stecknadeln, die in einem Nadelkissen auf ihre Verwendung warteten. Die versteckte Stadt, unsichtbar, morgenstumm. Tauchte man aber vogelgleich durch die Nebelschicht hinunter, wirbelten tausende winzige Punkte durch die Straßen, und je näher man kam, desto belebter und lauter wurde es.
Die Pferdehufe schlugen dumpf über die Sandstraßen, die Kutschenräder ratterten über die Kopfsteinpflasterung. Das Geschrei von Marktfrauen und Händlern scholl durch die Gassen. Es roch nach Gebratenem und Gebackenem, nach rohem Fleisch und frisch gefangenem Fisch, und wenn später am Tag die Sonne den Nebel weggebrannt haben und über die Straßen gleißen würde, würden nicht nur die buckeligen Kopfsteinpflaster im Licht erglänzen, sondern auch die Millionen von Schuppen der Fische, die man in die Gosse geworfen hatte. Im letzten Licht des Tages würden die schwarzen Pflaster schließlich glitzern wie ein Miniaturbild unserer Milchstraße.
Es war mild, nicht warm an jenem Tag, ganz typisch für den ersten Sommermonat. Ein leichter Meereswind, der die Stadt von der Ostsee her salzte, wehte gemächlich von der Danziger Bucht heran, kreuzte die ausfließende Weichsel, blies ein kurzes Stückchen die mündende Mottlau hinauf und über die sogenannte Brabank dahin. Die Brabank, eine Sandbank, war der Ort, an dem sich zur damaligen Zeit die wichtigste Schiffswerft der Stadt befand und wo an jenem Morgen große Holzschiffe zur Reparatur einliefen.
Auf die Brabank führte eine kleine hölzerne Fußgängerbrücke, deren Bohlen zu Beginn des Sommers nicht mehr ganz so tief im Flusswasser standen als noch einige Wochen zuvor. Hier unten, am Ufer der Mottlau, unter den Brückenlatten, stand ein 49-jähriger Mann mit festgeschnürten Lederschuhen im Sand und war an den Holzbohlen zugange. Was tat er da? Aus der Ferne erweckte es den Eindruck, als sei er damit beschäftigt, mit einer Säge die wasserfeuchten Bohlen zu bearbeiten. Ein Saboteur? Ein Räuber? Ein Holzfrevler? Nicht ganz. Denn kam man ihm etwas näher, erkannte man, dass dieser pastorgleich gekleidete emsige Mann mit einem scharfen Messer feuchtschleimige Mooskissen von den Holzbohlen der Brücke abtrug. Dann zückte er ein leeres Honigglas aus seiner Tasche, schob seine Nickelbrille mit dem Handrücken zurecht und legte das Moos behutsam ins Glas. Nicht Gauner, sondern Gelehrter.
In der heutigen Altstadt von Gdańsk steht noch immer das Predigerhaus, in dem der Mann lebte. Hier, gegenüber von der Katharinenkirche, in seinem Studierzimmer, füllte er das Honigglas seiner Moos- und Krautproben mit reinem Brunnenwasser und ließ es anschließend eine Weile lang am Fenster im Licht stehen. Dann wartete er. In den hallenden hohen Räumen dieses Predigerhauses – eines der wenigen Gebäude in der Altstadt Gdańsks, das den Zweiten Weltkrieg unbeschadet überstanden hat – kam am 10. Juni 1767 im Mooswasser unter dem Mikroskop ein kleines Wesen zur Welt, das es zu diesem Zeitpunkt auf diesem Planeten schon seit über 500 Millionen Jahren gegeben hatte. Welt ist ein menschliches Konzept, und zur Welt kommen meint hier die phänomenologische wie phänomenale Sichtbarmachung und Sprachwerdung dieses bislang ungekannten Lebewesens für die Menschen.
Das Lebewesen ist der »kleine Wasser-Bär«, und der kleine Wasserbär ist also Pole. Die Tiere haben Beine, Gehirne, sie haben spitze stilettartige Mundwerkzeuge und ihre stummeligen Beinchen haben Klauen. Manche Arten besitzen Augen, sie können sehen und gehen, und je nach Art sind sie zwischen 50 Mikrometern und 1,5 Millimetern groß. Zum Vergleich: 1 Millimeter entspricht 1000 Mikrometern. Kurzum: »Ein typischer Wasserbär hat etwa die Größe des Punktes am Ende dieses Satzes«,1 auch wenn manche Arten noch viel kleiner sind.
Der Entdecker, der den kleinen Wasserbären taufte, war Johann Conrad Eichhorn, ein deutscher Protestant, der in der damals polnischen Stadt Danzig als Pastor tätig war. Eichhorn war kein Wissenschaftler und betrieb die Naturkunde lediglich aus Liebhaberei. Das Bärtierchen beobachtete er durch sein »Vergrösserungs-Glaß« und fertigte eine der ersten Illustrationen eines kleinen Wasserbären an.
Eichhorns Illustrationen
Eichhorn publizierte seine Entdeckungen 1775 in dem Buch Beyträge zur Naturgeschichte der kleinsten Wasserthiere, die mit blossem Auge nicht können gesehen werden und die sich in den Gewässern in und um Danzig befinden. Da seine Wasser, Moos- und Krautproben von verschiedensten Lebewesen durchwimmelt waren, widmet er dem Wasserbären nur eine kurze Bemerkung. Seine Illustrationstafel glossiert er wie folgt:
E ist der Wasser-Bär; Ich fand dieses Thier 1767. den 10 Junii in einem Wasser das eine geraume Zeit über dem Kraut gestanden, und oben einen grünen Schleim gesezt hatte, in selbigem hielt sich dieses Thier auf, es hatte S Füsse, an jeder Seite 4, und 2 hinten, die mit starken Krallen besezt waren, es hatte nichts von dem an sich, was sonst die andere Insecten, in Ansehung ihres künstlichen Gebäudes oder ihrer Bewegung, dem Auge angenehm macht; Es ist dem blossen Auge unsichtbar, und gehöret nur für das Vergrösserungs-Glaß.2
So fremd wie für uns heute das endungslose Deutsch Eichhorns wirken mag, unendlich fremder muss für den Pastor damals die Mikrogalaxie gewirkt haben, die sich unter seinem Vergrößerungsglas offenbarte. Den Wasserbären und die anderen Mikroorganismen, die er beobachtete, bezeichnet Eichhorn schlicht als »Wasser-Insecten«.
Zum Zurweltkommen der Wasserbären, ihrem Eintritt in den Horizont der menschlichen Wahrnehmung, gehört auch, dass sich das Wesen der Tiere wandelt: Wie wir heute wissen, ist Eichhorns taxonomische Adoption falsch. Wasserbären gehören nicht zur Klasse der Insekten und nicht einmal zur taxonomisch darüberliegenden Rangstufe. Sie sind kein Teil des Stammes der Arthropoda, also der Gliederfüßer, zu denen sowohl die Arachnida, die Spinnentiere, als auch die Insecta, die Insekten, gehören, obwohl bei flüchtiger Betrachtung eine Verwandtschaft zu beiden Klassen schlüssig erscheinen könnte. Die acht Beinchen der Wasserbären – hier hat sich der Pastor verzählt, und ihnen in seiner Illustration zehn, statt acht Beinchen verliehen – suggerieren eine Nähe zu den Spinnentieren, die Kerbung ihrer Körper legt eine Verwandtschaft mit den Kerbtieren nahe, wie man die Insekten aufgrund ihrer Körpersegmentierung bis heute noch nennt.
Der Wasserbär ist in Wahrheit keine Einzelspezies, wie man lange glaubte. Tatsächlich sind Wasserbären eine ganze eigenständige Tierklasse, bestehend aus verschiedenen Spezies, auch wenn sie alle zum Überstamm der Ecdysozoa, der Häutungstiere, gehören.
Es ist möglich, dass vor Eichhorn schon zahllose andere menschliche Augen diese Wesen gesehen hatten, sofern sie Zugang zu den Kleinweltentdeckern, den Vergrößerungsgläsern, hatten. In den 1670er Jahren hatte der holländische Tuchhändler und in seiner Freizeit ebenfalls als Naturforscher arbeitende Antonie van Leeuwenhoek den Vorreiter des modernen Lichtmikroskops erfunden und zum Beispiel die roten Blutkörperchen, Spermien und Bakterien entdeckt; sein Kleinbetrachter ermöglichte es, die galaktische Weite der Lebenswelt von Kleinstlebewesen zu untersuchen, den jahrtausendealten Nebel über den Mikroorganismen zu zerstäuben. Van Leeuwenhoek nannte diese Wesen »dierkens«, also Tierchen, und es ist möglich, dass auch er längst mit den noch namenlosen Wasserbären bekannt war, als er ähnliche Wesen beschrieb, die er 1702 in Schlamm aus der Regenrinne seines Hauses in Delft beobachtete. Anders als im Falle vieler weiterer Mikroorganismen aus Regenpfützen und abgestandenem Blumenwasser hat der Entdecker der Mikrowelt die möglichen Wasserbären jedoch nicht weiter beschrieben oder gar getauft. So blieben sie noch eine ganze Weile lang in der sprachlosen Schwebe des Unentdeckten wie platonische Seelen, die darauf warten, ins Leben geschickt zu werden.
In dem knappen Jahrhundert, das zwischen van Leeuwenhoek und Eichhorn verstrich, haben vielleicht viele andere Forschende längst voller Verwunderung und Staunen – vielleicht aber auch mit Unverständnis oder Gleichgültigkeit – auf diese Kleinstgeschöpfe geblickt. Der Geschichte sind die Namen dieser Menschen so unbekannt, wie es viele Jahrtausende seit Beginn der Geschichtsschreibung der kleine Wasserbär war. Unsichtbar, sagt der Mensch, ohne hinzuzufügen, für wen.