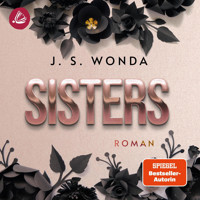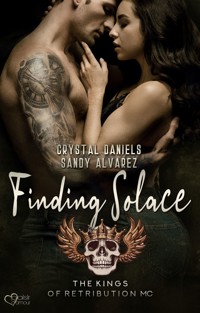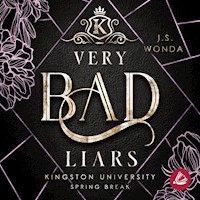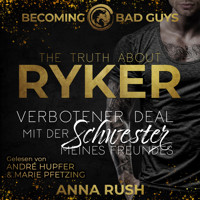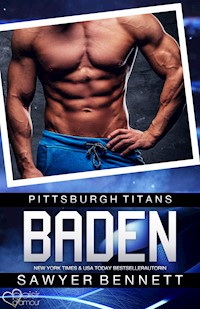3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Erotik
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Eher zufällig stolpern die ängstlichen Heldinnen und Helden aus dem alltäglichen erotischen Einerlei in Abenteuer, die sie unwiderruflich verändern. Cornelia Arnhold erzählt von der Flucht vor den Gefühlen und den Haken, die Frauen und Männer dabei schlagen. Geschichten mit Witz, Ironie und Pfiff und mit überraschenden Pointen. Geschichten, die erotische Funken aus dem Alltag schlagen. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 230
Ähnliche
Cornelia Arnhold
Bastardlieben
Erotische Geschichten
FISCHER E-Books
Inhalt
Die Frau in der Gesellschaft
Herausgegeben von Ingeborg Mues
Wer hat Angst vorm schwarzen Mann?
Niemand natürlich, keine Frage. Trotzdem nichts wie weg. Ein Kreischen verschluckt und ab in die Büsche. Hingeduckt unter modrige Kellertreppen, platt zwischen Schrank und Wand oder atemlos hinterm Baum. Und ja nicht gemuckst, sonst findet er dich. Ein Spaß war das.
Henriette betrachtet ihr Gesicht ohne Eile in dem neuen Taschenspiegel. Wie eine Kralle ragt ein fettes schwarzes Haar aus dem Leberfleck neben der Oberlippe. Sie wagt nicht, es zu zupfen. Die Dinger sind heimtückisch. Plötzlich werden sie bösartig und fangen an zu wachsen. Für einen Augenblick ist sie allein im Raum. Die Kollegin ist zur Toilette gegangen, um Kaffeewasser zu holen und sich ungestört in dem großen Spiegel über dem Waschbecken zu betrachten.
Nein, Angst war das keine gewesen. Das Kichern zu unterdrücken war am schwersten. Es kitzelte unwiderstehlich irgendwo, wo man es nicht benennen konnte, und wollte heraus. Aber wer sich vorschnell finden ließ, wurde ausgelacht. Doof bleibt eben doof. Nach der Wiehießsienochgleich brauchte keiner lange zu suchen. Die strampelte und quiekte, wälzte sich und umklammerte die Beine ihres Entdeckers. Das machte beiden Spaß. Die Streberin fanden sie nie. Darauf bildete die sich was ein. Die erfand immer neue Verstecke. Beim letzten Mal war sie zwischen die Hinterräder eines geparkten Wagens gekrochen und verharrte dort reglos, obwohl sie mehrmals dicht an ihr vorüberliefen.
Auch der Fahrer des Wagens hatte nichts gemerkt.
Danach wurde das Spiel verboten und mußte heimlich fortgesetzt werden. Aber unterm Auto hat sich keine mehr versteckt.
Unnatürlich vergrößert starrt ihr Auge aus dem Spiegel zurück. Henriette reißt die Lider weit auseinander und bürstet sorgfältig über die Wimpern, um sie in einem Korsett aus schwarzer Farbe lückenlos zu verschließen. Die Mascaratube in ihrer Hand zittert leicht.
Nie mit einem Juden. Nie mit einem Neger. Das war keine Frage gewesen, sondern eine Feststellung. So selbstverständlich wie Mittagessen um eins. Trotzdem wurde sie wiederholt wie ein Glaubensbekenntnis: Nie mit einem Juden. Nie mit einem Neger.
Und mit einem Chinesen? Als Antwort eine Ohrfeige mit dem Zusatz: Werd nicht frech! Natürlich machte sie daraus: Nur mit Juden. Nur mit Negern. Der Vorsatz war schwer umzusetzen. Die Kleinstadt beherbergte damals keinen einzigen Neger. Und woran erkannte man Juden?
Hinterher war deshalb ihre erste Frage: Bist du Jude? Einen angehaltenen Atemzug lang lag eine weitere Ohrfeige in der Luft. Dann zog er stumm die Hosen hoch und ließ sich nie wieder blicken.
Ein vorschneller Wimpernschlag hat Spuren unterm Auge hinterlassen. Henriette kramt unter Lidschattendosen, Make-up-Tuben und Lippenstiften nach einem Q-Tip. Die Utensilien stammen noch aus der Zeit mit Silkes Vater. Ungeschminkt war sie sich damals wie nicht vorhanden vorgekommen. Selbstverständlich war er weder Jude noch Neger. Seit der Scheidung hat sie mehr aus dem Fenster als in den Spiegel geschaut.
Wenigstens einen Juden hatte es gegeben. Der hatte überall verkündet, daß er Jude sei. In der Diskussion über Fahrradwege ebenso wie bei einem Streit mit der Kellnerin. Das war für Henriette Grund genug. Mehr wollte sie gar nicht wissen. Dann fand sie heraus, daß er sie hereingelegt hatte. Nur sein Vater, noch dazu ein unehelicher, war Jude gewesen. Und so einer zählt nicht. Was das Jüdischsein angeht, zählt bei Juden nur die Mutter. Das hatte sie inzwischen herausgefunden. Er war also überhaupt kein Jude, nicht einmal ein halber richtiger. Sie trennte sich.
Neger, Jude, was spielt das heute noch für eine Rolle?
Henriette zupft Wattefädchen aus den Wimpern.
Ein Neger mit Gazelle zagt im Regen nie. Der Satz war in ihrer Schulzeit auch bei den Lehrern ungeheuer beliebt gewesen. Durch ein geheimnisvolles Gesetz waren darin Neger und Gazellen untrennbar miteinander verbunden.
Sag nicht immer Neger, ermahnt sie sich und zieht probeweise an dem wilden Haar, nur Rassisten sagen Neger. Sag Farbiger, Schwarzer, Afrikaner, dunkelhäutig, oder tu einfach so, als wäre er genauso weiß wie du. Tu so, als fiele dir gar nichts auf.
»Für wen machen Sie sich denn heute noch so schön?«
Aus dem Ton der Kollegin, die unvermittelt hereingekommen ist, klingt Neugier. Und obwohl die Frage zum Standardrepertoire des Büros gehört und sich mit einem Schulterzucken abtun ließe, tut Henriette übertrieben alltäglich, so, als gehöre die Schminkerei längst wieder zu ihrem täglichen Programm.
Seit einem dreiviertel Jahr arbeitet sie jetzt in dem Büro der internationalen Spedition im Industriehof. Sie müsse keine Sprache perfekt beherrschen, hatte ihr der Personalchef beim Vorstellungsgespräch erklärt. Grundkenntnisse in mehreren Sprachen wären dagegen vorteilhaft.
Für Henriette, die früher nach jedem Urlaub einen neuen Sprachkurs besucht hatte, traf sich das gut.
Such dir eine Arbeit, hatte Silke nach der Scheidung immer wieder gedrängt. Das Rumsitzen daheim macht dich nur trübsinnig, Mutti.
Daraufhin hatte sie sich auf die nächstbeste Anzeige beworben und den Vertrag sofort unterschrieben.
Silke machte ihr deswegen heftige Vorwürfe. Du hättest ihn wenigstens vorher durchlesen müssen.
Ihre tüchtige Tochter. Immer bei der Hand mit Ratschlägen und Erfolgsrezepten: Tu was! Geh aus! Triff dich mit Leuten! Du siehst doch noch ganz o.k. aus, Mutschka. Vielleicht lernst du ja einen passenden Mann kennen.
Was würde Silke für passend halten?
Henriette schiebt den Gedanken entschlossen zur Seite.
Ihr Arbeitsplatz ist ein Brückenkopf für Stimmen von überall her, die alle gleichzeitig versuchen, durch ihre Gehörgänge zu rasen, um schneller an ihr Ziel zu gelangen.
Sobald die ersten Worte an ihr Ohr dringen, fühlt Henriette, wie sich ihre rechte Schulter hebt und die Füße das Stuhlbein umklammern. Trotzdem ist es bisher nie zu der sprachlosen Katastrophe gekommen, die sie insgeheim fürchtet.
Mitten durch das hektische Geschrei schlenderte eines Tages eine Stimme voller runder, in die Kehle gezogener Vokale. Ein weicheres Französisch, als sie es gewöhnt ist, und langsamer, viel langsamer.
Vor etwas über einem Monat hat sie sich zum ersten Mal mit dieser Stimme getroffen, nachdem sie ihm am Telefon von Silke erzählt hatte, sozusagen als Sperrfeuer, und daß sie geschieden sei, um den Dingen dann trotzdem ihren Lauf zu lassen.
Sie verabredeten sich auf dem Fluß, genau in der Mitte vom Eisernen Steg. Das war ihre Idee gewesen. Der Ort erschien ihr irgendwie symbolisch.
Außerdem kann ich dann immer noch unbeteiligt tun und vorbeigehen wie eine zufällige Passantin, wenn er mir nicht gefällt, hatte sie bei sich gedacht.
Aber darauf war sie nicht gefaßt gewesen.
Wie jung! Wie schwarz!
Vor Schreck war sie stehengeblieben und vergaß, weiterzulaufen.
Erfreut ging er auf sie zu. Seine Zähne leuchteten.
Menschenfresser, Herzensbrecher … Der Kinderreim schoß ihr durch den Kopf und die Hand vor den Mund.
Es wurde ein schweigsamer Nachmittag.
In großem Abstand gingen sie nebeneinander her und lächelten verlegen aneinander vorbei. Sie deutete auf den glitzernden Fluß, und er nickte, ohne sie aus den Augen zu lassen. Seine dunklen Augen ließen nicht locker und zwangen ihren Blick immer wieder hinunter ins kühle Wasser.
Diese Hitze, dachte sie, ich vertrag das nicht. Für ihn ist das normal. Friert er nicht im Winter? Hat er dann kein Heimweh? Fragen, die ihr bleischwer auf der Zunge lagen. Sie zeigte auf die bunten Tische am Ufer neben dem kleinen Zirkuszelt. Sie setzten sich einander gegenüber und sahen sich an. Drinnen lief die Nachmittagsvorstellung. Ein Löwe brüllte.
»Très belle«, sagte er und sah ihr direkt in die Augen. »Sie haben ein Freund?«
Henriette schien es, als stoße seine Zunge ein paarmal zuviel gegen die Zähne.
Sie schüttelte den Kopf.
Trommelwirbel, Kinderschreie und die überschnappende Stimme des Ansagers. Dann endlich befreiendes Klatschen und im Hintergrund wieder der Löwe.
Sie hob den Finger wie eine lauschende Lehrerin. »Hören Sie?« Sie lächelte, als mache sie ihm ein Geschenk. »Löwen!« Er sah sie verständnislos an.
»Löwe. Lion.«
Sie beugte sich zu ihm hinüber. »Bekommen Sie dann kein … vous n’avez pas de …«
Was hieß Heimweh auf französisch? Henriette legte statt dessen die Hand aufs Herz. Der Löwe raunzte wieder.
Jetzt hatte er verstanden und lachte.
»Non, non«, sagte er und schüttelte abwehrend seine dunklen Hände mit den seltsam hellen Nägeln. »Keine Löwen in Dakar.« Er grinste. »Vielleicht im Zoo. Je ne sais pas.«
Henriette fühlte, wie ihr die Hitze in Wellen ins Gesicht stieg. Ich vertrag das nicht, dachte sie, ich werd ja auch nicht braun, nur rot und heiß.
Zum Abschied reichten sie sich die Hände.
»Das war sehr nett«, hatte sie gestammelt und diese fremde Hand gehalten.
Seither haben sie sich noch dreimal getroffen, und es wurde schwierig, sich auf Plätze zu beschränken, an denen sie keiner kennt, ohne daß ihm das auffällt. Sie möchte nicht gesehen werden. Noch nicht.
Das wäre anders, wenn es etwas Ernsthaftes wäre, denkt sie, während sie sich prüfend im Spiegel betrachtet, etwas Unwiderrufliches. Dann wär ich zu allem bereit. Dann könnten sie kommen. Dann würde ich zu ihm halten, wenn es sein muß gegen die ganze Welt. Wie damals mit Silkes Vater. Nie wieder hat sie sich so stark, so ohne Zweifel gefühlt, so unangreifbar. Es müßte etwas sein, für das es sich lohnt.
Ist es ernst? Sie sieht sich fragend in die Augen. Ist die Unruhe, die es ihr schwermacht, ihre Gedanken auf die Fragen der Kollegen zu konzentrieren, ein Anzeichen?
Bin ich verliebt? fragt sie ihr Spiegelbild lautlos. Das ist blasser als sonst. Oder kommt ihr das heute nur so vor? Er macht ihr die Antwort aber auch nicht leicht. Keine Küsse, keine versteckten Anspielungen. Nie hat er versucht, seine Hand auf ihr Knie zu legen. Nur ihre Hände haben sich bisher berührt, zur Begrüßung und zum Abschied.
Schwarze Hände auf weißer Haut, weiße Hände auf schwarzer Haut. Solche Bilder finden sich inzwischen in jeder beliebigen Fußgängerzone in den Drehständern vor den Läden. Kühle grafische Aufnahmen, die sich bedenkenlos überallhin verschicken lassen.
Wie ihre weiße Hand in seiner schwarzen lag. Sobald sie daran denkt, fühlt Henriette die Berührung wie einen Schauer.
… sie haben die längsten, Schwänze wie Säbel und setzen sogar Hüte drauf, damit sie noch länger aussehen. Sechs Diener waren nötig, um dem König seinen Schwanz vorauszutragen, manche behaupten sogar, es seien zwölf oder mindestens sieben gewesen, vielleicht ist das übertrieben, und es waren doch nur zwei. Auf jeden Fall sind sie verrückt nach Sex. Sie können gar nicht anders, sie ficken eine Frau tot, das liegt in ihrer Natur, und in der Natur hat alles seinen Sinn. Die Sonne senkrecht überm Kopf, die feuchte Hitze und alles voller Bakterien. In so einem Klima sterben die Kinder wie Fliegen, also müssen sie ständig dafür sorgen, daß sie nicht aussterben. Einige gehen jetzt sogar auf die Universität. Aber lassen Sie sich nicht täuschen, im Grunde sind sie grausam und unberechenbar. Sie stoßen gnadenlos zu, vorne rein und hinten wieder raus, den Rest pflügen sie unter, Fruchtbarkeitsriten, davon machen wir uns ja keine Vorstellungen …
Natürlich glaubt Henriette so was nicht. Es ist nur seine trügerische Ruhe, der sie mißtraut. Sie hat etwas Lauerndes. Statt über sie herzufallen, saß er ihr in verschiedenen Cafés gegenüber, schob Tortenstücke zwischen seine makellosen Zähne, nickte zu ihren immer haltloser gestotterten Geschichten und lächelte ihr in die Augen. Was für ein hübscher Mann!
Vielleicht ist er ein Dealer. Oder der Lockvogel für eine Bande von Frauenhändlern. Man liest ja so viel und muß gewarnt sein. Keine könnte sich hinterher herausreden. Kannst du nicht lesen? müßte sie sich fragen lassen. Siehst du nicht fern? Alle hätten ihr sagen können, wie so was ausgeht.
Nachdem sie sich vergewissert hat, daß die Aufmerksamkeit ihrer Kollegin der Zeitung gilt, formt Henriette ihre Lippen vor dem Spiegel zu einem ungenierten O.
Lippenstift oder keiner?
Das ist gerade heute eine heikle Frage.
… Frauen, die sich mit Negern einlassen, sind Huren. Schlimmer, Huren wollen keinen Sex, die wollen nur Geld. Und Geld will schließlich jeder, das ist normal. Aber so was ist nicht normal. Die Ente läuft ja auch keinem Hahn hinterher. Das ist gegen die Natur …
Im Zweifelsfall ist immer alles gegen die Natur. Unvermittelt fallen ihr die Männer ein, die in den Parkanlagen den Unrat auf Stöcke spießen. Das mörderische Eisen, an dem Grasbüschel kleben, ist blankgeschabt von der feuchten Erde, in die es immer wieder hineingestoßen wird durch Papier, das sich verzweifelt wölbt …
Nun spinnst du aber, sagt sie sich und schraubt entschlossen den Lippenstift hoch.
Mißbilligendes Schnauben ertönt von der anderen Seite des Schreibtischs. Eine Zeitung wird zu ihr hinübergeschoben. Unter ihrer Löwenmähne starrt Tina Turner herausfordernd aus der Seite. Über 1000 Perücken? steht in Großbuchstaben unter dem Foto.
»Nun sagen Sie mal, wie finden Sie die?«
Der würde auch ’ne Glatze stehen, denkt Henriette, während sie das Foto betrachtet. Schwarze Frauen sind einfach schöner. Ihre Haut knittert nicht, nicht mal nach Jahren. Auf weißer Haut sieht man dagegen jeden Fleck.
… einmal mit’ner Schwarzen, und du rührst keine Weiße mehr an, für ’ne Schwarze laß ich zehn, was sag ich? zwanzig weiße Weiber stehen, wild sind die, die lutschen dir den Leo bis zum Stummel ab, dafür lassen sich die jungen Mädchen dort sogar die Vorderzähne ziehen …
»Sie sieht phantastisch aus«, sagt Henriette mutlos und betrachtet Tinas tadelloses Gebiß.
»So? Finden Sie?« Die Kollegin streift sie mit einem verwunderten Blick. »Die ist doch mindestens zehn Jahre älter als er«, sagt sie spitz und zieht die Zeitung wieder zu sich herüber, um noch mal einen Blick auf das kleine Foto zu werfen, das eine neue Freundin von irgendeinem Schlagersänger zeigt.
»Da könnt ich ja gleich mit meinem Sohn …« Sie schüttelt sich. »Nee, da können Sie mir sagen, was Sie wollen, so was ist doch nicht normal …«
Statt zu antworten, bemalt Henriette ihren Mund in einem kräftigen Rot. Anschließend küßt sie die Innenfläche ihrer Hand, um die überschüssige Farbe abzustreifen. Schließlich betrachtet sie sich noch einmal prüfend aus verschiedenen Blickwinkeln.
Nicht schlecht, findet sie, nur etwas blaß.
Er erwarte einen wichtigen Anruf von zu Hause, hatte Mamadou ihr vorhin am Telefon gesagt, deswegen könne er nicht weg. Ob sie nicht zu ihm kommen wolle. Er würde Tee machen. Seine Stimme hatte wie sonst geklungen.
Nein, das mache ihr nichts aus, hatte Henriette in normalem Ton geantwortet und gefühlt, wie ihr Rücken steif wurde. Sie werde Kuchen mitbringen.
Henriette sieht auf die Uhr.
»Ich geh dann«, sagt sie und steht auf.
»Einen schönen Abend noch«, sagt die Kollegin und zwinkert ihr zu.
Glück gehabt … da haben Sie aber … umsteigen nach … noch mal Glück … Endstation, alles aussteigen … da haben Sie aber …
Ohne anzuhalten, leiert der Satz durch ihren Kopf.
Henriette versucht, sich zurechtzufinden. Das Weiß brennt in ihren Augen. Von der Heizung blättert weiße Farbe. Sogar die Stühle sind weiß. Ihr Blick tastet über die weißen Wände zur Tür, über das schmutzige Weiß der Decke hin zum Fenster, von dort zu dem bleichen Gesicht darunter, das mit geschlossenen Augen in den Kissen liegt, zu der farblosen Flüssigkeit in der Flasche, die umgekehrt in dem Gestell neben ihrem Bett hängt.
Verständnislos betrachtet sie die weiße Mullmanschette um ihr Handgelenk, aus der sich ein durchsichtiger Schlauch über die Bettdecke schlängelt. Vorsichtig bewegt sie die Finger in der weichen Mulde, in der ihre Hand liegt. Das tut nicht weh.
»Was passierte in der Wohnung?«
Die Stimme neben ihrem rechten Ohr klingt mütterlich, mit einem drängenden Unterton. »Sie müssen keine Angst haben. Versuchen Sie einfach, sich zu erinnern.«
Henriette dreht den Kopf zum Fenster, um der Stimme zu entkommen, und sieht in den milchigen Himmel. Das Innere ihres Mundes fühlt sich taub an.
Mamadou hatte im Türrahmen gestanden. Das saftgrüne Sweatshirt hob den Mahagoniton seiner Haut hervor. Oder war es umgekehrt? Der dunkle Hintergrund brachte die Farben zum Leuchten, die Zähne wirkten weißer, das Grün grüner. Er beugte sich ihr entgegen. Sie spürte den kurzen Druck seiner muskulösen Finger, dann trat er zurück und ließ sie herein.
Das kleine Appartement roch nach zahllosen Vormietern. Jeder hatte etwas zurückgelassen, dem einen nützlich, dem nächsten lästig, aber nicht der Mühe wert, es die Treppe runter zur Mülltonne zu tragen. Ein Poster von einem griechischen Hauseingang hing neben dem Fenster, durch das man den bleigrauen Main sehen konnte. Auf der Fensterbank lagen fünf tote Fliegen. Henriette hatte Zeit, sie zu zählen, denn im selben Moment schellte das Telefon. Sie hob eine nach der anderen an ihren starren Flügeln hoch und ließ sie zu Boden fallen.
Zwei Tassen standen aufnahmebereit nebeneinander auf dem flachen Tisch vor dem Sofa. Henriette schob eine vor den gegenüberliegenden Sessel, nahm den Kuchen aus der Tüte und stellte ihn dazwischen. Dann setzte sie sich auf das Sofa und betrachtete den schmalen Rücken, den Mamadou ihr zukehrte. Sein ganzer Körper krümmte sich über den Hörer, den er mit der Linken gegen das Ohr preßte. Mit der anderen Hand stützte er sich gegen die Wand. Er sprach schnell und ohne Pause. Sie verstand kein Wort.
Sein Hemd war hochgerutscht und entblößte zwei Wirbel breit Haut. Sie glänzte und schlug nirgends die kleinste Falte, nicht mal die Haut in der Beuge zwischen Handgelenk und Unterarm. Wie dünn er ist, dachte sie.
Er hatte die Hüfte eingeknickt, so daß sich die andere Gesäßhälfte extrem weit nach hinten schob. Ihre geschwungene Form erinnerte sie merkwürdigerweise an die Hutkrempe von Humphrey Bogart. Außer einem flachen Messingreif und einer Uhr trug er keinen Schmuck. Ob Eheringe im Senegal üblich waren?
Henriette rieb ihre Handflächen unruhig gegeneinander. Die fremde Sprache steigerte sich zu einem prasselnden Crescendo, dann legte er den Hörer auf und drehte sich zu ihr um. Sein Bruder sei das gewesen, erzählte er, während er Töpfe und einen Campingkocher auf den Tisch stellte. Er ließ Wasser, Tee und Zucker zusammen aufkochen, füllte alles in einen zweiten Topf um, gab noch mehr Zucker dazu und stellte den Topf zurück auf die Flamme, bis es erneut zu sprudeln begann. Dann füllte er wieder um. Und so fort. Die Töpfe wechselten von einer Hand in die andere mit der rasanten Fingerfertigkeit eines Hütchenspielers, dessen Ziel es ist, zu erreichen, daß der Beobachter die Kugel aus den Augen verliert.
Sieh genau hin, flüsterte ihr verwirrtes Hirn. Sieh hin, was er hineintut! Sieh dich vor!
Aber sie konnte nichts im Blick behalten außer den tanzenden Handgelenken und seinem lachenden Mund. Wie weggewischt war das zähe Schweigen, das auf ihren Wanderungen durch leere Vorstadtstraßen gelastet hatte und das ihr manchmal undurchdringlich wie ein Dschungel vorgekommen war.
Er redete drauflos, daß sie kaum die Hälfte verstand. Die Worte überstürzten sich, liefen über sie hin und erwarteten keine Antwort. Er lachte und jonglierte mit den Töpfen, bis ihr schwindlig wurde. Ehe sie es verhindern konnte, hatte er sich zu ihr hinübergebeugt und die schwarze, klebrige Flüssigkeit in ihre Tasse gegossen, während seine Stimme weiter an ihr Ohr trommelte. Sie nahm die Tasse, lehnte sich zurück, richtete sich in ihrem Schweigen behaglich ein und ließ ihre Gedanken laufen. Ihre Zunge planschte vorsichtig in dem übersüßen Tee, während sie beobachtete, wie seine Haut vom Reden über dem Feuer zu glühen begann. Sie hörte die Trommeln seiner Heimat, roch den beißenden Geruch der Märkte und nickte zu jedem Wort. Sie nickte und nickte. Sie war eine einzige Zustimmung. Was immer er ihr in die Tasse schüttete, es würde ihr recht sein.
Sie beugte sich hinüber, damit er ihr nachschenken konnte. Da fühlte sie das Messer am Hals.
»Sprechen Sie ganz offen. Sie brauchen sich nicht zu schämen. Niemand macht Ihnen einen Vorwurf.«
Die Stimme platzt in ihre Gedanken. »Viele Frauen sind schon auf so was hereingefallen. So einer wartet, bis die Frau Zutrauen gefaßt hat, dann nutzt er es aus.«
Die Stimme kommt näher, und Henriette fühlt feuchte Fontänen am Hals.
»Die kommen aus Ländern, in denen man keine Achtung kennt vor Frauen. So gesehen können sie im Grunde nicht mal was dafür.«
»Ich bin müde«, sagt Henriette mit geschlossenen Augen.
»Natürlich, natürlich«, hört sie die Beamtin voll heuchlerischer Wärme sagen, »ich will Sie nicht länger quälen. Ruhen Sie sich aus, und denken Sie noch einmal in Ruhe über alles nach.«
Henriette fühlt eine Hand auf ihrem Arm und dann die Stimme dicht an ihrem Ohr.
»Aber er könnte zu einer Gefahr werden für andere Frauen. Denken Sie auch daran.«
Ein Stuhl wird gerückt, und mit einem aufmunternden Druck verläßt die Hand ihren Arm.
»Jetzt ruhen Sie sich erst mal aus.«
Dann geht die Tür.
Nach einigen Minuten öffnet Henriette die Augen und sieht aus dem Fenster, vor dem sich graue Wolkenmassen langsam ineinanderschieben. Vorsichtig hebt sie den Kopf. Die Frau im Nachbarbett schläft.
Ich kann mich an nichts erinnern, gar nichts. Das ist das Beste für alle, sagt sie tonlos zu der Schlafenden.
Dann läßt sie den Kopf wieder zurücksinken.
»Was hast du dir bloß dabei gedacht?«
Die Stimme ihrer Tochter hatte wütend geklungen, bevor sie sich wieder in die gewohnte Fürsorglichkeit rettete. »Gehst einfach in die Wohnung von einem Wildfremden, noch dazu …«, sie sprach es nicht aus, »…aber denk nicht mehr dran, das regt dich nur auf.«
Silke ruft zweimal täglich an. Du brauchst Ruhe, hatte sie entschieden, und die Ärzte stimmten ihr zu. Keine Aufregungen. Das galt auch für die Polizistin, die ihre eigenen Vorstellungen von den Ereignissen hat. Henriette soll sie bestätigen.
Sie schließt die Augen, öffnet sie aber sofort wieder und konzentriert sich auf das Heizungsrohr unter der Zimmerdecke. Es ist dunkel vor Staub. Im Zimmer ist es kühl und still. Doppeltür und Isolierglasfenster halten den Lärm draußen. Nur das Heulen der Unfallwagen dringt manchmal herein. Einfach daliegen und warten und nicht gemuckst, sonst … Ob Silke das auch gespielt hat? Spielen Kinder das überhaupt noch?
Ich kann mich an nichts erinnern. Silke hat recht. Nicht mehr dran denken, das ist das Beste. Alles vergessen. Wie das Messer.
Ein Messer nur für den Notfall. Falls es in seiner Wohnung zum Äußersten kommen sollte, wollte sie gerüstet sein. Das Steakmesser war die einzige Waffe, die ihr in der Aufregung in die Hände fiel, da das Tränengas, das Silke ihr mitgebracht hatte, nirgends zu finden war.
Aber in der Handtasche würde es im Notfall irgendwo unerreichbar weit weg liegen. Deswegen hatte sie es in mehrere Lagen Zeitungspapier gewickelt und griffbereit zwischen ihre üppigen Brüste gesteckt, die der silbergraue Body gegeneinander preßte, und dort vergessen.
Dann saß sie auf seinem Sofa und sehnte sich nach dem Notfall. Mit einem Messer zwischen den Brüsten.
Als sie sich vorbeugte, um ihm die Tasse zu reichen, kitzelte es sie am Kinn. Sie schlug danach wie nach einer Fliege, die sie in ihren schönsten Phantasien störte, in denen sie gerade auf einer Matte im Schatten hoher Palmen …
»Würdest du mich heiraten?« hörte sie ihn fragen und blinzelte verwirrt. Wollte er sie nicht küssen? Oder küßte man in seiner Heimat erst hinterher?
Sie hörte, wie er aufstand.
Unauffällig schob sie das Messer so weit wie möglich nach unten und bedeckte mit der Hand die Augen. Alles Blut sackte ihr in den Schoß und begann dort zu klopfen. Sie hörte Mamadou durch den Raum gehen und eine Schublade aufziehen. Nach einer Weile kam er zurück und ließ sich wieder in den Sessel fallen. Sie öffnete die Augen. Vor ihr auf dem Tisch lag ein Bündel Geldscheine.
Das könne sie haben und mehr, erklärte Mamadou, kein Problem. Mit deutscher Ehefrau und Arbeitserlaubnis würde er genug verdienen. Das würde sich in jedem Fall lohnen, für beide Seiten.
Sie starrte ihn an.
Oh?! Er hob abwehrend die Hände. Non, non, non, keine Sorge, so einer sei er nicht. Nicht, was du denkst. Er strahlte sie beruhigend an. Alles nur auf dem Papier, sie müsse sich keine Sorgen machen. Das sei doch ein Superangebot. Na?
Zuversichtlich strahlte er sie an.
Und plötzlich sah sie sich mit seinen Augen. Eine Ziege war sie oder ein Kamel, nichts weiter. Eine Ware, an deren Gebrauch ihm nicht mal was lag. Höchstens den Preis könnte sie noch in die Höhe treiben. Ein Geschäft, weiter nichts.
Von da ab sind ihre Erinnerungen nur Bruchstücke:
100 Mark auf der Käsesahne, der Schmerz, als die Tischkante gegen ihr Schienbein schlägt, das Zischen, mit dem die Flamme im Tee ersäuft, dunkle Flecken auf Saftgrün, der hochgeklappte Klodeckel, als sie auf ihrer haltlosen Flucht die Türen verwechselte.
Die Treppen hinunter wie im Fall. Vor der Haustür blies ein starker Wind.
Nichts wie weg!
Irgendwann hörte sie ihn hinter sich rufen. Sie preßte die Hände auf die Ohren und rannte. Als er sie einholte, riß sie ihren Arm aus seiner Hand, als sei er verbrannt, und warf sich auf die Kreuzung wie in einen Abgrund. Sein Griff riß sie im letzten Moment vor einem heranrasenden Auto zurück. Einen Herzschlag lang lehnte sie atemlos an seiner Brust. Dann schlug sie um sich, schrie, trat, zerrte blindlings an ihren Händen, die er nicht loslassen wollte.
Sie hörte Rufe von der anderen Straßenseite.
»Laß die Frau los!«
Dort war ein Kiosk, vor dem standen sie mit Flaschen in den Händen.
»Laß die Frau in Ruhe, sonst …«
Sein Griff lockerte sich, sie wand sich, trat zu und traf auf Luft und fiel … in einen scharfen, stechenden Schmerz. Alles begann sich zu drehen.
»Scheißneger!« grölten die fremden Stimmen von drüben.
Dann wurden sie plötzlich schrill.
»Blut! Der sticht sie ab!«
Von allen Seiten kamen Schritte über den Asphalt.
Der Schleier vor ihren Augen verdichtete sich.
»Vorsicht! Der hat ein Messer!«
Dann waren sie über ihr. Der Boden vibrierte von Tritten. Als sie mühsam die Augen öffnete, sah sie Mamadous Gesicht unter einem Schuh. Sein Körper zuckte unter den Schlägen.
»Der kriegt, was er verdient«, knurrte einer, der ihm im Nacken saß.
»Nein«, flüsterte sie, aber ihre Stimme wurde nicht laut. Wie durch Nebel hörte sie die Sirene.
Die Zeit vergeht hier genau nach Plan. Wenn die Schwester nach der letzten Infusion gute Nacht sagt, ist wieder ein Tag vorbei. Gerade hat sie die Servierwagen mit den Plastiktabletts hereingeschoben. Die blasse Frau im Nachbarbett ist aufgewacht und schiebt apathisch ihr Essen in sich hinein. Henriette gräbt Löcher in den Pudding, die sich sofort mit klebriger roter Sauce füllen, schaufelt lustlos Gelbes übers Rote, rührt, was drunter war drüber, bis rosagelber Matsch die Glasschale füllt. Dann schiebt sie das Tablett von sich. Was er wohl macht?
Werden sie ihn einsperren oder abschieben?
Ein paarmal schon hat sie seine Nummer gewählt und gleich wieder aufgelegt. Vielleicht hat er sich rechtzeitig aus dem Staub gemacht, ist längst wieder daheim oder sonstwo. Du warst ein schlechtes Geschäft, sagt sie sich, ein sehr schlechtes.
Sie betrachtet sich ratsuchend im Spiegel. Ihr Gesicht sieht schon wieder aus wie sonst, sogar ausgeruhter und rosig.
Die Polizistin loszuwerden wird jeden Tag schwieriger, die will die Bestätigung unter ihre Meinung wie einen Stempel. Die Wahrheit würde sie sowieso nicht glauben.
Angsthase, Pfeffernase … eine Ziege bist du und feige dazu. Sie haben nichts Konkretes gegen ihn in der Hand, beruhigt sie sich, auch ohne meine Aussage, die mich lächerlich macht und keinem hilft.
Mit der freien Hand greift sie zum Hörer, klemmt ihn ans Ohr, wählt die vertraute Nummer und wartet. Dabei betrachtet sie sich im Spiegel.
Das Haar ragt immer noch fett und häßlich aus dem Leberfleck neben der Lippe. Sie betrachtet es voll Haß, als sei es an allem schuld.
Diesmal läßt sie es lange läuten. Aber niemand nimmt ab. Schließlich gibt sie auf, legt den Hörer auf die Gabel, greift nach einer Pinzette und reißt das Haar mit Todesverachtung heraus.