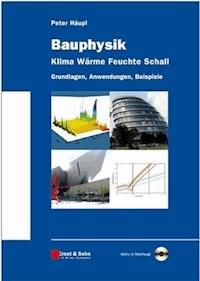
34,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wiley-VCH
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Klimaschutzgerecht und energieoptimiert Bauen heißt: volle Gewährleistung der Funktions- und Eigensicherung von Gebäuden, wie Einhaltung eines nutzeradäquaten Raumklimas und Vermeidung von Feuchteschäden an Bauteilen, bei gegebenem Außenklima unter intelligentem Einsatz von bauphysikalischen, baustofflichen, baukonstruktiven, anlagentechnischen und gestalterischen Mitteln. Das vorliegende Buch konzentriert sich auf das bauphysikalische Instrumentarium. Es ist klassisch gegliedert in die Teile Klima, Wärme, Feuchte, Schall weicht aber in den Einzelinhalten und Vermittlungsmethoden von eingefahrenen Wegen ab und ist somit keine Wiederholung gängiger oder bewährter Literatur. Bauphysikalische Normen sind aufgrund der intensiven Wissensschöpfung kurzlebig. Deshalb wird eher sparsam darauf Bezug genommen. Für den unter Zeitdruck lernenden und praktizierenden Ingenieur sind die verwendeten Gleichungen leicht verständlich und meist näherungsweise aus den physikalischen Grundgesetzen abgeleitet. Dies betrifft zahlreiche bekannte, aber auch viele neue, weit über das Normenniveau hinaus gehende und dennoch praktikable und plausible Aussagen und Anwendungen. Obgleich auf allen Gebieten der Bauphysik Software-Tools auf der Basis numerischer Simulationsverfahren vorliegen, beruht der Schwerpunkt des Buches auf geschlossenen analytischen Darstellungen der wesentlichen Sachverhalte. Alle bauphysikalischen Zusammenhänge sind in der einfachen Software Mathcad formuliert. Eine CD mit allen programmierten und jeweils beispielhaft getesteten analytischen Gleichungen - lauffähig ab "Mathcad 2001 Professional" - ist beigefügt und kann zum Rechnen, grafischen und tabellarischen Darstellen, Vorbemessen und Planen benutzt werden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 377
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Einführung
KLIMA1 Außen- und Raumklima
1.1 Außenklima
1.2 Raumklima
WÄRME2 Grundlagen des Wärmetransportes
2.1 Wärmeleitung
2.2 Wärmekonvektion
2.3 Wärmestrahlung
2.4 Gesamtwärmeübergang an einer Bauteiloberfläche
3 Thermisches Verhalten von Bauwerksteilen
3.1 Stationärer Wärmedurchgang bei mehrschichtigen Bauwerksteilen
3.2 Wärmebrücken
3.3 Dämpfung einer Temperaturwelle im Bauteil
3.4 Wärmeableitung durch Fußböden
4 Thermisches Verhalten von Räumen und Gebäuden
4.1 Thermisches Verhalten von Gebäuden während der Heizperiode
4.2 Thermisches Verhalten von Gebäuden bei freier Klimatisierung außerhalb der Heizperiode Sommerlicher Wärmeschutz
4.3 Allgemeiner Tages- und Jahresgang der Raumtemperaturen
FEUCHTE5 Hygrisches Verhalten von Bauteilen und Räumen
5.1 Grundlagen der Feuchtespeicherung und des Feuchtetransportes
5.2 Kondensatbildung im Inneren von Bauteilen
5.3 Gekoppelter Wärme- und Feuchtetransport in Baustoffen und Bauteilen
5.4 Raumluftfeuchteschwankung bei instationärer Feuchtelast unter Berücksichtigung der Feuchteabsorption der Raumumschließungsfläche
SCHALL6 Raum- und bauakustische Grundlagen
6.1 Schallausbreitung im freien Raum
6.2 Schallausbreitung im Innenraum – Raumakustik
6.3 Bauakustik
Formelzeichen, Einheiten und Indizes
Literatur zur Bauphysik
CD Bauphysik Aktiv in Mathcad
Prof. Dr.-Ing. habil. Peter HäuplTechnische Universität DresdenFakultät ArchitekturInstitut für BauklimatikZellescher Weg 1701062 Dresden
Titelfoto: City Hall, London und Denver Art Museum
Bibliografische Informationen Der Deutschen BibliothekDie Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.ddb.de> abrufbar.
ISBN 978-3-433-01842-2
©2008 Ernst & Sohn Verlag für Architektur und technische Wissenschaften GmbH und Co. KG, Berlin
Alle Rechte, insbesondere die der Übersetzung in andere Sprachen, vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form – durch Fotokopie, Mikrofilm oder irgendein anderes Verfahren – reproduziert oder in eine von Maschinen, insbesondere von Datenverarbeitungsmaschinen, verwendbare Sprache übertragen oder übersetzt werden.
All rights reserved (including those of translation into other languages). No part of this book may be reproduced in any form – by photoprint, microfilm, or any other means – nor transmitted or translated into a machine language without written permission from the publisher.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen oder sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige gesetzlich geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie als solche nicht eigens markiert sind.
Satz:+ Schiller GmbH, StuttgartDruck: betz-druck GmbH, DarmstadtBindung: Litges & Dopf Buchbinderei GmbH, Heppenheim
Klimagerechtes Bauen ist besser als baugerechtes Klimatisieren
Prof. Dr.-Ing. Dr. sc. techn. Karl Petzold (1926–2006)
Ordinarius für Bauklimatik an der Technischen Universität Dresden 1970–1991
Vorwort
Ganz plötzlich ist die Bewahrung der klimatischen Schutzfunktion der irdischen Atmosphäre zu einer politischen Schlüsselaufgabe von Weltrang geworden. Dem klimagerechten Bauen bei voller Gewährleistung der Funktionssicherung (z.B. hygienisch optimales Raumklima oder Einhaltung der von den Produktionstechnologien vorgegebenen Grenzen) und Eigensicherung (z.B. Langlebigkeit der Bauteile durch Vermeidung von Feuchteschäden) von Gebäuden kommt eine von Fachleuten längst angemahnte und häufig genug gegen Widerstände durchgesetzte, aber jetzt auch von der öffentlichen Meinung massiv vertretene Bedeutung zu.
Das Buch „Bauphysik“ ist klassisch gegliedert – Klima, Wärme, Feuchte, Schall – weicht aber in den Einzelinhalten und Vermittlungsmethoden häufig von den eingefahrenen Wegen ab und ist somit über weite Strecken keine Wiederholung gängiger oder bewährter Literatur. Bauphysikalische Normen sind aufgrund der intensiven Wissensschöpfung kurzlebig. Es wird deshalb nur recht sparsam darauf Bezug genommen, geschweige denn ein seitenlanger Normenabdruck angeboten – beim Planen liegt die aktuelle Norm sowieso am Platz.
Alle bauphysikalischen Zusammenhänge sind in der einfachen Software Mathcad formuliert. Das Arbeiten mit Mathcad verlangt eine mathematische Quantifizierung aller Aussagen. Um eine willkürliche Empirie zu vermeiden, müssen die verwendeten Gleichungen für den unter Zeitdruck lernenden und praktizierenden Ingenieur leicht verständlich und deshalb meist näherungsweise aus den physikalischen Grundgesetzen abgeleitet werden. Das betrifft zum einen zahlreiche bekannte bereits zur Innovationsferne erstarrte Formeln zum anderen aber auch die vielen neuen weit über das Normenlevel hinaus gehenden und dennoch praktikablen und plausiblen Aussagen und Anwendungen. Obgleich auf allen Gebieten der Bauphysik mehr oder weniger nutzerfreundliche Software-Tools auf der Basis numerischer Simulationsverfahren vorliegen, beruht der Schwerpunkt des Buches auf geschlossenen analytischen Darstellungen der wesentlichen Sachverhalte. Die Ergebnisse sind aber im Hintergrund mit dem genannten Werkzeug validiert worden.
Eine CD mit allen durch das „Ergibtzeichen := ” programmierten und jeweils beispielhaft getesteten analytischen Gleichungen – lauffähig ab „Mathcad 2001 Professional“ – ist beigefügt und kann zum Rechnen, grafischen und tabellarischen Darstellen, Vorbemessen und Planen benutzt werden.
Dem Verlag Ernst & Sohn sei für die Herausgabe dieser „Bauphysik“ gedankt und dem Leser, oder besser Nutzer, ein erfolgreiches Arbeiten gewünscht und versprochen. Gedankt sei auch „meinen jungen Leuten“ am Institut für Bauklimatik der Technischen Universität Dresden, die mich in den letzten 15 Jahren erzogen und gebildet haben, sowie den Drittmittelgebern der EU, der DFG, der DBU, aus der Wirtschaft, des BMVB, aber insbesondere dem Projektträger Jülich des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie.
Dresden, im Juli 2007
Peter Häupl
Einführung
Die Aufgabe der Thermophysik beim Entwerfen, Planen, Berrechnen und Errichten von Gebäuden besteht darin, das Raumklima in Wohnungs- und Gesellschaftsbauten in den von der Hygiene und in Produktionsbauten in den von der Technologie vorgegebenen Grenzen zu halten sowie die Eigensicherung und Langlebigkeit der Bauwerke, hauptsächlich durch Vermeidung von Feuchteschäden, zu gewährleisten.
Das Raumklima, das sich im Gebäude einstellt, ist das Ergebnis der Wechselwirkung zwischen dem Außenklima (Klima außerhalb des Gebäudes, Temperaturgang der Außenluft, kurz- und langwellige Strahlungsbelastung, Luftfeuchte, Wind und Niederschlag, Luftdruck), dem hygrothermischen Verhalten des Bauwerkes bzw. der einzelnen Bauteile (Wärmetransportwiderstände und Wärmespeicherverhalten, Feuchtetransportwiderstände und Feuchtespeicherverhalten), dem Lüftungsförderstrom bzw. der Luftwechselrate, den Funktionsnebenwirkungen (Innere Wärme- und Feuchtequellen durch Personen, Geräte, Verdunstung ,Beleuchtung) und den gebäudetechnischen Einrichtungen (Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen).
Das Außenklima und die Funktionsnebenwirkungen stören das thermische und hygrische Gleichgewicht des Gebäudes. Der Wärmebelastung setzt das Gebäude seine Transport- und Speicherwiderstände entgegen und dämpft die Belastungsspitzen. Durch diese Eigenschaften (vernünftige Lüftung vorausgesetzt) kann das Gebäude selbst das Raumklima während eines großen Teils des Jahres in den vorgegebenen Toleranzen halten. Reichen diese Eigenschaften nicht aus (hohe Wärme- und Feuchtebelastung, ungünstig ausgeführter Baukörper, enge Toleranzgrenzen) müssen Heizungs- und Klimaanlagen zugeschalten werden. Wegen der hohen Betriebskosten eines (klimatisierten) Gebäudes entscheidet maßgeblich sein thermisches Verhalten über dessen Wirtschaftlichkeit. Allerdings ist klimagerechtes Bauen allemal besser als baugerechtes Klimatisieren.
In Kapitel 1 werden zunächst die Komponenten des Außenklimas (in Mitteleuropa) gebäudegerecht quantifiziert und die wesentlichen hygrothermischen Anforderungen an das Raumklima festgelegt.
Das Kapitel 2 behandelt die Grundlagen des Wärmetransportes durch Wärmeleitung, Wärmeströmung und Wärmestrahlung.
Kapitel 3 beinhaltet das thermische Verhalten einzelner Bauwerksteile. Die Kenngrößen Wärmewiderstand und Wärmedurchgangswert werden ausführlich erläutert. Dieses Kapitel schließt thermische Schwachstellen im Gebäude in Form von Wärmebrücken mit ein. Ein längerer Abschnitt widmet sich den belüfteten Konstruktionen. Außerdem werden einige typische instationäre Phänomene wie Temperaturfelder bei periodischer Belastung und bei Sprungbelastung (z.B. Wärmeableitung durch Fußböden) analytisch gelöst.
Im Hauptkapitel 4 wird das thermische Verhalten des gesamten Gebäudes untersucht. Nach der Quantifizierung der Gewinn- und Verlustwärmeströme eines Gebäudes in der kalten Jahreszeit wird der Heizenergiebedarf berechnet und dem aus ökonomischen, ökologischen und baukörpergeometrischen Gründen festgelegten Grenzwert gegenübergestellt. Aus einer quasistationären, exponentiellen Aufheizung während einer fünftägigen Schönwetterperiode im Sommer werden Kriterien des sommerlichen Wärmeschutzes entwickelt. Für eine genauere Beschreibung werden die Jahres- und Tagesgänge der Empfindungstemperatur im Raum bei freier Klimatisierung näherungsweise berechnet.
Im Mittelpunkt von Kapitel 5 stehen die feuchtetechnischen Probleme am Gebäude. Sie sind hauptsächlich für die Eigensicherung von Belang. Die Möglichkeiten einer hygrischen Bemessung durch Berücksichtigung des Wasserdampftransportes und des kapillaren Feuchtetransportes im Baustoff werden vorgestellt. Bei der Simulation der Raumluftfeuchte wird neben der Stärke der Feuchtequellen und der Luftwechselrate auch die hygrische Speicherfähigkeit der Raumumschließungsfläche berücksichtigt.
Der Hauptteil 6 Schall wird in einer separaten Einführung vorgestellt und der Schallpegel im Außenund Innenraum sowie die Schalldämmung der Bauteile gewürdigt.
Alle Beziehungen werden aus einfachen physikalischen Grundgesetzen abgeleitet und unter Verwendung von Mathcad formuliert. Das heißt, daß alle Formeln mit dem Ergibtzeichen := quasi programmiert sind und zum Rechnen, Vorbemessen, Planen bzw. einer grafischen oder tabellarischen Darstellung der Ergebnisse genutzt werden können.
Eine CD mit allen programmierten analytischen Gleichungen ist beigefügt. Diese sind in „Mathcad Professional“ lauffähig. Numerische Lösungsverfahren der thermischen und hygrischen Transportgleichungen und numerische Simulationsverfahren für das hygrothermische Verhalten von Gebäuden und des Raumklimas werden nicht behandelt, dienen aber im Hintergrund zur Validierung der zahlreichen Näherungsbeziehungen.
KLIMA
1
Außen- und Raumklima
Der Begriff Klima umschließt nach einer Definition, die Alexander von Humboldt – aus geophysikalischer Sicht – gegeben hat, „alle Veränderungen der Atmosphäre, von denen unsere Organe merklich affiziert werden; solche sind: die Temperatur, die Feuchtigkeit, .“. Auf das Gebäude und seine Umgebung übertragen, lässt sich im Anschluss daran Klima definieren als die Summe aller Umweltfaktoren, die unmittelbar oder mittelbar Einfluss nehmen auf die Gesundheit und das Befinden von Menschen und Tieren, auf die Entwicklung von Pflanzen sowie auf den Zustand von Lagergütern, Produktionsverfahren, Maschinen, Apparaten und Bauwerken.
Auf den bauklimatischen Sachverhalt reduziert, ist es die Aufgabe der Gebäude
1. Mensch, Tier, Lagergut und Produktion vor den „Unbilden der Witterung“ zu schützen und
2. ein den Bedürfnissen der Nutzer genügendes Raumklima zu schaffen, ohne dass
3. dabei an den Gebäuden selbst klimabedingte Schäden entstehen.
Die Erfüllung dieser drei Forderungen kann unter dem Begriff Klimagerechtes Bauen zusammengefasst werden. Klimagerecht bauen heißt, die Bauweise, Gestalt und Konstruktion von Gebäuden sowie die Anlage von Städten und Siedlungen so an das (lokale) Außenklima anzupassen, dass mit minimalem Aufwand ein nutzungsgerechtes Raumklima sowie eine optimale Standzeit der Gebäude zu sichern sind (Petzold [12]). In Hinblick auf das klimagerechte Bauen von besonderem Interesse sind Temperatur (bzw. Wärme) und Feuchte, die sowohl das Empfinden des Menschen beeinflussen als auch häufig die Ursachen von Bauschäden sind; der Schall, der zunehmend zur Quelle von Belästigungen wird, dessen Beherrschung aber auch die Qualität von Konzert- und Vortragssälen bestimmt; und das (in diesem Buch nicht behandelte) Licht, das – sowohl als Tages- als auch als Kunstlicht In diesem Abschnitt werden die thermisch-hygrischen Komponenten des Außenklimas- Lufttemperatur, kurz- und langwelliger Strahlungswärmestrom, Partialdruck des Wasserdampfes und relative Luftfeuchtigkeit, Niederschlag, Windgeschwindigkeit und Windrichtung sowie Luftdruck- zusammenhängend dargestellt, ebenso die wärmephysiologischen Forderungen, die aus hygienischer Sicht an die thermisch-hygrischen Komponenten des Raumklimas zu stellen sind. Damit werden die baulichen Konsequenzen begründet, die sich aus der Außenklimabelastung und den wärme- und feuchtetechnischen Raumklimaforderungen ergeben. Klimagerechtes Bauen verursacht sowohl baulichen als auch energetischen Aufwand. Insbesondere der hier behandelte thermisch-hygrische Komplex beeinflusst beide Aspekte, denn es muss zeitweilig auch geheizt und evtl. auch gekühlt werden, und der dazu benötigte Energiebedarf ist von den baulichen Voraussetzungen abhängig. Um diesen Aufwand einzuschränken, sind zwei Aufgaben zu lösen:
1. Während eines möglichst großen Teiles des Jahres muss das Raumklima innerhalb der zulässigen Grenzen gehalten werden können, auch ohne dass dazu Heiz- oder Kühlenergie eingesetzt werden muss. Bei einer solchen freien Klimatisierung ist – neben dem Einfluss des Nutzers – allein die Anlage des Gebäudes, seine Gestalt und seine Konstruktion sowie die Lüftung für das Raumklima maßgebend; das Gebäude klimatisiert sich selbst (autogen). Die erforderlichen Außenklimadateien können durch Messungen im Stunden- oder im Zehnminutentakt, den Testreferenzjahren der meteorologischen Dienste oder wie in diesem Buch durch ein analytisch formuliertes Näherungsklimafile zur Verfügung gestellt werden.
2. Bei sehr eng vorgegebenen Raumklimatoleranzen, wie sie z. B. für manche Produktionsprozesse benötigt werden, sowie allgemein bei extremen Außenklimazuständen sind die an das Raumklima gestellten Forderungen durch freie Klimatisierung nicht mehr zu erfüllen (z. B. in Mitteleuropa im Winter). Es muss dann zeitweilig geheizt oder über eine Klimaanlage gekühlt werden. Bei einer solchen erzwungenen (energogenen) Klimatisierung ist das Gebäude mit ökonomisch optimalem Aufwand gegen übermäßige Wärmeverluste (im Winter) bzw. Energiezufuhr (im Sommer) zu schützen.
Zur Lösung dieser Aufgaben muss der Zugriff einzelner Klimaelemente bewusst gesteuert werden, und zwar nach dem für jedes offene System geltenden Grundsatz: so wenig „Außenwelt“ wie möglich, und nur so viel „Außenwelt“, wie unbedingt notwendig. Die Hüllkonstruktion des Gebäudes muss außerdem „erwünschten“ Klimaelementen, wie dem Tageslicht, Durchtritt gestatten „störenden“ Klimaelementen, anthropogenen oder technogenen Noxen wie dem Schall, hinreichend Widerstand entgegensetzen und ihre hygrothermische Eigensicherung garantieren. Dazu wird für das Gebäude eine bauklimatische Konzeption benötigt, nach der die Auswahl der Bauweise und der Baustoffe mit zum Teil neuer Materialcharakterisierung getroffen werden kann und die Gegenstand der konstruktiven Durchbildung ist. Aufbauen muss eine solche „Gestaltungskonzeption“ auf der Kenntnis der bauphysikalischen Wirkungsmöglichkeiten des Bauwerkes und seiner Elemente. Diese sind abhängig sowohl von den Parametern der Elemente als auch von den Randbedingungen, d.h. vom Raumklima, das für die Funktion des Gebäudes gefordert werden muss, sowie vom Außenklima, dem das Gebäude ausgesetzt ist.
1.1 Außenklima
Das wärme- und feuchtetechnische Verhalten der einzelnen Bauwerksteile und des gesamten Gebäudes wird ganzjährig, also während der Heizperiode und in der Jahreszeit mit freier Klimatisierung, vom Außenklima maßgeblich beeinflusst. Die bauklimatisch relevanten Klimakomponenten sind in Bild 1.1 als Belastung schematisch dargestellt und neben der Abbildung auch aufgelistet. Für eine bauphysikalische Bauteil- und Gebäudebemessung ist eine Quantifizierung der folgenden Außenklimakomponenten erforderlich:
- Lufttemperatur θe in °C,
- absolute Luftfeuchtigkeit x in kg Wasserdampf/kgLuft bzw. Partialdruck des Wasserdampfes,
- pD in Pa oder relative Luftfeuchtigkeit ϕe in % bzw. in 1,
- Strahlungswärmestromdichte durch kurzwellige direkte und diffuse Strahlung der Sonne,
- Gdir, Gdif sowie durch langwellige Abstrahlung und Gegenstrahlung G1 jeweils in W/m2,
- Volumenstrom- N bzw. Massenstromdichte g des Niederschlages in m3/m2s oder l/m2h bzw. kg/m2s,
- Windgeschwindigkeit vW in m/s – Windrichtung wW in ° oder in 1,
- Schlagregenstromdichte gRs (Komponente aus Wind und Niederschlag) in kg/m2s,
- Luftdruck pL in Pa.
Bild 1.1 Bauklimatische Belastung eines Gebäudes
1.1.1 Außenlufttemperatur
1.1.1.1 Jahresgang der Außenlufttemperatur
In Mitteleuropa kann der Jahresgang der Außenlufttemperatur näherungsweise durch eine harmonische Funktion (Grundschwingung) beschrieben werden. In Bild 1.2 ist der gemessene Temperaturverlauf (Stundenwerte) für Dresden im Jahr 1997 mit einer gefitteten Kosinusfunktion (1.1) dargestellt.
Die Zahlenwerte für Dresden sind:
- Jahresmitteltemperatur für die Stadt Dresden θemD=9.4°C
- Amplitude der jährlichen Temperaturschwankung ΔθeD=10.4°C
- Dauer eines Jahres Ta=365d
- Zeitverschiebung des Jahrestemperaturmaximums oder -minimums ta=15d
- Zeit t in Tagen.
(1.1)
Bild 1.2 Jahresgang der Außenlufttemperatur für Dresden gemessen (schwarz) und berechnet (hell) nach Gl. (1.1)
In Bild 1.3 werden die harmonischen Jahrestemperaturverläufe nach (1.1) für die deutschen Städte Dresden und Essen verglichen. Die Jahresmitteltemperaturen unterscheiden sich nur geringfügig. Die Jahrestemperaturschwankung ist in Essen gegenüber Dresden (eher kontinentales Klima) jedoch gedämpft (Maximum Dresden 19.8°C, Essen 17.7°C; Minimum Dresden -1.0°C, Essen +1.3°C). Die Zeitverschiebungen für das Maximum (Juli) und Minimum (Januar) beträgt jeweils etwa 15 Tage.
Zahlenwerte für Essen :
Bild 1.3 Vereinfachter Jahresgang der Außenlufttemperatur für Dresden und Essen
1.1.1.2 Simulation des tatsächlichen Temperaturganges
Der Einfluss der Tages- und Witterungsgänge auf die Außenlufttemperatur kann durch eine Überlagerung von schwerpunktmäßig drei harmonischen Funktionen mit unterschiedlichen Periodendauern und unterschiedlichen Amplituden simuliert werden. Der Tagesgang der Temperatur wird außerdem noch durch eine Exponentialfunktion etwas deformiert, um den Einfluss der Wärmespeicherfähigkeit des Erdbodens zu berücksichtigen (Ansatz (1.2), vergleiche auch Tagesgänge Bilder 1.10 bis 1.15). Die Bilder 1.4, 1.5b, 1.6, 1.7 und 1.8 zeigen das Ergebnis für Mitteleuropa: Zeit t in Tagen, Dauer des Jahres Ta = 365d, Dauer einer Witterungsperiode Tp = 10d, Dauer eines Tages Td = 1d, alle Temperaturen θ und Temperaturamplituden Δθ in °C.
Durch Änderung der genannten Parameter lassen sich näherungsweise auch Temperaturfiles für andere geografische Klimaregionen erzeugen.
θem JahresmitteltemperaturΔθeP WitterungsamplitudeΔθea JahresamplitudeΔθed Tagesamplitude(1.2)
Der durch Tagesschwankung und Witterungsablauf (Periodendauer 10 Tage) präzisierte Jahresgang der Temperatur nach (1.2) ist in Bild 1.4 dargestellt.
Bild 1.4 Simulierter Verlauf der Außenlufttemperatur in Mitteleuropa nach (1.2)
In den Bildern 1.5a, 1.5b werden die gemessenen Temperaturen für Dresden (Stundenwerte 1997 bis 2001) mit den Berechnungen nach (1.2) verglichen. Die Modellierung nach (1.2) ist bauklimatisch ausreichend genau. Natürlich können für exakte hygrothermische Bauteil- und Gebäudesimulationen die gemessenen Werte (in der Regel Stundenwerte) oder die Dateien der sogenannten Testreferenzjahre (TRY, Abschnitt 1.1.6), die für alle Klimakomponenten und für die meisten Klimagebiete der Erde vorliegen, verwendet werden.
Bild 1.5a Gemessener Verlauf der Außenlufttemperatur in Dresden
Bild 1.5b Berechneter Verlauf der Außenlufttemperatur nach (1.2) für einen Zeitraum von 4 Jahren
Den direkten Vergleich der gemessenen und berechneten Temperaturen für das Jahr 1997 zeigt Bild 1.6. Lediglich die warme erste Märzdekade 1997 wird durch die generelle Näherung (1.2) nicht gut abgebildet. Die Übereinstimmung mit den Werten des Testreferenzjahres Essen (siehe Abschnitt 1.6) befriedigt über das gesamte Jahr hinweg.
Bild 1.6 Vergleich der gemessenen Temperatur im Jahr 1997 (schwarz) mit den Rechenwerten nach (1.2) (hell)
Für eine Witterungsperiode im Juli und eine Witterungsperiode im Januar ist in den Bildern 1.7 und 1.8 der Temperaturgang nach (1.2) herausgezoomt. Die Spitzenwerte liegen bei +31°C, die Minimalwerte bei -10°C. Eine Tag- und Nachtmittelung vom Tag 193 bis Tag 195 ergibt als Höchsttemperatur 24°C. Dieser Wert wird für eine vereinfachte Sommerbemessung der Gebäude in Mitteleuropa verwendet.
Bild 1.7 Simulierter Verlauf der Außenlufttemperatur Anfang Juli nach (1.2)
Die tiefste Mitteltemperatur von -5°C ergibt sich aus einer Tag- und Nachtmittelung der Tage 13 bis 15 im Januar. Dieser Wert dient als rechnerische Wintertemperatur für die wärme- und feuchtetechnische Bauteilbemessung und für die Auslegung des Mindestwärmeschutzes in der kalten Jahreszeit.
Bild 1.8 Simulierter Verlauf der Außenlufttemperatur Mitte Januar nach (1.2)
Die Ergebnisse werden in Tafel 1.1 durch den Mittelwert für die zwei heißesten Tage im Juli (24°C), die zwei kältesten Tage im Januar (-5°C), den Jahresmittelwert (9°C), den Mittelwert über die Heizperiode Oktober bis April (199 Tage +3.4°C bzw. 185 Tage +3.0°C) und die Monatsmittelwerte komplettiert. Werden die Monatsmittelwerte aus Tafel 1.1 über der Zeit aufgetragen, ergibt sich in etwa wieder der harmonische Jahresverlauf (1.1) mit geringfügig anderen Parametern.
Tafel 1.1 Ausgewählte Temperaturwerte für die Außenluft
(1.1)
Bild 1.9 Generierter Jahresgang der Außenlufttemperatur
1.1.1.3 Tagesgang der Außenlufttemperatur
Der Tagesgang der Außenlufttemperatur wird durch den Wärmespeichereffekt des Erdbodens im Vergleich zum harmonischen Verlauf leicht deformiert. Der Aufheizvorgang am Vormittag und der Abkühlvorgang am Nachmittag lässt sich eher jeweils durch eine Exponentialfunktion beschreiben. Der Ansatz (1.2) für den Temperaturgang wird diesem Phänomen gerecht, wie die Einzelbetrachtung typischer Tagesgänge in den Bildern 1.10 bis 1.15 bestätigt.
Bild 1.10 Tagesgang der Außenlufttemperatur für einen wolkenlosen Tag (Tag 194) im Juli
Bild 1.11 Tagesgang der Außenlufttemperatur für einen heiteren Tag (Tag 195) im Juli
Bild 1.12 Tagesgang der Außenlufttemperatur für einen wolkigen Tag (Tag 197) im Juli
Bild 1.13 Tagesgang der Außenlufttemperatur für einen Regentag (Tag 199) im Juli
Bild 1.14 Tagesgang der Außenlufttemperatur für einen wolkenlosen Frosttag (Tag 13) im Januar
Bild 1.15 Tagesgang der Außenlufttemperatur für einen bedeckten Tauwettertag (Tag 19) im Januar
1.1.1.4 Summenhäufigkeit der Außenlufttemperatur
Relevant für die thermische Bemessung von Gebäuden und Bauteilen ist auch die Häufigkeit des Auftretens einer bestimmten Temperatur. Ein Maß für die Häufigkeit ist der Kehrwert der ersten Ableitung der Temperatur nach der Zeit dt/dθ (Häufigkeit in Tagen pro Temperaturinterwall). In Bild 1.16 ist für den Ansatz (1.2) dt/dθ über θ(t) aufgetragen. Durch die generierte Häufigkeitswolke wird eine Gausssche Normalverteilung (1.3) mit den angegebenen Parametern gelegt. Die Integration der Häufigkeitsverteilung über die Temperatur ergibt die Summenhäufigkeit. Die Summenhäufigkeit weist die Tage zahlenmäßig aus, die kälter als ein gewählter aktueller Temperaturwert θe sind. Die Integration der Gl. (1.3) führt auf die Fehlerfunktion z(θ) (1.4), grob kann diese durch die Gerade zG(θ) angenähert werden. In die Summenhäufigkeitsfunktion (1.4) werden die bauklimatisch relevanten Außenlufttemperaturen θe aus Tafel 1.2 eingesetzt und die Häufigkeit ihres Auftretens berechnet.
Bild 1.16 Aus Ansatz (1.2) generierte Häufigkeitsverteilung (1.3) der Außenlufttemperatur
(1.3)
(1.4)(1.5)
Die Wintertemperatur –5°C wird in Mitteleuropa an 2.5 Wochen unterschritten. Zwei Monate herrscht Frost. 6 Monate sind kälter (wärmer) als die Jahresmitteltemperatur. Die aus den thermischen Eigenschaften des Gebäudes abgeleitete Heizgrenztemperatur (Außenlufttemperatur ab der geheizt werden muss) von 10°C wird an 199 Tagen unterschritten. 3 Monate sind wärmer als 15°C, was für die Trocknung der Bauteile nach winterlichem Kondensatbefall wichtig ist. Schließlich wird an 2 Wochen im Jahr die mittlere Außenlufttemperatur von 24°C überschritten, für diesen Zeitraum soll die sommerliche Auslegung der Gebäude erfolgen. Natürlich treten die genannten Zeiträume nicht am „Stück“ auf.
Bild 1.17 Summenhäufigkeit der Außenlufttemperatur
Tafel 1.2 Bauklimatisch wichtige Außenlufttemperaturen in °C und die Häufigkeit ihres Auftretens in Tagen
-5°CWintertemperatur für den Nachweis des Mindestwärmeschutzes und des Feuchteschutzesz(-5) = 18.10°CFrost-Tauwechseltemperaturz(0) = 52.79°CJahresmitteltemperaturz(9) = 182.510°CHeizgrenztemperatur für den Nachweis des Heizwärmebedarfs eines Gebäudesz(10) = 199.615°CSommertemperatur für den Nachweis der Trocknung eines kondensatbefallenen Bauteilsz(15) = 277.524°CSommertemperatur für den Nachweis des sommerlichen Wärmeschutzes eines Gebäudesz(24) = 350.91.1.2 Wärmestrahlungsbelastung
Auf ein Gebäude wirken energetisch eine Reihe von solar verursachten Wärmestromdichten ein: direkte kurzwellige Sonnenstrahlung Gdir, diffuse kurzwellige Strahlung Gdif, zusätzlich langwellige Abstrahlung und langwellige Gegenstrahlung G1 oder Ger. Diese Strahlungswärmestromdichten reduzieren in der kalten Jahreszeit den Heizwärmeverbrauch, können aber im Sommer zu einer unzulässigen Erhöhung der Raumtemperaturen führen. Strahlung verursacht außerdem häufig eine übermäßige Erwärmung der äußeren Bauteiloberflächen verbunden mit mechanischen Spannungen und hygrischen Umkehrdiffusionseffekten. Bei Glasfassaden ergibt sich der sog. Heißglaseffekt.
Gdir und Gdif werden für eine Horizontalfläche durch einfache und für beliebig orientierte Flächen durch eine modifizierte Addition zur Gesamtstrahlung G zusammengefasst. Bei kurzwelliger Strahlung in der Bauklimatik handelt es sich um elektromagnetische Wellen, die von Flächen mit einer Temperatur von etwa 6000 K (Sonnenoberfläche) abgegeben werden. Der Maximalwert von Gdir in 2000km Höhe an der Atmosphärengrenze auf eine normal gerichtete Fläche beträgt Go=1390W/m2 (Solarkonstante). Beim Eintritt in die Atmosphäre wird diese Strahlung zum Teil absorbiert, zum Teil aber gestreut und als diffuse Strahlung energetisch wieder wirksam. Der Anteil, der bei völlig trockener und unverschmutzter Luft die Normalfläche des Gebäudes erreicht, soll Gno und der wirkliche Wert Gn genannt werden. Mit diesen Informationen lässt sich ein Trübungsfaktor Tr für die Atmosphäre wie folgt definieren:
(1.6a)(1.6b)
Wird Gl. (1.6) nach der wirklichen Wärmestromdichte umgestellt, liefert sie für die Trübungen 1 bis 6 die in Tafel 1.3 aufgelisteten Werte für Gn in W/m2.
Tafel 1.3 Trübung und an der Erdoberfläche ankommende Leistung
Bei Tr = 6 erreicht also nur noch die Hälfte (Gn=585 W/m2) der Strahlung bei sauberer Luft (Gno=1175W/m2) die Erdoberfläche.
1.1.2.1 Kurzwellige Strahlungswärmestromdichte auf eine Horizontalfläche
Bild 1.18 zeigt die gemessene Gesamtstrahlungswärmestromdichte G in W/m2 auf eine Horizontalfläche in Dresden (innere Neustadt, Trübung etwa 4) für den Zeitraum 1996 bis 2001.
Bild 1.18 Gemessene Gesamtwärmestrahlungsstromdichte auf eine Horizontalfläche
Durch eine Überlagerung von Tages-, Witterungs- und Jahresgang lässt sich der Strahlungsverlauf ebenfalls näherungsweise mathematisch darstellen, wobei die Tageslänge D(t) (Zeit zwischen Sonnenauf- und Sonnenuntergang) mit der nachfolgenden Heavisideschen Sprungfunktion simuliert wird: Φ(t) = 1 für t > 0, Φ(t) = 0 für t < 0. Von dieser Funktion wird in späteren Abschnitten immer wieder Gebrauch gemacht.
Tageslängenfunktion in Abhängigkeit von der Jahreszeit:
Darin ist h der Höhenwinkel der Sonne über dem Horizont. Er wird in Abschnitt 1.2.2 berechnet. Für h > 0, scheint die Sonne (Tag) und D(t) = 1, für h < 0 steht die Sonne unter dem Horizont (Nacht) und D(t) = 0.
(1.7)
Bild 1.19 Sonnenscheindauer (Tageslängenfunktion) in Abhängigkeit von der Jahreszeit für 52° Nord
Ähnlich wie bei der Außenlufttemperatur wird für die kurzwellige direkte Strahlung auf eine Horizontalfläche ein Verlauf mit signifikanten periodischen Anteilen (Jahresgang, Tagesgang, Witterungsgang) in Anlehnung an die Messungen angesetzt (Trübung etwa 4, Zeit in d, G und ΔG in W/m2):
(1.8)
Die kurzwellige diffuse Strahlung auf eine Horizontalfläche für Mitteleuropa (Trübung ebenfalls etwa 4) wird mit den gleichen Argumenten wie folgt angenähert:
(1.9)
Bild 1.20 Kurzwellige direkte Strahlungswärmestromdichte in W/m2 auf eine Horizontalfläche nach (1.8)
Bild 1.21 Kurzwellige diffuse Strahlungswärmestromdichte in W/m2 auf eine Horizontalfläche nach (1.9)
Daraus ergibt sich der Jahresgang für die kurzwellige Gesamtstrahlungswärmestromdichte auf eine Horizontalfläche für Mitteleuropa (Trübung etwa 4):
(1.10)
Eine Mittelung der Gesamtstrahlung auf eine Horizontalfläche über die winterliche Heizperiode von Oktober (Tag –84) bis April (Tag +101) ergibt 53 W/m2, eine Mittelung über eine Schönwetterperiode von 5 Tagen im Juni (Tage 173 bis 178) ergibt 275 W/m2.
Näherungsweise kann der Jahresgang der Gesamtstrahlung auf eine Horizontalfläche, wie die Außenlufttemperatur auch, durch eine einfache harmonische Funktion dargestellt werden. Das Maximum liegt im Juni, das Minimum im Dezember. Die Mittelung über die Heizperiode ergibt mit den angegebenen Werten ebenfalls 53 W/m2.
(1.11)
Bild 1.22 Kurzwellige Gesamtstrahlungswärmestromdichte (dunkel) einschl. der Mittelungsfunktion (hell) nach (1.11) in W/m2, auf eine Horizontalfläche
1.1.2.2 Strahlungswärmestromdichte auf beliebig orientierte und geneigte Flächen
Aus den Strahlungswerten der direkten Strahlung auf die Horizontalfläche lässt sich die direkte Strahlung auf eine beliebige Bauteilfläche (charakterisiert durch den Winkel β zur Nordrichtung und die Neigung α) in Abhängigkeit vom Sonnenstand (charakterisiert durch Höhenwinkel h und den Azimutwinkel a) berechnen.
In Bild 1.23 sind alle erforderlichen Winkel zwischen Sonnenstrahl (direkte Strahlung) und Bauteilflächennormale dargestellt. Daraus wird eine im Jahresgang veränderliche Winkelhilfsfunktion abgeleitet, mit der die Strahlung auf eine Horizontalfläche multipliziert werden muss, um die Strahlungswärmestromdichte auf eine beliebig orientierte und geneigte Fläche einschließlich der Eigenverschattung auszuweisen.
Bild 1.23 Winkelbeziehungen zwischen direkter Sonnenstrahlung und Gebäude, mit:
h Höhenwinkel der Sonne – Winkel zwischen Sonnenstrahl und dessen „Schatten“ auf die Horizontalfläche
a Azimutwinkel der Sonne – Winkel zwischen dem „Schatten des Sonnenstrahls“ und der Nordrichtung
β Winkel zwischen Flächennormale und Nordrichtung
α Neigungswinkel der Dachfläche
G horizontal Strahlungswärmestromdichte der direkten Sonnenstrahlung auf eine Horizontalfläche in W/m2
Daraus folgt die direkte Strahlungswärmestromdichte der Sonne auf eine beliebige Bauteilfläche
(1.12)
Gl. (1.12) ist mit der Sprungfunktion für Sonnenauf- und Sonnenuntergang sowie zusätzlich für die Eigenverschattung (Sonne verschwindet hinter dem Gebäudewinkel) zu multiplizieren. Außerdem sind der Sonnenhöhenwinkel h und der Azimutwinkel a in Abhängigkeit von der geografischen Lage (Breitengrad χ) und der Jahreszeit darzustellen. Diese Prozedur ist etwas aufwendig:
Bild 1.24 Tagesgang des Höhenwinkels der Sonne am Tag 172 (Sommertag)
(1.13)
(1.14)
(1.15)
Bei der Berechnung des Azimutwinkels ist der Vorzeichenwechsel (Signum- oder +/- Funktion) von A(t) zu beachten. Daraus folgen A1(t) und der im Tagesverlauf stetig zunehmende Azimutwinkel a2(t) (Bilder 1.27 und 1.28).
(1.16)
Bild 1.25 Tagesgang des Höhenwinkels der Sonne am Tag 355 (Wintertag)
Bild 1.26 Jahresgang der Deklination der Sonne
Bild 1.27 Tagesgang des Azimutwinkels der Sonne am Tag 355 (Wintertag)
Bild 1.28 Tagesgang des Azimutwinkels der Sonne am Tag 172 (Sommertag)
Die Winkelhilfsfunktion (1.17) (letzter Term in Gl. (1.13)) ist zu berechnen und zunächst mit der Sonnenscheindauerfunktion (Tageslängenfunktion D(t)) für die direkte Strahlung auf eine Horizontalfläche in Abhängigkeit vom Höhenwinkel h (1.8) zu multiplizieren. Daraus folgt die Winkelhilfsfunktion B1(t,β) (1.18) für die direkte Strahlung.
Mit Gl. (1.19) wird eine Eigenverschattungsfunktion S2(t, α, β) (Bauteilneigung α hier beliebig) definiert. Sie hat den Wert 1 solange die Sonne wirklich die Bauteilfläche bescheint, ansonsten verschwindet sie. Daraus ergibt sich die Winkelhilfsfunktion B2(t, β) (1.20) für die direkte Strahlung auf eine zunächst vertikale Bauteilfläche mit Tageslängen- und Eigenverschattungsfunktion.
(1.17)
(1.7)
(1.18)
(1.19)
Breitengrad 52° Nord
(1.20)
In den Bildern 1.29 bis 1.31 ist die Winkelhilfsfunktion B2(t, β) für eine vertikale Wand (α=π/2) mit unterschiedlicher Himmelsrichtung (β) dargestellt. Es sei noch einmal darauf hingewiesen, dass mit dieser Funktion die in der Regel vorliegende Strahlungswärmestromdichte auf eine Horizontalfläche multipliziert werden muss, um die Strahlungswärmestromdichte auf eine beliebig (β) orientierte Vertikalfläche zu berechnen.
Schließlich ist in Bild 1.32 die B-Funktion für ein geneigtes Dach (hier β=54°) dargestellt.
Bild 1.29 Winkelhilfsfunktion für eine vertikale Fläche in Abhängigkeit von der Orientierung (Haupthimmelsrichtungen) β für den Tag 172 (Sommertag)
Bild 1.30 Winkelhilfsfunktion für eine vertikale Fläche in Abhängigkeit von der Orientierung β für den Tag 172 (Sommertag)
Bild 1.31 Winkelhilfsfunktion für eine vertikale Fläche in Abhängigkeit von der Orientierung β für den Tag 355 (Wintertag)
Abschließend wird die allgemeine Winkelhilfsfunktion (1.21) für eine beliebig orientierte und geneigte Fläche mitgeteilt und der Verlauf exemplarisch für eine Dachneigung von 54° für den Tag 172 (vgl. Bild 1.29) im Bild 1.32 aufgezeichnet. Sie findet ihre Anwendung in den Strahlungsleistungsberechnungen, Bilder 1.39 bis 1.42.
(1.21)
Bild 1.32 Winkelhilfsfunktion für eine 54° geneigte Dachfläche in Abhängigkeit von der Orientierung β für den Tag 172 (Sommertag)
Mit den diskutierten Winkelhilfsfunktionen ergibt sich schließlich für eine beliebig orientierte (β) und beliebig geneigte (α) Bauteilfläche für die direkte Strahlungswärmestromdichte G αß(t)
(1.22)
Die diffuse Strahlung ist lediglich vom Neigungswinkel a abhängig, mit einem empirischen Ansatz folgt für die Gesamtstrahlung auf eine beliebige Bauteilfläche:
(1.23)
Bild 1.33 Jahresgang der Gesamtstrahlungswärmestromdichte nach (1.23) auf eine Nordwand
Bild 1.34 Tagesgang (Tag 174, wolkenloser Sommertag im Juni) der Gesamtstrahlungswärmestromdichte nach (1.23) auf eine Nordwand
Bild 1.35 Jahresgang der Gesamtstrahlungswärmestromdichte nach (1.23) auf eine Ostwand
Bild 1.36 Tagesgang (Tag 174, wolkenloser Sommertag im Juni) der Gesamtstrahlungswärmestromdichte nach (1.23) auf eine Ostwand
Bild 1.37 Jahresgang der Gesamtstrahlungswärmestromdichte nach (1.23) auf eine Südwand
Bild 1.38 Tagesgang (Tag 174, wolkenloser Sommertag im Juni) der Gesamtstrahlungswärmestromdichte nach (1.23) auf eine Südwand
Die Bilder 1.39 bis 1.42 zeigen die direkte (dünn, schwarz) und die gesamte (rot) Strahlungswärmestromdichte auf ein um 54° geneigtes Steildach (vgl. Bild 1.32) in Abhängigkeit von der Himmelsrichtung und für verschiedene Tage im Jahr (Strahlungstage aus Ansatz (1.22) und (1.23)). Zum Vergleich ist die Gesamtstrahlung auf eine Horizontalfläche (blau) ebenfalls eingetragen. Der Breitengrad beträgt wie bisher in allen Abbildungen 52° Nord.
Bild 1.39 Tagesgang (Februar, Tag 35) der direkten und Gesamtstrahlungswärmestromdichte auf unterschiedlich orientierte Flächen
Bild 1.40 Tagesgang (April,Tag 95) der direkten und Gesamtstrahlungswärmestromdichte auf unterschiedlich orientierte Flächen
Bild 1.41 Tagesgang (Mai, Tag 135) der direkten und Gesamtstrahlungswärmestromdichte auf unterschiedlich orientierte Flächen
Bild 1.42 Tagesgang (Juni, Tag 174) der direkten und Gesamtstrahlungswärmestromdichte auf unterschiedlich orientierte Flächen
Für die wärmetechnische Bemessung der Bauteile und Gebäude während der winterlichen Heizperiode von 185 Tagen und einer sommerlichen Hitzeperiode von 5 Tagen sind die Mittelwerte durch Integration über die Strahlungswärmestromdichten G(t,α,β) nach (1.23) in Tafel 1.4 zusammengestellt. Um eine mathematische Konvergenz der Zeitintegrale zu erreichen, schwanken die Grenzen geringfügig.
Tafel 1.4 Strahlungsbelastungen nach (1.23) in W/m2 auf Wände und Dächer
Daraus ergeben sich die gerundeten Werte in Tafel 1.5 für die mittleren Strahlungswärmebelastung der unterschiedlich orientierten Bauteilflächen. Sie können zur Quantifizierung des Heizwärmebedarfs (Teil WÄRME) während der Heizperiode und zur Berechnung der Raumtemperaturen bei freier Klimatisierung außerhalb der Heizperiode (Abschnitt 3.3) benutzt werden .
Tafel 1.5 Wichtige mittlere Strahlungsbelastungen in W/m2 auf Wände und Dächer
In den Bildern 1.43 und 1.44 wird die Abhängigkeit der Gesamtstrahlungswärmestromdichte vom Bedeckungsgrad verdeutlicht. Sie enthalten den Strahlungsgang auf eine Ostwand für eine Witterungsperiode im Juni (Tage 170 bis 175) und im Dezember (Tage 355 bis 360).
Bild 1.43 Gesamtwärmestromdichte im Juni (Tage 170 bis 175) in Abhängigkeit vom Bedeckungsgrad
Bild 1.44 Gesamtwärmestromdichte im Dezember (Tage 355 bis 360) in Abhängigkeit vom Bedeckungsgrad
Abschließend werden einige Befunde zur Korrespondenz zwischen Strahlung, Außenlufttemperatur und Regen aufgezeigt. An wolkenlosen Strahlungstagen ergibt sich auch die größte Tagesschwankung der Außenlufttemperatur und umgekehrt. Für die Temperaturkurve (dunkel) entspricht die Zahl 200 an der Ordinate 20°C.
Bild 1.45 Gesamtstrahlungswärmestromdichte auf eine Horizontalfläche und Außenlufttemperatur im Juni (Tage 175 bis 180) in Abhängigkeit vom Bedeckungsgrad
Bild 1.46 Gesamtwärmestromdichte auf ein Südostdach (45°) im Juni (Tage175 bis 178) in Abhängigkeit vom Bedeckungsgrad und modifiziert durch Regenereignisse am Tag 176
Durch Regenschauer erfährt die direkte Strahlung natürlich Einbrüche (Bild 1.46, Tag 176). Die direkte Strahlung nach (1.22) wird für Regenereignisse nach Gl. (1.32) in Abschnitt 1.4.1 mittels Heaviside-Funktion Φ null gesetzt. Damit stehte ein allgemeines File für die kurzwellige Strahlung zur Verfügung.
Trägt man die Gesamtwärmestromdichte auf eine Horizontalfläche über der Temperatur für das gesamte Jahr auf, zeigt die Häufigkeitswolke: Hohe Temperaturen gehören zu hohen Strahlungswerten, niedrige Strahlungswerte treten aber sowohl im Winter als auch im Sommer auf. Zwischen Temperatur und Strahlung existiert eine jährliche Phasen- bzw. Zeitverschiebung. Die durchgezogene Kurve stellt den Tagesmittelwert der Gesamtstrahlung auf eine horizontale Fläche, Gl. (1.12), über den Tagesmittelwerten der Temperatur, Gl. (1.1) dar.
Bild 1.47 Häufigkeitsverteilung der Gesamtwärmestromdichte auf eine Horizontalfläche in Abhängigkeit von der Außenlufttemperatur
1.1.2.3 Langwellige Abstrahlung
Der langwellige Wärmestrahlungsaustausch zwischen Bauteiloberfläche und Umgebung findet zwischen Flächen mit Temperaturen von etwa 300K statt. Wolken und bebaute Umgebung haben etwa die gleiche Temperatur, so dass kaum eine langwellige Abstrahlung auftritt. Die Temperatur des klaren Himmels liegt deutlich tiefer und dessen Emissionsgrad ε ist wellenlängenabhängig (ε<1 im langwelligen Bereich), woraus sich Leistungsverluste bei Horizontalflächen bis 110 W/m2 ergeben. Die resultierende langwellige Abstrahlung ist im Folgenden in Abhängigkeit von der Witterung (Bedeckungsgrad) mathematisch als Jahresgang (1.24) vereinfacht simuliert.
(1.24)
Bild 1.48 Integrale langwellige Abstrahlung in Abhängigkeit vom Witterungsverlauf bzw. Bedeckungsgrad
Als Jahresmittelwert ergibt sich für eine Horizontalfläche etwa 33W/m2. Für Vertikalflächen liegt der Wert wegen des kleineren Raumwinkels des Himmels nur bei etwa 12W/m2. Die letzten beiden Abbildungen zeigen den Jahresgang sowie den Verlauf für 10 Wintertage der Totalstrahlung (kurzwellig und langwellig) auf eine Horizontalfläche für Mitteleuropa, 52°Nord.
Bild 1.49 Jahresgang der totalen Wärmestromdichte in W/m2 (kurz- und langwellig) auf eine Horizontalfläche
Bild 1.50 Verlauf aller Strahlungswärmestromdichten (kurz-und langwellig) auf eine Horizontalfläche im Winter (Tage 355 bis 365)
1.1.3 Wasserdampfdruck und relative Luftfeuchtigkeit
In der Außen- und in der Raumluft ist grundsätzlich immer auch Wasserdampf, ein unsichtbares geruchloses und nichttoxisches Gas, enthalten (siehe auch Teil FEUCHTE). Der Anteil wird in x kg Wasserdampf/1kg Luft angegeben oder durch seinen Partialdruck pD in Pa gekennzeichnet. Die relative Luftfeuchte ϕ ist definiert als Verhältnis von Partialdruck des Wasserdampfes pD in der Luft zum Sättigungsdruck ps des Wasserdampfes. Der maximal auftretende Dampfdruck ps ist laut Phasenumwandlungsgesetzen der Thermodynamik sehr stark von der Temperatur abhängig, so dass außenklimatisch zwischen Tag und Nacht starke Schwankungen der relativen Luftfeuchte auftreten können. Einige physikalische Zusammenhänge zwischen x, p, θ und Φ werden im Rahmen der Ableitung der Mollierschen Enthalpie-Wasserdampfgehalts-Funktion (h-x-Diagramm) in Abschnitt 2.2.2 besprochen.
1.1.3.1 Wasserdampfsättigungsdruck
Im Folgenden (Bild 1.51, Tafel 1.6) ist die Abhängigkeit von ps von der Temperatur für θ<0°C (Sublimationskurve) und θ>0°C (Sättigungsdruckkurve) grafisch und tabellarisch dargestellt. Die Gl. (1.25) und (1.26) geben analytische Berechnungsmöglichkeiten für den Sättigungsdruck in Abhängigkeit von der Temperatur an. In (1.27) sind sie mittels Heavisidescher Sprungfunktion zusammengefasst.
(1.26 a)
(1.26 b)
Bild 1.51 Wasserdampfsättigungsdruck in Abhängigkeit von der Temperatur
(1.27)
Bei Verwendung der Rechenkurven für den Jahresgang der Außenlufttemperatur (1.2) ergibt sich mit (1.27) näherungsweise der in Bild 1.52 veranschaulichte Jahresgang des Wasserdampfsättigungsdruckes in der mitteleuropäischen Atmosphäre. In den Bildern 1.53 und 1.54 ist der Wasserdampfsättigungsdruck in der Atmosphäre noch einmal für Januar und Juli dargestellt.
Bild 1.52 Genäherter Jahresgang des Wasserdampfsättigungsdruckes in der Außenluft in Mitteleuropa
Bild 1.53 Vereinfachter Verlauf des Wasserdampfsättigungsdruckes im Januar nach (1.27)
Bild 1.54 Vereinfachter Verlauf des Wasserdampfsättigungsdruckes im Juli nach (1.27)
Tafel 1.6 Wasserdampfsättigungsdruck in Abhängigkeit von der Temperatur
1.1.3.2 Tatsächlicher Wasserdampfdruck
Der tatsächliche Dampfdruckverlauf pD(t) im Laufe eines Jahres wird entsprechend dem tatsächlich vorhandenen absoluten Feuchtegehalt x in der Atmosphäre durch Überlagerung von harmonischen Funktionen dem Wetterablauf nachempfunden, Ansatz (1.28) und ist in Bild 1.55 grafisch dargestellt, Druckwerte und Druckamplituden in Pa. Übersteigt der Partialdruck nach (1.28) den Sättigungsdruck (1.27), so wird p=ps gesetzt (1.29).
(1.28)
(1.29)
Bild 1.55 Vereinfachter Jahresgang pD(t) des Wasserdampfdruckes in Pa in der Außenluft in Mitteleuropa nach (1.29)
1.1.3.3 Relative Luftfeuchtigkeit
Der Quotient aus Druck und Sättigungsdruck ergibt schließlich den Jahresverlauf für die relative Luftfeuchte (1.30), wobei bei Regenereignissen (s. Abschnitt 1.4) ϕ=1 (mittels Sprungfunktion Φ) gesetzt wurde. In grober Näherung lässt sich auch hier der Jahresgang durch eine harmonische Funktion (1.31) darstellen:
(1.30)
(1.31)
Wegen der niedrigen Temperaturen und damit verbundenen geringen Wasserdampfaufnahme (kleiner Sättgungsdrack ps) ist die relative Luftfeuchte der Außenluft im Winter grundsätzlich hoch. Im Sommer folgt sie den größeren temperaturabhängigen Sättigungsdruckschwankungen und liegt somit zwischen 25 und 100%. Die gemessenen Luftfeuchten stimmen mit den berechneten Werten nach (1.30) prinzipiell überein.
In Bild 1.59 sind die Temperaturen in Korrespondenz zu den Dampfdrücken als Häufigkeitswolke aufgetragen. Das Ergebnis entspricht der Darstellung atmosphärischer Zustände im Enthalpie-Wasserdampfgehaltsdiagramm (h-x-Diagramm, s. Abschnitt 2.2.2). Die untere Grenzkurve ist identisch mit der Sättigungsdruckkurve.
Bild 1.56 Jahresgang der relativen Luftfeuchte nach (1.30) und (1.31)
Bild 1.57 Gemessene relative Luftfeuchte für Dresden im Jahre 1997
Bild 1.58 Vergleich der nach (1.30) berechneten (hellgrau) mit den gemessenen (schwarz) Luftfeuchten Januar/ Februar 1997
Bild 1.59 Lufttemperatur in Abhängigkeit vom Wasserdampfpartialdrack
1.1.4 Niederschlag und Wind
1.1.4.1 Regenstromdichte
Niederschlag und Wind sind stochastisch wechselnde Größen. Bauklimatisch relevant für feuchtetechnische Bemessungen äußerer Bauteiloberflächen hinsichtlich eindringenden Schlagregens in Verbindung mit der Windgeschwindigkeit und der Windrichtung ist zunächst die Regenstromdichte gR=dmR/dtA in kg/m2s bzw. als Volumenstromdichte N=dVR/dtA in m3/m2s oder in l/m2h. Bild 1.60 zeigt die Messwerte auf eine Horizontalfläche für Dresden 1997. Die größten Regenmengen treten in Mitteleuropa im Juli/August auf.
Bild 1.60 Gemessene Regenstromdichte auf eine Horizontalfläche in l/m2h in Dresden 1997
Bild 1.61 enthält zum Vergleich die grafische Darstellung einer mathematischen Regensimulation nach Gl. (1.32) (Cp(t) „Regenstundenfunktion“). Das Zeitintegral ergibt die Jahresniederschlagsmenge in m3/m2, die hier mit der gemessenen Jahresmenge von 635mm aus Bild 1.60 übereinstimmt. Durch Variation der Parameter können wie bei den bereits besprochenen Außenklimakomponenten Temperatur, Wärmestrahlung und Luftfeuchtigkeit andere Niederschlagsfiles erzeugt werden (N und ΔN in m3/m2h, t, Td, Tp, Ta in Tagen).
(1.32)
Jahresniederschlagsmenge nach (1.32) in m3/m2:
Bild 1.61 Simulierte Regenstromdichte nach (1.32) auf eine Horizontalfläche in m3/m2h
1.1.4.2 Windgeschwindigkeit und Windrichtung
In ähnlicher Weise werden Windgeschwindigkeit und Windrichtung in Anpassung an Messwerte simuliert. Die Geschwindigkeit v1(t) in m/s und die Richtung in Form der Winkelfunktion w(t) (gemessen in Bogenmaß) werden ebenfalls grafisch dargestellt.
(1.33)
Die mittlere Windgeschwindigkeit vmittel beträgt in etwa 3m/s. Dieser Wert liegt z.B. der Berechnung des konvektiven Wärmeübergangs an der Außenoberfläche von Bauteilen und der Abschätzung windbedingter Luftwechselraten in den Gebäuden zugrunde.
Bild 1.62 Windgeschwindigkeit in m/s nach (1.33), Mittelwert etwa 3m/s
Gl. (1.34) beinhaltet die mathematische Beschreibung der Windrichtung. Der Jahresmittelwert der Windrichtung wmittel liegt bei 180°, wenn die Ostrichtung 0° entspricht, d.h. der Wind weht aus westlicher Richtung. In den Bildern 1.65 bis 1.66 sind die Windvektoren mit Betrag und Länge in einem Kreisdiagramm (Windrose) dargestellt.
(1.34)
Bild 1.63 Windrichtung in Bogenmaß gegenüber der Ostrichtung nach (1.34)
Abschließend werden einige Monatssituationen in Form von Häufigkeitsverteilungen und Windrosen diskutiert. In Bild 1.64 ist die Windgeschwindigkeit über der Windrichtung in Gradmaß (Kreisdiagramm) bzw. in Bogenmaß (Winkel w in 1, 1=57.3°) aufgetragen.
Bild 1.64a Windrichtung im April, der mittlere Winkel beträgt 176°, es herrscht WNW Wind
Bild 1.64 b Windrichtung im Mai, der mittlere Winkel beträgt 56°, es herrscht NO Wind
Bild 1.64 c Windrichtung im November, der mittlere Winkel beträgt 224°, es herrscht SW Wind
Windgeschwindigkeit und Windrichtung beeinflussen die Druckverhältnisse am Gebäude und damit die Durchströmung eines Gebäudes und die Luftwechselrate sowie den Lüftungswärmeverlust während der Heizperiode bzw. die Raumlufttemperatur während einer sommerlichen Hitzeperiode. In Verbindung mit dem Niederschlag lässt sich die Schlagregenbeanspruchung (kapillare Wasseraufnahme der Wetterschutzschichten und Fugenabdichtungen) quantifizieren.
Bild 1.65 Jahreswindrose, wie in Bild 1.64 ermittelt, beträgt der mittlere Jahreswinkel etwa 180°, Westwind ist vorherrschend.
1.1.4.3 Windniederschlagsgebiete
Die Wind-Regen-Beanspruchung lässt sich durch folgende einfache Wetterschutzkriterien grob charakterisieren:
Der sogenannte Windniederschlagsindex WNI ergibt sich aus dem Produkt von jährlicher Niederschlagsmenge und mittlerer Windgeschwindigkeit. Er ist ein einfaches und aussagekräftiges Wetterbelastungskriterium:
(1.35)
Bild 1.66 Niederschlagskarte bzw. Wetterschutzgebiete für Deutschland
1.1.5 Schlagregenstromdichte auf eine vertikale Gebäudefläche
Aus Niederschlagsmenge, Windgeschwindigkeit und Windrichtung soll der Vektor der Regenstromdichte (Schlagregen) in kg/m2s oder kg/m2h senkrecht zur Bauteiloberfläche als Grundlage für eine wetterschutztechnische Bemessung und die Quantifizierung des eventuell eindringenden Schlagregens näherungsweise berechnet werden. Auf einen Regentropfen im ungestörten Windfeld wirken die vertikale Schwerkraft Fg, die horizontale Windkraft Fw und die Reibungskraft Fr (vL Windgeschwindigkeit):
Bild 1.67 Schematische Darstellung der Regengeschwindigkeit auf eine Westwand
(1.36)
(1.37)
(1.38)
Aus dem Kräftegleichgewicht (1.36) folgen die resultierende Geschwindigkeit vR der Regentropfen und der vertikale Richtungswinkel av des Geschwindigkeitsvektors vR bzw. der Regenstromdichte gR zur Bauteilflächennormalen. Wird die Windgeschwindigkeit vL=0, fällt der Regen senkrecht nach unten, d.h. cosαϖ=0 bzw. αv=π/2. Die Geschwindigkeit der Regentropfen beträgt dann vR=8.4m/s für den Regentropfenradius r=1mm und den Widerstandsbeiwert für den Regentropfen c=0.3.
Die Bilder 1.68 und 1.69 zeigen die resultierende Regengeschwindigkeit vR (1.37) und den Richtungswinkel αv (1.38) in Abhängigkeit von der Windgeschwindigkeit vL und dem Radius r des Regentropfens. Windgeschwindigkeit, Halbmesser und Widerstandsbeiwert der Regentropfen sind:
Bild 1.68 Resultierende Regengeschwindigkeit vR(vL,r) nach (1.37)
Der Vertikalwinkel αv der Regenstromdichte bzw. der Regentropfengeschwindigkeit zur Flächennormalen vertikaler Gebäudeflächen ergibt sich nach (1.39)
(1.39)
Bild 1.69 Grafische Darstellung des Vertikalwinkels av (αv in Gradmaß) nach (1.39)
Die Normalkomponente der Regenstromdichte, die auf eine Bauteilfläche auftrifft, hängt nicht nur vom berechneten Winkel (1.39) av, sondern auch von der Windrichtung, gekennzeichnet durch den Winkel β zur Nordrichtung ab, es folgt Gl. (1.40).
(1.40)
Bild 1.70 Normalkomponente der Regenstromdichte – Schlagregenstromdichte, schematisch
Schließlich lässt sich der Winkel αh zwischen der Regenstromdichte und der Flächennormalen einer horizontalen Bauteilfläche (s. auch Bild 1.69) analog Gl. (1.39) berechnen, daraus folgt Gl. (1.41).
(1.41)
Bild 1.71 Winkel αh der Regenstromdichte zur Flächennormalen einer horizontalen Bauteilfläche
Aus der Regengeschwindigkeit VR lässt sich näherungsweise die Regenstromdichte berechnen. Die in der Zeit dt transportierte Regenmasse dmR ergibt sich aus der Masse eines Tropfens multipliziert mit der Tropfenzahl d.h. die Zahl der Tropfen dn wächst in etwa mit r½ und mit der resultierenden Regengeschwindigkeit (1.42). Daraus folgen für die Regenstromdichte im freien Feld in kg/m2s (1.43) und (1.44). Weht kein Wind vL=0, vereinfacht sich gR zu (1.45). Stellt man (1.45) nach r um folgt (1.46). Der mittlere Radius des Regentropfens wächst mit der vierten Wurzel aus der Regenstromdichte. Ersetzt man r durch vR mittels Gl. (1.37) ergibt sich (1.47): Die mittlere Regengeschwindigkeit wächst mit der achten Wurzel aus der Regenstromdichte.
(1.42)
(1.43)
(1.44)
(1.45)
(1.46)
(1.47)
In Bild 1.72 ist die Regenstromdichte in kg/m2s im freien Feld nach (1.44) für realistische Parameterwerte dargestellt. Die Beziehung (1.45) bis (1.47) gelten nur im freien Feld, also im großen Abstand vom Gebäude. Das Gebäude selbst ist von einem komplizierten Strömungsfeld umgeben. Hier wird lediglich eine einfache Grenzschicht der Dicke L betrachtet, in der die Regentropfen abgebremst werden (Bild 1.73).
Bild 1.72 Regenstromdichte im freien Feld in Abhängigkeit von der Windgeschwindigkeit, Regentropfenradius als Parameter
Das führt zu einer Abminderung der Normalkomponente der Regenstromdichte auf die Bauteilfläche auf den Wert gRhs. Die Abminderung wird durch den Faktor DR, die wichtigste Kenngröße in diesem Abschnitt charakterisiert. gRhs stellt die eigentliche Belastung der vertikalen Bauteilfläche mit Regen dar. DR soll im folgenden abgeschätzt werden. Die Horizontalkomponente der Regentropfengeschwindigkeit vR wird durch eine quadratische Reibungskraft, siehe (1.36) abgebremst, (1.49). Die Lösung (Ortskoordinate x(t)) dieser einfachen Bewegungsgleichung lautet (1.50). Daraus ergibt sich die Regentropfengeschwindigkeit (1.51) bzw. mit (1.47) die Regenstromdichte (1.52) direkt an der Fassade:
(1.48)
(1.49)
(1.50)
(1.51)
(1.52)
Die Breite der Grenzschicht L wird mittels mechanischem Energieerhaltungssatz abgeschätzt. Die anfängliche Windenergie im Volumen der Grenzschicht ergibt sich nach (1.53), wobei durch die Querschnittsverengung laut Kontinuitätsgleichung zunächst eine Erhöhung der Strömungsgeschwindigkeit erfolgt. Allerdings wird ein Teil der Bewegungsenergie durch die Arbeit der Reibungskräfte (ηL Zähigkeit der Luft) in der Grenzschicht abgebaut. Daraus folgt als Breite für die Grenzschicht die Gleichung (1.54).
Wird die Grenzschichtbreite L in (1.51) eingesetzt, ergibt sich schließlich mit der Beziehung r(gR)=B.gR0.25 (1.46) für die Schlagregenstromdichte (Normalkomponente der Regenstromdichte unmittelbar auf der Bauteiloberfläche) die wichtige Gleichung (1.55). Die geschilderte vereinfachte Situation ist im Bild 1.73 schematisch dargestellt.
In Gl. (1.55) lässt sich der Abminderungsfaktor DR zur Berechnung der wirklich an der Gebäudeoberfläche ankommenden Regenstromdichte in Abhängigkeit der Windgeschwindigkeit und der auf eine Horizontalfläche auffallenden Regenstromdichte (1.56) abspalten. Die Konstante E ist abhängig vom Widerstandsbeiwert c des Regentropfens, von der Luftdichte ρL und der Luftzähigkeit ηL, von der Wasserdichte ρW und der Erdbeschleunigung.
(1.53) BewegungsenergieKontinuitätsgleichung
Reibungsarbeit
(1.54) Grenzschichtbreite
Bild 1.73 Schematische Darstellung der Strömungsgrenzschichten am Gebäude
(1.55)
(1.56)
In den Bildern 1.74 und 1.75 ist der Abminderungsfaktor zur Berechnung der Schlagregenstromdichte (Normalvektor der Regenstromdichte auf die Westwand) dargestellt. Die Abminderung ist insbesondere bei kleinen Windgeschwindigkeiten und kleinen Regenstromdichten erheblich.
Bild 1.74 Abminderungsfaktor DR für den Schlagregen in Abhängigkeit von der Windgeschwindigkeit, Regenstromdichte in kg/m2h als Parameter
Bild 1.75 Abminderungsfaktor für den Schlagregen in Abhängigkeit von der Regenstromdichte gR in kg/m2h, Windgeschwindigkeit vL in m/s als Parameter
Abschließend sollen die Ergebnisse auf das Regen- und Windfile des Abschnittes 1.4 angewandt werden. Die Regenstromdichte wird durch die Niederschlagsmenge N1(t), die Windgeschwindigkeit durch v1(t) und die Windrichtung β durch w(t) Gl. (1.32) bis (1.34) ersetzt. Daraus folgt der Abminderungsfaktor in Abhängigkeit von der Zeit (1.57). Die Werte liegen zwischen 0 und 0.3 und werden nur an Tagen mit Niederschlagsereignissen ausgewiesen.
Bild 1.76 Jahresgang des Abminderungsfaktors DR auf eine Westwand
(1.57)
Bild 1.77 Häufigkeitswolke für die Kombination Abminderungsfaktor DR (Ordinate) und Windgeschwindigkeit v1(t) (Abszisse).
Bild 1.78 Häufigkeitswolke für die Kombination Abminderungsfaktor DR(Ordinate) und Niederschlagsmenge N1(t) (Abszisse)
Außerdem ergibt sich als endgültige Regenstromdichte auf die vertikalen Bauteiloberflächen die Gleichung (1.58). Negative Werte werden durch die Funktion Φ(t) wieder ausgeschlossen. In der letzten Bildserie wird die auf der Bauteiloberfläche ankommende Regenstromdichte (Schlagregenstromdichte gRs) in kg/m2h auf die Hauptvertikalflächen Nord-West-Süd-Ost im Jahresgang dargestellt.
(1.58)
Bild 1.79 Schlagregenstromdichte in kg/m2h im Jahresgang auf eine Nordwand
Mit dem Klimafile aus Abschnitts 1.2 ergibt sich hier die höchste Durchschnittsbelastung mit Schlagregen für die Westseite. Die Ergebnisse sind wichtig für eine ingenieurmäßige feuchtetechnische Bemessung von Gebäuden.
Bild 1.80 Schlagregenstromdichte in kg/m2h im Jahresgang auf eine Westwand
Bild 1.81 Schlagregenstromdichte in kg/m2h im Jahresgang auf eine Südwand
Mit dem Klimafile aus Abschnitt 1.2 ergibt sich die geringste Durchschnittsbelastung mit Schlagregen für die Ostseite.
Bild 1.82 Schlagregenstromdichte in kg/m2h im Jahresgang auf eine Ostwand
1.1 6 Testreferenzjahr
Aus langjährigen Messungen aller Klimakomponenten und Wetterbeobachtungen sind von der Meteorologie Kunstjahre, sogenannte Testreferenzjahre (Test Reference Year TRY) für alle Klimagebiete der Erde erstellt worden. Für Deutschland liegen 9 Testreferenzjahre vor. Im Folgenden sind die Stundenwerte für die Klimakomponenten Außenlufttemperatur, kurzwellige direkte Strahlung, kurzwellige diffuse Strahlung, kurzwellige Gesamtstrahlung, langwellige Gesamtstrahlung (bestehend aus langwelliger Abstrahlung im 300K-Bereich und langwelliger Himmelsgegenstrahlung bzw. Umgebungsstrahlung), relative Luftfeuchte, Niederschlag auf eine Horizontalfläche, Windrichtung und Windgeschwindigkeit für das TRY Essen dargestellt. Das Temperaturfile TRY Essen (schwarz) korrespondiert wieder relativ gut mit dem berechneten Jahresgang (hell) nach Gleichung (1.2). Die direkte Strahlung nach Gl. (1.9) liegt wegen der angenommenen Trübung 4 etwas tiefer (helle Kurve) als nach den Angaben TRY Essen (schwarze Kurve), Bild 1.86.
Bild 1.83 Stundenwerte der Außenlufttemperatur fü das TRY Essen(schwarz) und nach (1.3)(hell)
Bild 1.84 Stundenwerte der relativen Luftfeuchte der Außenluft für das TRY Essen
Bild 1.85 Stundenwerte der direkten Strahlung (schwarz TRY Essen, hell nach (1.9))
Bild 1.86 Diffuse kurzwellige Strahlung auf eine Horizontalfläche für das TRY Essen
Bild 1.87 a und 1.87 b Stundenwerte der kurzwelligen und langwelligen Gesamtstrahlung (in W/m2) auf eine Horizontalfläche für das TRY Essen
Bild 1.88 a und 1.88 b Stundenwerte der Windrichtung w (in °) und Windgeschwindigkeit v (in m/s) für das TRY Essen
Bild 1.89 a und 1.89 b Stundenwerte des Niederschlages (in l/m2h) auf eine Horizontalfläche und Schlagregen (in l/m2h) auf eine Westwand nach Abschnitt 1.5 für das TRY Essen
1.1.7 Lokalklimate
Das Klima größerer Gebiete wird als Regional-, Makro- oder Großraumklima bezeichnet.. Unter einem Mesoklima





























