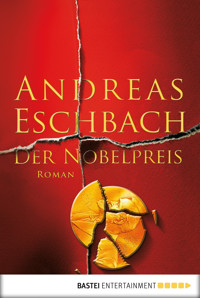Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Lübbe Audio
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Die Menschheit vor ihrer größten Herausforderung: Das Ende des Erdölzeitalters steht bevor!
Als in Saudi-Arabien das größte Ölfeld der Welt versiegt, kommt es weltweit zu Unruhen. Bahnt sich tatsächlich das Ende unserer Zivilisation an?
Nur Markus Westermann glaubt an ein Wunder. Er glaubt eine Methode zu kennen, wie man noch Öl finden kann. Viel Öl. Doch der Schein trügt.
Packend erzählt Bestseller-Autor Andreas Eschbach in seinem Thriller Ausgebrannt eine Geschichte, in der die globalisierte Welt an ihrer Ressourcenknappheit zu scheitern droht.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Zeit:9 Std. 34 min
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über das Buch
Über den Autor
Titel
Impressum
Vorbemerkung
Prolog
Teil Eins
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Teil Zwei
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Epilog
Danksagungen
Leseprobe – Der Jesus-Deal
Über das Buch
Die Menschheit vor ihrer größten Herausforderung: Das Ende des Erdölzeitalters steht bevor! Als in Saudi-Arabien das größte Ölfeld der Welt versiegt, kommt es weltweit zu Unruhen. Bahnt sich tatsächlich das Ende unserer Zivilisation an? Nur Markus Westermann glaubt an ein Wunder. Er glaubt eine Methode zu kennen, wie man noch Öl finden kann. Viel Öl. Doch der Schein trügt …
Über den Autor
Andreas Eschbach, 1959 in Ulm geboren, studierte Luft- und Raumfahrttechnik und arbeitete zunächst als Softwareentwickler. Als Stipendiat der Arno-Schmidt-Stiftung "für schriftstellerisch hochbegabten Nachwuchs" schrieb er seinen ersten Roman DIE HAARTEPPICHKNÜPFER. Bekannt wurde er durch den Thriller DAS JESUS-VIDEO. Mit EINE BILLION DOLLAR (2001) stieg er endgültig in die Riege der deutschen Top-Autoren auf. Es folgten u.a. Bestseller wie AUSGEBRANNT (2007), HERR ALLER DINGE (2010), TODESENGEL (2013) und DER JESUS-DEAL (2014). Andreas Eschbach lebt heute als freier Schriftsteller in der Bretagne.
Weitere Infos zum Autor unter www.andreaseschbach.com
Andreas Eschbach
Thriller
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Originalausgabe
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, D-30827 Garbsen
Copyright © 2007 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat: Stefan Bauer
E-Book-Produktion: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN 978-3-8387-0603-0
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
VORBEMERKUNG
Alle in diesem Buch genannten Zahlen über Ölfunde, Ölbestände, Reserven und Ölförderungen entstammen offiziellen Veröffentlichungen, vorwiegend dem »Oil & Gas Journal«, dem »BP Statistical Review of World Energy« und Studien des »United States Geological Survey (USGS)«.
Die »Society of Petroleum Engineers« gibt es wirklich. Es ist eine weltweite Organisation von 65000 Mitgliedern aus allen Bereichen der Ölindustrie mit Sitz in Richardson, Texas.
Das Energiebevorratungsgesetz und die entsprechenden Einrichtungen existieren so, wie sie in diesem Buch beschrieben werden.
Dass die OPEC seit 1982 keine Angaben über die in einzelnen Ölfeldern geförderten Mengen mehr veröffentlicht hat, ist wahr.
Auch entspricht es den Tatsachen, dass in Österreich Erdöl gefunden wurde und gefördert wird.
PROLOG
Selbst mit dem letzten Tropfen Benzin kann man noch beschleunigen. Allerdings ahnte Markus Westermann nicht, dass er im Begriff war, genau das zu tun. Er befand sich auf dem Highway 80, kurz nach der Brücke über den Susquehanna, und alles, was er wollte, war, diesen Truck mit Anhänger zu überholen, der nervtötend konstant siebenundvierzig Meilen pro Stunde fuhr.
Also zog er rüber auf die linke Spur. Es regnete. Und er hatte sein Mobiltelefon am Ohr.
»Halt, halt, hören Sie!«, rief er. »Nicht auflegen. Glauben Sie mir, Mister Taggard wartet auf meinen Anruf.«
»Möglich«, sagte die Frauenstimme am anderen Ende der Verbindung. »Bloß ist er, wie gesagt, heute nicht im Hause.«
Die Scheibenwischer fochten gegen die Gischt, die die mächtigen Reifen des Trucks aufwirbelten. Markus’ Blick fiel auf die Tachonadel. Langsam, mahnte er sich. Fünfundfünzig Meilen pro Stunde waren erlaubt. Die Polizei suchte ihn. Es war absolut unnötig, durch zu schnelles Fahren aufzufallen.
»Hören Sie«, sagte er, »ich weiß, dass Sie in Wirklichkeit keine Handelsgesellschaft für amerikanisches Obst und Gemüse sind. Mister Taggard ist auch kein Sales Manager. Aber unter Garantie hat er ein Telefon in der Tasche –«
»Seine Mobilnummer ist vertraulich und –«
»Ja, ja, natürlich. Bitte, Ma’am. Ich wette, in seiner Adressdatei steht mein Name. Und ein Eintrag, irgendetwas wie ›Jederzeit durchstellen‹.«
Der Truck schien endlos. Beschleunigte der etwa, damit er nicht an ihm vorbeikam? Wieso das denn? Markus drückte das Gaspedal tiefer. »Schauen Sie noch einmal nach. Bitte. Es ist wirklich, wirklich wichtig.«
Sie murmelte etwas, dann hörte er das Klappern einer Tastatur. Immerhin. Im Rückspiegel sah er einen Verrückten, der auf der linken Spur angerast kam und schon von weitem aufblendete. Markus Westermann gab Gas.
Doch der Wagen reagierte nicht. Kein Druck der Lehne gegen seinen Rücken. Kein Zug, nicht einmal, als er das Gaspedal bis zum Boden durchtrat. Und der Wagen klang auch irgendwie nicht, wie er hätte klingen sollen …!
Mit jähem Schrecken begriff Markus, dass er nur noch die Reifen hörte, wie sie über den nassen Asphalt rollten, aber keinen Motor mehr.
»Mister Westman?«, drang es aus dem Hörer. »Ich verbinde Sie jetzt mit Mister Taggard.«
»Ich rufe zurück.« Markus ließ das Telefon auf den Beifahrersitz fallen, griff hastig nach dem Zündschlüssel, drehte, hörte den Anlasser. Doch der Motor kam nicht.
Die Tankuhr. Heilige Scheiße! Er hatte immer gewusst, dass sie kaputt war, dass sie anzeigte, was sie wollte. Elektronischer Müll eben. Aber sie hatte halb voll angezeigt, halb voll, verdammt noch mal! Sie konnte doch nicht halb voll anzeigen und dann …
Hatte er den Tagesmeilenzähler auf null gestellt, das letzte Mal, als er getankt hatte?
Nein. Scheiße! Es war schlicht und einfach kein Benzin mehr im Tank.
Genialer Moment. Der Truck neben ihm, weißglänzend, endlos lang und groß wie ein Gebirge, fuhr so ungerührt weiter, wie der Mond seine Bahn am Himmel zieht. Klar, der Fahrer ahnte nicht einmal, dass etwas nicht stimmte. Wie auch?
Und der Wagen hinten nervte, kam näher, ein dicker roter Geländewagen mit einer ganzen Batterie Scheinwerfern auf dem Kuhfänger. Und mit denen konnte sein Fahrer umgehen, echt klasse.
»Mark?«, kam es aus dem Telefon. »Sind Sie das?«
Echt genial.
»Yes, shit!«, schrie Markus und bremste. Er hätte noch eine Menge mehr zu sagen gehabt, zum Beispiel, dass er gerade in einer echt beschissenen Situation steckte und alle Hände voll zu tun hatte, aber nicht um alles in der Welt wollte ihm jetzt einfallen, wie man das auf Englisch formulierte.
Bremsen! Er umklammerte das Lenkrad, dass es wehtat. Keine Panik, sagte er sich. So, wie man es eben tut, wenn man gerade in Panik gerät. Er musste nur langsamer werden, hinter dem Truck wieder einscheren, mit dem letzten Schwung an den Straßenrand rollen und anhalten. Kein Problem, die Bremse funktionierte schließlich noch.
»Mark? Was ist? Ich höre Sie, wo sind Sie?«
Doch ein Problem. Der Truck donnerte davon, aber irgendwie hatte Markus so viel Schwung eingebüßt, dass er schon fast stand. Vor lauter Schreck hatte er zu stark gebremst, war es das?
Und der Trottel hinter ihm schien bloß seine Lichthupe bedienen zu können, nicht aber die Bremsen.
Markus schlug auf das Lenkrad ein, hämmerte mit der Faust dagegen, schrie »Shit, shit, shit!« und schaukelte mit dem Oberkörper vor und zurück, als könne man ein Fahrzeug auch auf diese Weise vom Fleck bewegen.
»Mark? Was ist los?«
Der Idiot in dem roten Geländewagen würde ja wohl endlich bremsen, oder? Himmel, ja, jetzt fiel es ihm wieder ein! Es gab einen Trick für solche Situationen, wie war denn das noch mal … genau, mit dem Anlasser! Den Anlasser betätigen und dann die Kupplung kommen lassen. Markus fasste nach dem Zündschlüssel.
In diesem Augenblick rammte ihn etwas mit einer Wucht, die mörderischer war als alles, was er je erlebt hatte. Die Welt zerfiel in wirbelnde Bewegungen, in Schmerzen, in eine Kakophonie aus kreischendem, brechendem Metall. Vage begriff er, dass er sich zusammen mit seinem Auto überschlug, dann war da nur noch Schwärze.
Die beiden Minarette der Großen Moschee wiesen zum Himmel, ihr Schatten fiel kurz. Wie mahnende Finger, dachte der alte Mann.
Sie standen am Fenster und blickten hinab auf den weiträumigen Vorhof, wo ein Mann auf dem Boden kniete, mit verbundenen Augen, die Hände hinter dem Rücken gefesselt. Er atmete panisch. Sogar von hier oben konnte man das sehen.
Das Freitagsgebet war vorüber. Die Gläubigen verließen die Große Moschee nach und nach und gingen wieder ihrer Wege. Bis auf die, die blieben, um der Hinrichtung beizuwohnen.
Es waren mehr als sonst. Man schien zu ahnen, dass heute kein gewöhnlicher Mörder oder Vergewaltiger geköpft wurde.
»Ich wollte, sie würden ihre Kinder nicht zusehen lassen«, murmelte der greise Prinz. »Das ist nichts für Kinder.«
Der Mann neben ihm, der Polizeichef von Riyadh, strich sich hüstelnd den Bart. »Es gibt Gelehrte, die anderer Ansicht sind.«
»Sie reden von Al-Schammari, nehme ich an. Al-Schammari ist ein alter Mann.«
»Er sagt, das Grauen einer Hinrichtung zu erleben kann Kinder davon abhalten, später selber zu Verbrechern zu werden.« Es war offensichtlich, dass der Polizeichef diese Ansicht teilte.
»Mag sein. Aber ich bezweifle es.«
»Scheikh!«, entfuhr es dem anderen. »Dieser Mann hat mit Drogen gehandelt! Ihr werdet doch kein Mitleid mit ihm empfinden?«
Einen Moment lang hatte Prinz Abu Jabr Faruq Ibn Abdulaziz Al-Saud das unbestimmte Gefühl, dass der Polizeichef ihn belog. Was natürlich undenkbar war.
Er schüttelte unwillig den Kopf. »Ich sorge mich um die Seelen der Kinder, das ist alles. Die Kinder sind unsere Zukunft.«
Unten auf dem Platz trat der Scharfrichter hinter den Delinquenten. Er trug Riemen, die kreuzförmig über der Brust gegürtet waren. Die Klinge seines Schwertes gleißte im Sonnenlicht.
»Woher stammt er, sagten Sie? Aus Zypern?«
»Ja«, sagte der Polizeichef düster. »Ein Zypriote. War Student an der König Fahd Akademie. Lange genug im Land, um Gottes Gesetze zu kennen.«
Ein Hieb mit dem Schwert, fast schneller als das Auge, dann kippte der Leib des Verurteilten vornüber, während sein Kopf davonrollte, bis ihn eine Betonwand aufhielt. Ein kollektives Aufstöhnen war zu hören. Blut sprudelte aus dem Halsansatz und versickerte im Sand, einige Augenblicke lang, bis das Herz zu schlagen aufhörte.
Das Jet Rock im Central Terminal des Flughafens La Guardia hatte große Fenster aus braunem Glas zur Straße hin. Es roch nach Frittierfett und Zwiebeln, und an der Kasse herrschte Andrang. Niemand beachtete die beiden ungleichen Männer, die nebeneinander auf Barhockern an der Fenstertheke saßen, jeder ein Tablett mit einem Cheeseburger-Menü vor sich.
Einer von ihnen, ein hagerer, braun gebrannter Mann um die fünfzig, vertilgte seinen Hamburger und redete dabei mit verhaltener Stimme und Schmerz im Blick. Das, was er sagte, wurde von belangloser Musik überlagert, unterbrochen von Durchsagen und Last Calls, und war schon am nächsten Tisch nicht mehr zu verstehen.
Der andere ließ sein Tablett unberührt, hörte nur zu. Er sah aus wie ein ehemaliger Football-Profi. Nur der Priesterkragen, der unter seinem Parka hervorlugte, passte nicht dazu.
»Dieses Versteckspiel kann nicht lange gut gehen«, sagte er, als der andere schließlich schwieg.
»Natürlich nicht. Es ist reine Verzweiflung.«
»Wie lange? Was denken Sie?«
Der Hagere griff nach der Papierserviette, wischte sich den Mund und die Finger ab. »Zwei Wochen. Höchstens. Eher weniger.«
»Das heißt, der Moment, auf den wir uns vorbereitet haben, ist da.« Der Breitschultrige nickte. »Es war gut, dass Sie mich angerufen haben. Auch wenn es verdammt früh am Morgen war.«
»Es ging nicht anders.«
»Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen.«
»Ich habe nicht erwartet, Sie zu treffen. Ich wusste nicht, dass Sie gerade in New York waren.«
»Das Wirken Gottes, mein Sohn. Der letzte Termin meiner Vortragsreise.«
Der Hagere suchte nach Worten. »Reverend … Ehrlich gesagt, habe ich es damals nicht glauben wollen. Aber Sie hatten Recht.« Er zog einen Briefumschlag aus der Manteltasche. »Das ist meine Kündigung. Ich werde sie mit nach Washington nehmen und dort einwerfen. Und dann packen. Ich will heute Abend noch weg.«
»Wir erwarten Sie.«
»Deswegen wollte ich Sie sprechen. Es ist ein Risiko, mich aufzunehmen. Das muss Ihnen klar sein.«
»Man wird nicht mehr dazu kommen, ernsthaft nach Ihnen zu suchen«, sagte der Mann, den der andere Reverend genannt hatte. »Nicht, wenn das Ende der Welt bevorsteht.«
TEIL EINS
Kapitel 1
Vergangenheit
New York! Es war wie die Ankunft in einer anderen Welt, einer Welt, die heller strahlte, größer war und von weitaus mehr Energie erfüllt als das düstere, enge, müde Europa, aus dem Markus kam.
Er erwachte, als ihn jemand sanft am Arm rüttelte und mehrmals sagte: »Markus! Wir sind da!«
Er fuhr hoch, sah grelles Tageslicht durch das Fenster neben sich fluten, sah hinab auf glitzerndes blaues Wasser und erahnte die Silhouette einer Stadt, einer unglaublichen Stadt am Horizont. New York. »Noch nicht ganz«, entfuhr es ihm schlaftrunken.
Im nächsten Moment stieg ein Glücksgefühl in ihm hoch, dass er laut jubeln hätte können. »Aber so gut wie!«, rief er und grinste seinen Sitznachbarn an. Es war der Italiener in ihrem Team, ein sympathischer magerer Mann in seinem Alter, der Englisch mit einem lustigen Akzent, aber fließend sprach.
Die Stewardess teilte schmale grüne Zettel aus. Es waren Formulare für die Einreise, auf denen man mit seiner Unterschrift versichern musste, keine Drogen zu schmuggeln, den Präsidenten nicht ermorden zu wollen und so weiter. Lauter Dinge, die kein Mensch freiwillig zugeben würde, erst recht nicht, wenn er etwas davon tatsächlich im Sinn hätte.
Markus war kaum fertig damit, überall »Nein« anzukreuzen, als das Flugzeug zu einer Landung ansetzte, die so sanft war wie ein heißes Messer, das durch Butter gleitet. Bleiche, durchnächtigte Gesichter ringsum, als sich alles zum Aussteigen bereitmachte. Markus dagegen fühlte sich ausgeschlafen und voller Elan; in der Tat hatte er so gut geschlafen wie schon lange nicht mehr.
Sie verließen die Maschine durch eine Fluggastbrücke, die ihre besten Tage weit hinter sich hatte, mit Wänden, die an den Nähten rosteten, und Bodenbelägen, die bis aufs Metall durchgelaufen waren. War das wichtig? Immerhin waren solche Einrichtungen auf dem JFK bereits üblich gewesen, als man sonst überall auf der Welt noch bei Wind und Wetter übers Rollfeld hatte stapfen müssen.
An einem Gelenk der Brücke stand eine Tür offen. Ein intensiver Geruch nach Benzin drang herein (Kerosin, korrigierte Markus sich in Gedanken), der näselnde Lärm von Triebwerken im Leerlauf – und eine durchdringende, überwältigende Hitze! Nach der Nacht in der kühlen, künstlich riechenden Luft an Bord des Flugzeugs war es, als schlüge ihm in diesem Moment der Atem des Landes entgegen, das zu erobern er ausgezogen war. Und siehe da, es war der Feueratem eines Drachen!
Dann standen sie in Schlangenlinien vor der Einreisekontrolle und sahen zu, wie Bewaffnete in Uniform mit Metalldetektoren hantierten. Es ging langsam voran, geradezu quälend zäh. Man musste aufhören, auf die Uhr zu sehen. Die Kabinen aus Stahl und Glas kamen näher, Schritt um Schritt. Irgendwann würde es so weit sein, das war unausweichlich. War es wichtig, zu wissen, wann?
In diesen Minuten oder Stunden geschah es. In einem magischen Moment fiel Markus’ Blick auf den weinroten Pass in seinen Händen, auf den schmalen grünen Zettel, der darin steckte, und auf die erste gedruckte Zeile darauf.
UNITED STATES OF AMERICA
Der Anblick durchzuckte ihn wie ein elektrischer Schlag. Einen Augenblick lang war ihm, als lägen alle Geheimnisse und Rätsel der Welt enthüllt vor ihm und als bestünde eines dieser Geheimnisse darin, dass es keine kraftvollere, keine machtvollere Anordnung von Buchstaben gab als diese. Dann bewegte sich der Rücken vor ihm einen Schritt weiter, es galt, die Lücke zu schließen, und der magische Moment war vorüber.
Aber die Worte standen immer noch auf dem Papier, und sie hörten nicht auf zu leuchten.
Am Hauptausgang widersetzten sich vier Männer in Livree der Menschenbrandung, Schilder mit der Aufschrift »Lakeside and Rowe« in die Höhe reckend. Es galt zu warten, bis alle die Kontrollen passiert hatten und das Team vollzählig war. Auf einem Parkplatz in der Nähe warteten vier schwarze, lang gestreckte Limousinen, und jemand witzelte, ohne wirklich daran zu glauben, dass man sie damit wohl in die Stadt fahren würde. Die Männer in Livree hörten es, verzogen keine Miene dabei, aber genauso kam es. Das Team bestand aus sechzehn Leuten; es ging genau auf.
Es war wie im Film. Sie fuhren auf die graue Skyline am Horizont zu, überquerten eine Brücke und rauschten endlich nach Manhattan hinein, durch Häuserschluchten, Mann, die wirklich so hoch waren, wie er sie sich immer vorgestellt hatte, vorbei an grimmig rennenden Menschen in sämtlichen Hautfarben, die der Planet zu bieten hatte. Überall Fahrräder und die gelben Taxis, die er aus tausend Filmen kannte. Und Busse. Und ein silbrig glänzender, unwirklicher Dunst über allem, Abgase vielleicht oder schlicht Dampf, der im Sonnenlicht leuchtete, das unerwartet hell und heiß und intensiv war. New York, Himmel noch mal, er hatte es geschafft! Er war hier, wo er hingehörte: in der Hauptstadt der Welt, im Zentrum aller Dinge, da, wo der Puls der menschlichen Zivilisation schlug.
Die Wolkenkratzer wurden höher, die Straßen schmaler: Upper Manhattan. Der Firmensitz, ein grauer, kantiger Bau aus der Gründerzeit, wirkte in echt kleiner als auf den Bildern in den Prospekten. Aber es gab eine eigene Auffahrt, die Limousinen hielten unter einem gediegenen Stoffdach, und man öffnete ihnen die Türen.
In Sachen Show hatten die Amis einfach was los. Wenn es um Auftritt und genau berechnete Wirkung ging, machte ihnen keiner was vor.
Man geleitete sie nach oben, auf eine Art, dass sie sich wie hoch geschätzte Staatsgäste fühlten. Oben vor dem Aufzug begrüßte sie Irving Young, der Leiter Human Ressources höchstpersönlich. Einige der Chefs der diversen Regionen und Märkte standen dabei, und durch offen stehende Türen erhaschte Markus einen Blick in die Büros: traumhaft. Würde er überhaupt arbeiten können vor so einem Panorama? Die Skyline Manhattans, ein Fluss, der in der Sonne glänzte wie Quecksilber … Er konnte es kaum erwarten.
Ich bin da, wo ich hingehöre!, schoss ihm durch den Kopf. Unmöglich, zuzuhören, was Young alles erzählte, zumal er es in ausgesprochen langweiligem Ton tat.
Endlich ging es weiter, eine Treppe hoch, in einen Empfangsraum, in dem Sekt und Häppchen bereitstanden. An den Wänden hingen Illustrationen aus dem letzten Geschäftsbericht. Ein Pult stand bereit. Es war also mit weiteren Reden zu rechnen.
Zu Markus’ Überraschung erschien kurz darauf der greise Simon Rowe, der letzte aus der Gründergeneration, hoch in den Neunzigern, aber immer noch Aufsichtsratsvorsitzender. Er ließ es sich nicht nehmen, jedem von ihnen die Hand zu schütteln. Man erzählte, er käme morgens so früh ins Büro, dass er den Nachtportier verabschieden konnte. Die Arbeit hielte ihn am Leben, pflegte er zu erklären. Wenn diese Erklärung in den Medien auftauchte, fehlte selten der Hinweis darauf, dass sich Rowes Partner Eric W. Lakeside dereinst im zarten Alter von 57 Jahren ins Privatleben zurückgezogen hatte, um Golf zu spielen, Rosen zu züchten, mit seiner Segeljacht vor Florida zu kreuzen und mit 63 zu sterben.
Rowe dagegen, der die ersten Module des Softwaresystems, mit dem sie die Finanzwelt beglückten, höchstpersönlich geschrieben hatte, in COBOL seinerzeit, lebte noch. Mit ergreifender Mühe erklomm er die kaum knöchelhohe Plattform, auf der das Pult stand. Oben blinzelte er in die Runde, faltete dann ein Blatt Papier auseinander, das aussah, als trage er es seit Jahrzehnten mit sich herum, und hielt eine Ansprache, die im Wesentlichen betonte, wie glücklich sie sich schätzen konnten, für die beste Firma der Welt zu arbeiten. Das Pathos war ein wenig dick aufgetragen, typisch amerikanisch eben – Markus sah, wie der Franzose in ihrem Team die Nase rümpfte –, aber die Geste als solche beeindruckte.
Als alle dachten, er sei fertig – eine verzeihliche Annahme, da er das Manuskript seiner Rede betulich zusammengefaltet und wieder in seinem Sakko verstaut hatte –, beugte sich der alte Mann über das Mikrofon und sagte: »Denken Sie daran, meine Damen und Herren – Geld regiert die Welt. Das stimmt heute mehr denn je. Die Finanzinstitute, die Banken, Investmentfonds und so weiter – unsere Kunden, mit einem Wort – halten eine unvergleichliche Macht in Händen. Es ist nicht die Macht der Gewehrläufe, es ist eine unblutige, subtile, aber um so wirkungsvollere Macht. Macht aber heißt auch: Verantwortung. Die Entscheidungen, die unsere Kunden treffen, beeinflussen das Leben von Millionen von Menschen. Viele dieser Entscheidungen beruhen auf Daten, die unsere Software liefert. Die Verantwortung dafür, dass diese Daten so genau und so wahrheitsgemäß wie nur irgend menschenmöglich sind – die liegt bei uns. Und was Ihr Projekt angeht, bei Ihnen. Seien Sie sich dessen bitte stets bewusst.« Er nickte mit seinem weitgehend kahlen, nur noch von wenigen weißen Haaren umflorten Schädel. »Ich danke Ihnen.«
Der Seniorchef ging unter Beifall ab. Danach zerfiel die Stimmung von Empfang und Ankunft rasch. Halbleere Sektgläser wurden zurück auf die Tische gestellt, die belegten Brötchen, Käsespieße und Fleischbällchen hörten auf, lecker auszusehen, und schließlich hielt Markus es nicht länger aus. Geradeheraus fragte er, welches ihre Büros sein würden.
»Oh«, sagte Young, ein Mann mit lavendelblauen Augen und einem Lächeln, das wie angeschraubt wirkte, »nicht hier.«
Die Entwicklungsabteilung, erfuhr Markus zu seiner maßlosen Enttäuschung, befand sich nicht mehr im Lakeside and Rowe Building, sondern im Gebäude des technischen Service USA-Ost draußen in Pennsylvania, in einem Ort mit dem unwahrscheinlichen Namen Paradise Valley. Seit einem halben Jahr. Aus Kostengründen. Aber es sei schön dort, die Entwickler alle vollauf glücklich. Pocono Mountains, ein Traum. Und nur hundert Meilen von New York entfernt.
»Hundert Meilen?«, hörte Markus sich wiederholen.
»Ungefähr«, nickte der Leiter der Human Ressources. »Können auch ein paar mehr sein.«
So ging es mit dem Aufzug wieder hinunter. Tatsächlich: Fast neben jedem Knopf prangte das Namensschild einer anderen Firma. Das war Markus auf der Fahrt hinauf entgangen. Lakeside and Rowe residierten nur noch in den obersten beiden Etagen.
Als sie unten ins Freie traten, waren die Limousinen fort; stattdessen stand ein grauer Bus in der Auffahrt. Ein paar schwarze Bedienstete in blauen Overalls luden gerade ihre Koffer ein.
»Die Mieten in New York sind sowieso unbezahlbar«, meinte der Italiener beim Einsteigen. Silvio hieß er, Silvio Damiano. Man merkte, dass er versuchte, sich seine Enttäuschung schönzureden. »Ich habe gehört, dass manche für eine Einzimmerwohnung mit Klo auf dem Flur so viel Miete bezahlen, wie eine Vierzimmerwohnung in Rom kostet. In Rom!«
»Ja«, nickte Markus grimmig. »Aber das würden sie nicht machen, wenn sie es nicht geil fänden, in New York zu leben.«
Silvio ließ sich in einen freien Doppelsitz fallen und schien nichts dagegen zu haben, dass Markus sich neben ihn setzte.
»Paradise Valley«, sagte der magere Italiener. »Klingt wie: ›Ende der Welt‹.«
Das Projekt bestand schlicht und einfach darin, LR-8, das neue Softwaresystem, das Ende des Jahres auf dem Markt eingeführt werden sollte, zu lokalisieren.
Lokalisierung bedeutete, alle Programme so anzupassen, dass sie in dem jeweiligen Land einsetzbar waren. Das hieß zum Beispiel, dass in sämtlichen Eingabemasken, Menüs und Ausgabereports die entsprechenden deutschen, italienischen, französischen und so weiter Begriffe eingefügt werden mussten. Es war zu prüfen, dass die richtigen Datumsformate und Zahlendarstellungen verwendet wurden. Benutzerhandbücher und Hilfefunktionen waren zu übersetzen, Schulungsunterlagen zu erstellen und dergleichen mehr. Vor allem aber ging es darum, die Software an die jeweiligen gesetzlichen Vorschriften anzupassen. Da in der Version 8 zahlreiche neue Module hinzukamen, war das der größte Teil der Aufgabe. Hierzu würden sie regelmäßig mit Juristen und Steuerfachleuten zu Hause kommunizieren, deren Auskünfte in Änderungswünsche umsetzen, mit den eigentlichen Entwicklern besprechen und schließlich das, was diese daraus machten, überprüfen. Alle Änderungen mussten in die jeweiligen Handbücher einfließen und selbstredend auch in die allgemeine Dokumentation.
Die Lokalisierung eines Programms war eine verantwortungsvolle und aufwändige Arbeit, deren Qualität die Absatzchancen im jeweiligen Markt maßgeblich bestimmte. Es gehörte zu den Gepflogenheiten der Firma Lakeside and Rowe, Inc., mit dieser Aufgabe grundsätzlich keine Programmierer zu betrauen, sondern ausschließlich Mitarbeiter aus dem Vertrieb, die die Wünsche und Bedürfnisse der Kunden kannten.
Sechs Monate war für dieses Projekt eher knapp bemessen. Sie würden schuften müssen wie die Geisteskranken, um fertig zu sein, wenn es Zeit war, wieder nach Hause zu fliegen. Dass Lokalisierungen so arbeitsintensiv abliefen, war sattsam bekannt. Trotzdem war der Job begehrt: Da man dadurch automatisch zum unumstrittenen Fachmann für die jeweilige Sprachversion wurde, verlief die persönliche Karriere hinterher für gewöhnlich steil bergauf.
Markus Westermann allerdings hatte andere Pläne. Er war im Land seiner Träume angelangt, und er hatte nicht vor, es wieder zu verlassen. Nicht nach Ablauf der sechs Monate, und erst recht nicht, um nach Deutschland zurückzukehren.
Gegenwart
Er kam zu sich, sah Licht, hörte Stimmen, versank wieder im köstlichen Dunkel. Doch schließlich war es so weit, dass er die Augen aufstemmen und sich umsehen konnte. Verwirrt registrierte er, dass er in einem weißen Krankenhausbett lag und dass es nach Desinfektionsmitteln roch. Dann fiel ihm wieder ein, warum und was geschehen war. Er spürte keine Schmerzen.
Er hob die Hände. Sie waren okay. Einer der Unterarme war verbunden; ein durchsichtiger Schlauch verschwand zwischen den Lagen Mull. Er betastete behutsam sein Gesicht. Verbände, Pflaster. Wahrscheinlich sah er schlimm aus. Aber wie es schien, war noch alles an ihm dran. Glück im Unglück.
Eine Schwester kam herein, lächelnd, schweigsam, kontrollierte den Stand der Flüssigkeit in einem durchsichtigen Beutel, der über ihm hing. Er fragte sie mühsam, wie lange er schon hier sei, und sie erwiderte mit russisch oder polnisch angehauchtem Akzent: »Sorry. I don’t speak English.«
Er sah sie an, verstand nicht. Irgendetwas war falsch.
Sie hatte ein kleines blaues Schild auf der Brust. Auf dem stand Schwester Malgorzata.
Schwester.
Er räusperte sich, versuchte es auf Deutsch: »Wie lange bin ich schon hier?«
Sie lächelte entschuldigend. »Weiß nicht. Bin erste Woche auf Station.«
»Welchen Tag haben wir heute?«
»Mittwoch«, erklärte die schlanke Frau in Weiß und entschwand wieder.
Er sah umher, suchte nach Anhaltspunkten. Das zweite Bett im Zimmer stand leer. Vor dem Fenster bewegte sich ein magerer Baum im Wind. Seine Blätter waren braun verfärbt, einige fielen ab, während Markus zusah und mühsam begriff.
Herbst. Es war Herbst. Nicht nur, dass er zurück in Deutschland war, seit dem Unfall musste auch schrecklich viel Zeit vergangen sein.
Kapitel 2
Vergangenheit
Der Makler schien es darauf abgesehen zu haben, sie keinen Augenblick lang miteinander allein zu lassen, während er ihnen das Haus zeigte. Er pries es an, als hätte es das nötig, bis sein Telefon klingelte; ein wichtiges Gespräch, wie es aussah. So hatten sie endlich doch einen Moment für sich.
»Das Haus ist irre«, raunte Werner. »Und zu dem Preis! Wir wären bescheuert, wenn wir das nicht nehmen.«
Dorothea war schwindlig. Rührte das von dem überwältigenden Panoramablick her, den man von der Terrasse aus hatte? Oder war es die Aussicht, dass sich ihre Träume vom eigenen Heim nun so plötzlich und so spektakulär erfüllen würden?
»Warum verkauft jemand so ein Haus? Das würde ich wirklich gern wissen.«
»Das fragen wir ihn einfach.« Werner grinste übers ganze Gesicht. »Mit Schwimmbad – Mann, oh Mann! Ich wäre nicht mal auf die Idee gekommen, mir so was zu wünschen. Und hier kriegen wir es quasi als Dreingabe! Schau dir das an – allein das Wohnzimmer. Mit Kamin. Die Galerie. Die Zimmer oben, das Erdgeschoss, der Keller … und das Riesengrundstück … Selbst ohne Schwimmbad wäre der Preis dafür absolut okay.«
»Hast du nicht das Gefühl, dass an der Sache ein Haken sein muss?« Dorothea konnte nicht anders als zu zweifeln. Wenn etwas zu gut aussah, um wahr zu sein, dann war es das meistens auch nicht. Zumindest ihrer Erfahrung nach.
Werner glühte vor Begeisterung. »Der einzige Haken, den ich sehe, ist der, dass wir nie wieder Lust haben werden zu verreisen, wenn wir erst einmal hier wohnen.« Er rieb sich das Kinn. »Abgesehen davon ist es ja nicht billig. Ohne deine Erbschaft bräuchten wir gar nicht anfangen zu rechnen.«
Die Erbschaft, ja. Dorothea spürte einen Stich. Vielleicht war er das, der Haken. Der kleine Schmerz, der bei allem Schönen dabei sein musste wie der Dorn an einer Rose.
Aber das Haus war ein Traum. Es stand direkt über einem Felshang am äußersten nordöstlichen Trauf der Schwäbischen Alb, und von der großen Terrasse ging der Blick über eine schier endlose, sanft gewellte Tiefebene, über Wälder, Bauernhöfe und Siedlungen, über mäandernde Flussufer und Bäche und Fischteiche. Unter der Terrasse lag die Schwimmhalle, die genau den gleichen Ausblick bot. Das Haus selbst war großzügig, elegant und geschmackvoll gebaut, bot Platz für mindestens vier Kinder, für Werners Hobbyraum … Es hatte einfach alles, was ein Herz nur begehren konnte. Gut, es lag ziemlich einsam und abseits, aber das hier war keine Gegend, in der schlimme Dinge passierten. Werner würde es ein bisschen weiter in die Firma haben, als sie sich vorgestellt hatten. Doch das war es wert.
»Der Vorbesitzer«, erklärte der Makler, nachdem er wieder zu ihnen gestoßen war und Werner ihn gefragt hatte, »hat über unsere Agentur ein schönes Anwesen gefunden, eine Art Landsitz – einen historischen Gutshof, sehr exklusive Gelegenheit.« Er lächelte, offenbar erfüllt von professioneller Genugtuung. »Er scheint sich damit eine Art Jugendtraum zu erfüllen.«
Dorothea war erleichtert, das zu hören. Sie hätte kein gutes Gefühl bei der Sache gehabt, wenn eine Pleite der Grund für den Verkauf gewesen wäre.
Werner sagte: »Schön für ihn.« Er meinte natürlich, ›schön für uns‹, das war ihm anzusehen.
Dorothea hatte sich in ihren kühnsten Träumen nie vorgestellt, einmal so zu wohnen. Selbst Filmstars und Millionäre mussten blass vor Neid werden, wenn sie dieses Haus sahen. Und ihnen wurde es angeboten! Sie brauchten nur ja zu sagen! Und das bloß, weil Werner im selben Geländewagen-Club war wie der Besitzer der Immobilienagentur, der Chef dieses Mannes hier.
Der zog gerade ein kariertes Blatt mit Notizen aus seiner überquellenden Mappe. »Der Vorbesitzer hat ein paar Punkte notiert, auf die wir Interessenten aufmerksam machen sollen. Nachteile des Hauses, gewissermaßen«, fügte er hinzu, in einem Tonfall, als sei ihm der Gedanke fremd, Objekte, die seine Agentur anbot, könnten so etwas wie Nachteile aufweisen. »Das war ihm sehr wichtig.«
Dorothea holte tief Luft. »Anständig von ihm«, meinte sie.
Der Makler lächelte schmerzlich. »Ja. Der Vorbesitzer ist ein sehr korrekter Mann.« Er konsultierte die Liste. Lang schien sie nicht zu sein, zum Glück. »Also, am allerwichtigsten ist, dass Sie sich darüber im Klaren sein müssen, dass dieses Haus aufwändig zu heizen ist. Es ist in den sechziger Jahren gebaut worden. Die Wärmedämmung entspricht nicht dem, was heute üblich ist. Dazu die vielen großen Räume, die hohen Decken und so weiter … Rechnen Sie damit, dass Sie doppelt so viel Öl brauchen werden wie in einem normalen Haus dieser Größe.«
Werner nickte gefasst. »Wegen des Schwimmbads.«
»Ja, und wegen der exponierten Lage. Im Winter haben Sie hier kalte Nordwinde, die zweihundert Kilometer Anlauf nehmen, ehe sie auf das Haus treffen. Das kostet.«
Werner und Dorothea wechselten einen Blick. Diesen Luxus, sagte dieser Blick, würden sie sich leisten. Werner hatte einen guten, sicheren Job, und er war erst vor kurzem befördert worden.
»Gut, und weiter?«, wollte Werner wissen.
»Sie müssen damit rechnen, dass Sie zwei Autos brauchen, wenn Sie hier wohnen. Der nächste Supermarkt ist in Duffendorf, das sind fast zwanzig Kilometer.« Er wedelte mit dem Zettel. »Das ist übrigens nicht ganz richtig; im Dorf unten gibt es einen kleinen Laden. Nicht sehr groß und auch nicht billig, aber wenn einem mal die Butter ausgeht oder man rasch drei Eier braucht, das kriegen Sie da jederzeit.«
»Kein Problem. Wir haben zwei Autos.« Wobei eins davon Werners Geländewagen war, sein Augapfel gewissermaßen. Und das andere der Firmenwagen. Eines der beiden Fahrzeuge würde er ihr überlassen müssen, und sie würde sich daran gewöhnen müssen, wieder selber zu fahren.
Aber gut. Man gewöhnt sich an alles, wenn es sein muss.
»Der Schulbus fährt ebenfalls nur unten vom Dorf aus. Die Haltestelle ist vor dem Rathaus.«
Dorothea nickte. Ihr Sohn ging in die vierte Klasse, da war das natürlich wichtig. Und sie würden es nicht bei einem Kind belassen. Nicht mit einem so großen Haus. »Das werden wir schon irgendwie schaffen.« Sie sah Werner an, auf einmal erfüllt von der Sorge, er könnte es sich anders überlegen. »Irene und Ruth müssen ihre Kinder auch jeden Morgen zur Schule oder zur Haltestelle bringen, und die wohnen in Stuttgart.«
Werner nickte. »Was noch?«
»Das war alles«, sagte der Makler erleichtert.
Paradise Valley sah genau so aus, wie der Name klang: ein über verträumt aussehende, dicht bewaldete Täler des beginnenden Appalachengebirges verteilter Ort, in dem man ohne eigenes Auto verraten und verkauft war. Das Lokalisierungsteam wurde in einem direkt an der Bundesstraße 940 gelegenen Hotel einquartiert. Wer nicht im Hotelrestaurant essen wollte, hatte als Alternative den wenig Vertrauen einflößenden Burger-Stand an der Tankstelle auf der anderen Seite der Straße. Ansonsten waren ringsum Wald und Wiese, jedes Zimmer hatte Kabelfernsehen mit hundert Kanälen, und der Bus würde sie morgens abholen und abends zurückbringen.
Wie sich herausstellte, war das eine Fahrt von etlichen Meilen, die jeden Morgen ausgiebig Gelegenheit bot, die großen Villen und weitläufigen Anwesen der Einheimischen zu bewundern, die überall in der Landschaft verstreut lagen. Außerdem schnitten ihnen Kinder, die auf den Schulbus warteten, beim Vorbeifahren wüste Grimassen oder warfen ihnen kleine Steine hinterher.
»Das machen sie, weil wir New Yorker Nummernschilder haben«, sagte der Fahrer, als erkläre das alles.
Das Entwicklungszentrum befand sich in einem modernen zweistöckigen Bau in den Firmenfarben, der hauptsächlich den technischen Service beherbergte, jene Abteilung also, die die Software bei Kunden installierte, Updates durchführte und die man anrief, wenn Probleme auftraten. Die Anhöhe, auf der das Gebäude stand, bot eine Aussicht, für die sich auch eine exklusive Kurklinik nicht geschämt hätte, und allein der Grund und Boden des Parkplatzes darum herum hätte in New York mehr gekostet als ganz Paradise Valley.
Der Eindruck von Großzügigkeit verflog, sobald man das Gebäude betrat. Die Gänge waren schmal und dunkel und rochen muffig. Das Büro im ersten Stock, in dem man sie unterbrachte, sah wahrhaftig genau so aus wie in amerikanischen Filmen: Für jeden gab es eine von Stellwänden umzäunte Box, in der ein Schreibtisch, ein Stuhl, ein Aktenschrank und ein Computer standen und die gerade so groß war, dass man mit ausgestreckten Armen jeden Punkt darin erreichte. Bis auf den Computer wackelte schon alles, dabei war das Gebäude keine zwei Jahre alt. Das Ganze sah verdammt noch mal nach Käfighaltung von Angestellten aus.
Zumindest, was die unterste Ebene anbelangte. Schon bei der nächsten Stufe in der Firmenhierarchie sahen die Büros deutlich besser aus. Der Leiter des Lokalisierungsprojekts hieß John Murray, ein Schwarzer mit schmalen, langgliedrigen Händen, der niemals lächelte. Sein Büro hatte eine Tür, die er hinter sich zumachen konnte und auch zumachte, ein großes Fenster, von dem aus man über die beeindruckenden Wälder blickte, und eine solide Einrichtung.
So ein Büro, beschloss Markus, war das nächste Etappenziel.
Am nächsten Tag begann die Arbeit. Markus nahm sich als Erstes die Eingabeformulare vor. Am Morgen fand er bereits Ausdrucke sämtlicher Masken vor, und es war geradezu ein Spaziergang, sie einzudeutschen. An einigen Stellen würde der Platz auf dem Bildschirm ein bisschen eng werden, aber das war das Problem der Entwickler, nicht seines. Am frühen Nachmittag hatte Markus alle Masken und die Hälfte aller Reports durch und fing an, sich zu fragen, was er die ganzen sechs Monate eigentlich tun sollte.
Die Antwort darauf bekam er, als er am nächsten Morgen das erste Mal mit Europa telefonierte, und zwar mit einer Wiener Steuerkanzlei, mit der die Firma einen Kooperationsvertrag hatte. Um acht Uhr morgens in Paradise Valley war es vierzehn Uhr in Wien, und sein Gesprächspartner, ein Dr. Beißwenger, erklärte ihm gleich zu Beginn, dass er pünktlich um sechzehn Uhr dreißig aufzuhören gewohnt sei.
»So lange werden wir ja wohl nicht brauchen«, meinte Markus verdutzt.
Das entlockte dem Mann am anderen Ende der Leitung ein herablassendes Lachen. »Junger Freund, wir werden noch sehr viel länger miteinander zu tun haben, als Sie sich gerade in Ihren schlimmsten Träumen vorstellen, glauben Sie mir.«
»Wie das denn?«, fragte Markus arglos.
Eine halbe Stunde später dämmerte ihm, dass er das besser nicht gefragt hätte.
Eines der neuen Softwaremodule, das Lakeside and Rowe mitsamt der Firma, die es entwickelt hatte, aufgekauft hatten, diente dazu, die Kontobewegungen von Bankkunden zu analysieren und daraus Profile zu erstellen, die Aussagen über den künftigen Liquiditätsverlauf, das Konsumverhalten sowie die Investitionsneigung eines Kunden erlaubten. Diese Analysen sollten dazu dienen, Finanzprodukte gezielter denjenigen anbieten zu können, die sich mit der größten Wahrscheinlichkeit dafür interessierten, und das Ganze basierte auf einem patentierten neuen Analyseverfahren, das irgendwie mit neuronalen Netzwerken zu tun hatte. Markus hatte mehrere Artikel darüber gelesen und es irgendwann aufgegeben, die Hintergründe verstehen zu wollen.
In den USA, einem Land, das so etwas wie ein Bankgeheimnis nicht kannte, war der Einsatz eines solchen Tools kein Problem. Anders in Europa. Dr. Beißwenger hielt ihm einen fast zweistündigen Vortrag über die Grundzüge und die in diesem Fall wesentlichen Feinheiten des österreichischen Bankenrechts, natürlich nicht ohne auf die darüber hinaus zu berücksichtigenden Vorschriften der EU-Kommission hinzuweisen. Markus tat hinterher der Arm weh von den vielen Notizen, die er in fliegender Eile mitgeschrieben hatte; einen kompletten Block voll.
Und das war nur Österreich. Deutschland und die Schweiz standen ihm erst noch bevor.
»Wer berät Sie denn zum deutschen Steuerrecht?«, wollte Beißwenger wissen.
Markus massierte sein Handgelenk. »Ein Professor Müller von der Universität Köln. Aber der ist erst Anfang Juni aus dem Urlaub zurück.«
»Er kann sich ruhig Zeit lassen. Passen Sie auf, junger Mann, am besten machen wir es so: Sie nehmen Ihre Texte, übersetzen ein Stück, schicken’s mir per Mail, und dann sprechen wir darüber. Was halten Sie davon? Ist günstig, dass Sie in Amerika sitzen, da haben Sie den Nachmittag zum Arbeiten, und ich hab den Vormittag, um mir Ihre Sachen anzuschauen. Besser geht’s gar nicht.«
»Okay«, meinte Markus matt. »Machen wir es so.«
»Dann bis morgen. Grüß Sie Gott.«
Auf diese Weise kam ein Rhythmus in Gang. Nachmittags übersetzte Markus, so viel er bewältigte, und schickte das Resultat am Abend per Mail nach Wien. Am nächsten Morgen besprachen sie telefonisch, was daran nicht so bleiben konnte, was darauf hinauslief, dass Dr. Beißwenger ihm jeweils eine lange Liste von Punkten diktierte, die er mit dem Entwicklerteam würde besprechen müssen.
Markus fragte sich längst nicht mehr, was er die nächsten sechs Monate lang tun würde. Er fragte sich, wie um alles in der Welt die Zeit ausreichen sollte.
Andere hatten es da wesentlich einfacher. Der Schwede im Team etwa las jeden Morgen erst ausgiebig Zeitung oder hielt in aller Gemütsruhe ein Schwätzchen mit dem Dänen. Der Slowene schien nicht einmal zu verstehen, was an Bankvorschriften und Steuergesetzen schwierig sein konnte.
Markus passte den Franzosen ab, Jean-Marc irgendwie, der sich alle paar Stunden in der Küche einen Kaffee bereitete, der diesen Namen auch verdiente, und schlug ihm vor, in Sachen Schweiz zusammenzuarbeiten.
»Bien sûr«, nickte der mit müdem Augenaufschlag. »Aber ich werde noch eine Weile mit Belgien beschäftigt sein.« Er schien genau denselben Kampf zu kämpfen.
Abends saßen sie im Hotel fest. Der Bus setzte sie nach der Arbeit dort ab, meistens gegen halb sieben, und danach war kein Fortkommen mehr. An der Tankstelle parkten um diese Zeit schon jede Menge monströser Trucks, und deren Fahrer, zum größten Teil Typen, die auf junge europäische IT-Vertriebsleute nur Furcht einflößend wirken konnten, hielten den Burger-Stand besetzt. Es gab keine Linienbusse, zumindest keine, die diese Straße entlangfuhren, und auch keine Taxis. Es lohne sowieso nicht, meinte die Wirtin, die jeden Tag ein gleich bleibend strahlendes Lächeln trug, es gebe in Paradise Valley nichts, das die Bezeichnung Stadtzentrum verdiene. Ein Kino? Das letzte habe zwei Jahre zuvor zugemacht, dort sprängen jetzt die Ratten über die Sitze. Und was sie denn im Kino wollten, auf den Zimmern gäbe es gute Fernseher mit extra großen Bildschirmen und Anschluss an das Pay-TV-System. Zahlte alles die Firma.
Also blieb man im Hotel, ganz einfach. Um acht Uhr wurde das Abendessen serviert: entweder Burger mit Salaten, Mexikanisch oder Chinesisch. Anschließend konnte man hinten in der Bar im Texas-Stil an vier Tischen Billard spielen, bis einem die Quarter ausgingen, oder einfach beisammensitzen, trinken und reden. Manche verzogen sich früh auf ihr Zimmer, Jean-Marc beispielsweise. Er hatte erzählt, er habe Balzacs »Menschliche Komödie« auf seinem eBook dabei und fest vor, sie bis zum Rückflug gelesen zu haben, sämtliche einundneunzig Bände.
Markus blieb bei denen, die einfach nur redeten. Meist ging es um die Arbeit. Da sie fast alle denselben Hintergrund hatten, fanden sich mühelos gemeinsame Themen, und die Unterschiede der nationalen Mentalitäten ergaben Stoff für viele lustige Anekdoten. Doch, das war schon alles interessant.
Aber, das war Mark klar, es würde nicht ein halbes Jahr lang interessant bleiben.
Mit anderen Worten: Er musste hier weg.
Eines Morgens fand er ein Formular auf seinem Schreibtisch vor, auf dem groß und fett »URGENT« stand. Es stammte von der Büroverwaltung, und es ging um nichts Dramatischeres als darum, jeden von ihnen für die Zeit seines Aufenthaltes mit Visitenkarten auszustatten. In einfachen, anscheinend auf das geistige Fassungsvermögen von Vollidioten geeichten Sätzen wurde er gebeten, seinen Namen, seine Durchwahlnummer, E-Mail-Adresse und eventuelle Mobilfunknummer in die dafür vorgesehenen Kästchen einzutragen und das Ganze – urgent! – um 10 a.m. bereitzulegen. Ein Bürobote würde dann alle Formulare einsammeln.
Markus zog einen Kugelschreiber aus der Schublade. In dem Moment, in dem er zum Schreiben ansetzte, kam ihm die Idee. Albern, kindisch, aber unwiderstehlich.
In das Feld »First Name« schrieb er: MARK.
In das Feld »Last Name« schrieb er: WESTMAN.
In das Feld »Middle Initial« schrieb er: S.
Er sprach das Ganze leise vor sich hin. »Mark S. Westman.« Klang das nicht schon richtig, geradezu wunderbar amerikanisch? Fiel man nicht wie von selbst in ein breites Kaugummi-Englisch, wenn man diesen Namen nur las?
Kindsköpfisch. Wahrscheinlich bekam er das Formular spätestens morgen früh wieder auf den Tisch mit der Bitte um Korrektur. Egal. Er füllte auch noch den Rest aus – nicht allzu ordentlich, damit er sich notfalls auf ein Versehen herausreden konnte –, legte das Blatt in den Ausgangskorb und machte sich an die Arbeit.
Der Bürobote, ein pickliger, ungewaschen riechender Jüngling, kam erst um elf. Und erst als er durch war, vermochte sich Markus wieder auf die Feinheiten von Jahresabschlussbescheinigungen für Kapitalmarktkonten zu konzentrieren.
Doch am nächsten Morgen lag nicht das Formular auf seinem Tisch, sondern ein Stapel von hundert Visitenkarten für MARK S. WESTMAN, Mitarbeiter von Lakeside and Rowe, Inc., New York, N.Y., U.S.A., zusammen mit einem Ansteckclip, in dem man eine der Karten auf der Brust spazieren tragen konnte.
Es mochte albern sein, es kam ihm trotzdem vor wie ein gutes Omen. Ja, schienen ihm die schmalen weißen Kärtchen zuzuzwinkern. Nun bist du angekommen im Land der unbegrenzten Möglichkeiten.
Kaum jemand bemerkte den Fehler. Jean-Marc sprach ihn darauf an und meinte, er solle reklamieren. »Uns werden sie auch keine Fehler durchgehen lassen.«
Markus winkte ab. »Ach, was sind schon Namen? Schall und Rauch.« Den Ball flach halten, sagte er sich. Und natürlich glaubte er nicht im Mindesten, dass Namen Schall und Rauch waren. Namen waren magische Worte. Jeder, der mit Kunden zu tun hatte, wusste das.
Als sie sich Ende der Woche zum ersten Mal mit den Entwicklern trafen, stellte er sich von vornherein als »Mark« vor, was jeder am Tisch akzeptierte, ohne mit der Wimper zu zucken. Dann diskutierten sie bis zum Einbruch der Dämmerung die notwendigen Änderungen. Das Ganze ging nüchtern vor sich, zielbewusst, auf eine wunderbare Art pragmatisch. Am Abend war Markus regelrecht high. So also wurde in dieser Nation gearbeitet, die Menschen zum Mond geschickt hatte!
Der eigentliche Sieg aber war, dass auch die anderen aus dem Lokalisierungsteam anfingen, ihn »Mark« zu nennen. Die Magie funktionierte. Und sie würde Wunder wirken, davon war er überzeugt.
Gegenwart
Er schreckte hoch, als jemand ins Zimmer kam. Eine Ärztin. Schlank, aber mit grauen Schläfen. Merkwürdig. Sie trug ein Stethoskop in der Brusttasche und eine dünnrandige Brille mit auffallend kleinen Gläsern auf der Nase. Ohne ihn anzusehen, trat sie ans Fußende des Bettes und nahm eine dicke, in grünen Karton gebundene Akte aus einem Ablagefach, das auf der anderen Seite des Fußteils befestigt zu sein schien.
Sie las. Lange. Blätterte immer wieder um, laut, mit einem Rascheln, das in den Ohren und im Kopf dröhnte.
Bin ich überhaupt da?, fragte er sich. Er fing an, es zu bezweifeln.
Doch dann sah ihn die Ärztin unvermittelt an und sagte: »Wir mussten Sie in einem künstlichen Koma halten. Deswegen fühlen Sie sich noch etwas seltsam.«
Er erwiderte den Blick, schluckte, nickte.
»Es war nötig, um alle Gifte aus Ihrem Körper zu spülen. Ich werde Ihnen das alles irgendwann genauer erklären, heute ist nicht der Zeitpunkt dazu. Sie brauchen sich auf jeden Fall keine Sorgen zu machen, Sie sind auf dem Weg der Besserung.«
Gut. Das war gut. Er hatte sich das gedacht, hatte auch das entsprechende Gefühl, aber es war gut, es einmal ausgesprochen zu hören.
Die Ärztin klappte die grüne Akte zu, trat näher, sah ihm forschend ins Gesicht. »Herr Pohl? Verstehen Sie mich?«
Pohl? Wieso Pohl? Er hieß doch nicht Pohl. Das war eine Verwechslung.
Doch, jetzt konnte er es lesen. Auf der Vorderseite der Mappe stand in dicken, großen schwarzen Buchstaben MATTHIAS POHL.
Und er hätte schwören können, dass sein Name Mark war. Mark S. Westman. Oder so ähnlich.
So konnte man sich täuschen.
»Ja«, brachte er heraus. »Ich verstehe Sie.«
»Gut. Wie gesagt, Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Morgen wird es Ihnen schon viel, viel besser gehen. Wir werden dann auch gleich mit dem Aufbautraining anfangen.«
»Okay.«
»Fein.« Die Ärztin wandte sich ab, steckte die Akte zurück an ihren Platz und ging. Die Tür klappte zu, und ohrenbetäubende Stille trat ein.
Kapitel 3
Vergangenheit
Der Vorbesitzer des Hauses hieß Achim Anstätter und war ein kräftiger, braun gebrannter Mann, der mit wiegendem Schritt ging, schwielige Hände hatte und in kurzen, knappen Sätzen sprach. Seine Frau und eine seiner Töchter waren mit ihm gekommen. Vier Kinder hätten sie insgesamt, erzählte die Frau, zwei Jungs und zwei Mädchen, immer schön abwechselnd. Das Mädchen in den hautengen Reithosen war die älteste Tochter. Sie trug die Haare zu einem kecken Pferdeschwanz gebunden, und der Gesichtsausdruck, den sie zur Schau stellte, zeugte von frisch ausgebrochener Pubertät.
Anstätter erklärte, was zum Betrieb des Schwimmbads an Technik erforderlich war. »Das hier ist der Filter«, sagte er und deutete auf einen blauen Zylinder von der Größe eines Wäschekorbs. »Sie schalten hier ab, dann legen Sie diesen Hebel um. So, sehen Sie? Nun schalten Sie wieder ein.« Er zeigte auf ein Schauglas. »Hier, sehen Sie, wie braunes Wasser hochkommt? Da wird der Filter rückgespült. Einmal pro Woche müssen Sie das machen, das reicht. Fünf Minuten, höchstens zehn. Bis das Wasser klar kommt.«
»Man darf nicht vergessen, wieder auszuschalten, nicht wahr?«, warf der Makler ein, der ihnen keinen Schritt von der Seite wich. Vermutlich wollte er verhindern, dass sie heimlich Nebenabsprachen trafen, die sich negativ auf seine Provision auswirkten.
»Genau«, nickte Anstätter ernst. »Sonst pumpen Sie das halbe Becken leer, ehe Sie es sich versehen. Und Wasser ist teuer.«
Werner war in seinem Element. Dorothea überließ es ihm nur zu gerne, sich mit all den Hebeln, Schiebern, Knöpfen und Schalttafeln vertraut zu machen; schließlich war er der Ingenieur im Haus. Sie tat, als höre sie interessiert zu, aber in Wirklichkeit beobachtete sie die Frau und ihre Tochter.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!