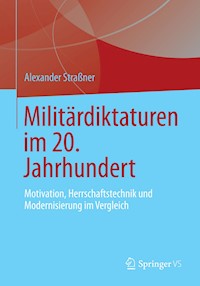Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Vergangenheitsverlag
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Ein Wirtshaus, das nie wirklich schläft, und ein Bub, der früher glaubte, die Welt hinter ihm löse sich in Luft auf – Bayerwald-Blues ist die überraschend zärtliche, manchmal irrwitzige und oft herzzerreißend ehrliche Biografie eines Kindes aus dem hintersten Winkel des Bayerischen Waldes. Alexander Straßner erzählt von einer Kindheit, die gleichzeitig paradiesisch und völlig absurd war: zwischen Feriengästen, die sich benahmen, als wären sie aus einem sehr seltsamen Heimatfilm gefallen, Waidlern von unverhandelbarer Originalität und Eltern, die aus dem Nichts eine Pension samt halbem Dorf zusammenhielten. Hier wird nichts beschönigt: Es gibt Kühe, die auf frisch verlegte Pflastersteine scheißen, Blitze, die durchs Haus wandern, und Bärwurz, der den Charakter härtet. Und trotzdem entsteht ein feiner, leiser Faden von Melancholie zwischen all dem Lachen, Stolpern und Staunen: eine Liebeserklärung an jene Region, in der das Leben oft härter war als der Wirtshausboden – aber auch wärmer als jede Zentralheizung. Ein Buch über Herkunft, Humor und den ganz speziellen Menschenschlag zwischen Arber, Falkenstein und einer Welt, die immer ein bisschen schräg stand.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 467
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bayerwald-Blues
Alexander Straßner
BAYERWALD-BLUES
Geschichte eines Gefühls
Impressum
Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
ISBN: 978-3-86408-360-0
eISBN: 978-3-86408-366-2
Grafisches Gesamtkonzept, Titelgestaltung, Satz und Layout: Stefan Berndt – www.fototypo.de
© Copyright: Vergangenheitsverlag, Berlin / 2026
Am Friedrichshain 22 / 10407 Berlin / [email protected]
www.vergangenheitsverlag.de
Alle Rechte, auch die des Nachdrucks von Auszügen, der fotomechanischen und digitalen Wiedergabe und der Übersetzung, vorbehalten.
Inhalt
Im Trüben
Hinterland
Das Kind im Dorf
Vater & Mutter: Der Komödienstadel im Haus
Weihnachten und andere Feste
Hunde: Echte Freunde und bescheuerte Kläffer
Der Zahn, die Zeit
Nichts brennt so heiß wie die Jugendlieben
Musik: Von den Oberkrainern zum Death Metal und zurück
Eskapaden: Das Wunder, dass ich nicht traumatisiert bin
Sport: Das Kind der Extreme
Wenn es dem Esel zu gut geht, geht er aufs Eis: Das Schicksal herausfordern
„Preissn“ und noch mehr Exoten
Valentinaden und Abstürze: Ein Hamburger im Bayerwald
Der Tod im Haus
Noch nicht ganz am Ende
Für Ferdinand und Josefine.
Die beiden Gründe, wieso es mich gab.
Damit ihr wisst, wer wir waren.
Im Trüben
Der Regen prasselt so laut auf die Straße vor dem leicht geöffneten Fenster, dass er mich langsam aufweckt. Bis in die Mittagsstunden hinein war es der typische Novemberregen gewesen. Ein Nieseln aus einem stahlgrauen Himmel, dessen Wolken in Fetzen bis auf den Boden reichen. Nun aber schüttet es wie aus Kübeln. Ab und zu wird der Wolkenbruch durch spitze Schreie untermalt, weil jemand ohne Schirm hinausmuss oder einfach von ihm überrascht wird. Die Augen lasse ich noch ein Weilchen geschlossen, vielleicht schlafe ich ja noch ein paar Minuten länger, das Geplätscher hat etwas Beruhigendes. „Ausbacken“, nannte das der Vater immer, wenn wir gemeinsam am Wochenende im Elternbett aufwachten und den Entschluss fassten, uns noch ein halbes Stündchen zu gönnen. Der kurze Mittagsschlaf im Büro ist zu einer feinen Routine geworden, der Körper verlangt mittlerweile danach. Meine Frau hat mir dafür ein dunkelblaues, ausziehbares Sofa geschenkt, damit ich mich etwas hinlegen kann, schließlich sei ich „ins Alter gekommen“. Was immer das auch heißen mag. Die beiden Männer an der Paketannahmestelle der Universität waren wenig begeistert, als sie die Lieferung in Empfang nahmen, und wiesen mich etwas zurecht. Sie seien nicht zuständig für private Besorgungen. Ich erklärte, es handle sich um eine „Besprechungscouch“ für Haus- und Abschlussarbeiten, insgesamt völlig unglaubwürdig. Es war mir unangenehm, aber sie akzeptierten zähneknirschend. Ein lieber Kollege half mir beim Tragen des Pakets ins Büro und amüsierte sich unterwegs sichtbar köstlich. Wenn ich die Augen aufschlage, ergreift mich immer für ganz kurze Sekunden ein Zustand der Verwirrung, als wäre die Welt künstlich. Ich weiß dann nicht sofort, wo ich gerade bin: Zuhause, Regensburg, Wien, Zürich, wo mich der Beruf gerade hinverschlägt. Ich blicke auf Unmengen an Büchern, Aufsatzsammlungen, Ordnerrücken. Das ist also aus mir geworden. Wo ist die Zeit nur hingekommen? Draußen an der Tür hängt ein Schild. Professor Doktor, unglaublich, wer hätte das gedacht. Ich jedenfalls nicht. Der erste Akademiker aus der Familie zu sein, ist schon etwas speziell, es dann zu höchsten Weihen gebracht zu haben, fühlt sich fremdartig an. Ganz bin ich in meiner Rolle nie angekommen, ich kann mich nicht ansatzweise so ernst nehmen, wie es die Studenten tun oder einige Kollegen sich selbst. Wie ich am Geräuschpegel vor meiner Tür hören kann, ist schon ordentlich Betrieb, eine halbe Stunde, ehe die Sprechstunde beginnt. Die Kundschaft scharrt schon mit den Hufen. Sicherheitshalber ist die Tür aber zugesperrt. Wer hält sich schon noch an Termine? Und wer möchte während des Arbeitstages beim Schlafen erwischt werden, selbst wenn es nur ein paar Minuten sind? Vielleicht sollte ich statt „Mittagsschlaf “ lieber „Powernap“ sagen, und ich würde dafür sogar bewundert werden. Langsam rapple ich mich auf, strecke die Glieder durch und schiebe die „Besprechungscouch“ wieder auf ihr ursprüngliches Format zusammen. Ich gehe um den Schreibtisch herum und schaue aus dem Fenster ins Grau. Von November bis Februar jeden Tag die gleiche Nebelsuppe. Als ich vor zwanzig Jahren mit meiner Tätigkeit hier begann, ging ich morgens früh aus dem Haus und kam erst spät abends wieder heim. Oft sah ich in diesem Zeitraum die Sonne nicht einmal, wie auch schon während des Studiums. Schließlich bin ich – mit einer zweijährigen Unterbrechung – einfach nur die Donau aufwärts gezogen, von Passau nach Regensburg. Und an der hat es halt nun einmal im „Winter“ immer diesen Schleier über dem Firmament. Draußen rennt eine junge Studentin mit über den Kopf gezogener Jacke vor dem Regen davon und springt in einen dunkelblauen Golf, der seine besten Jahre schon lange hinter sich hat. Studentenleben halt, wahrscheinlich beneide ich sie ein wenig. Vielleicht sollte ich noch ein paar Kleinigkeiten erledigen, ehe der Beratungsmarathon beginnt: Presseanfragen, Verwaltungsnachrichten, sonstiger Kram, der zwar keine Energie kostet, aber aufhält.
Ich muss eines sagen: Ich bin gar kein „richtiger“ Professor. Das heißt, ich habe keinen eigenen Lehrstuhl. Ich bin „nur“ promoviert und habilitiert, durch die Qualifikationsebenen geschritten und habe die Dinge veröffentlicht, die man nun einmal auf den Markt werfen muss, um zu den Titeln zu kommen. Aber auf dieser Stelle des akademischen Mittelbaus wurde ich schon früh verbeamtet. Mit großem Stolz ging ich damals nach Hause, um die frohe Kunde zu bringen. Alle Eltern wollen für ihre Kinder erst einmal materielle Sicherheit. Die Lebenszeitstelle hatte aber ihren Preis. Mehr als doppelt so viel Lehre wie ein „echter“ Professor, dazu die Dinge, die sonst keiner machen will: alle Einführungsveranstaltungen, alle Informationsveranstaltungen und natürlich die Studienberatung. Die bedeutet heute nichts anderes als die Bewältigung oftmals außeruniversitärer, nicht selten psychischer Probleme, für die ich nicht ausgebildet bin. Trotzdem versuche ich, den Leuten zu helfen, wo es geht. Ich kokettiere zwar gerne mit der Behauptung, ich sei ein Misanthrop, und in der Tat gehen mir die meisten Leute recht schnell auf die Nerven. Irgendwie mag ich sie aber gleichzeitig, sie liegen mir sogar am Herzen. Ein Dilemma. Über den Kopf gewachsen ist mir die Aufgabenvielfalt nicht, glaube ich. Aber die Tatsache, dass sich rasch ein gewisser Rhythmus einstellte, führte irgendwann zur Gewohnheit, und die wurde wiederum zu etwas wie Monotonie. Vielleicht ein Beamtenproblem, in jedem Falle aber etwas, das ich stets vermeiden wollte. Ebenso wie charakterliche Untiefen. An der Universität sieht man, wie in jedem anderen Beruf, neben der Vielzahl an angenehmen Menschen immer auch alle schlimmen Auswüchse und Niederungen aus der Verhaltensbiologie: sich wegducken, den anderen vom Futtertrog wegbeißen, das Alphamännchen simulieren etc. Mit dem feinen Unterschied, dass die Menschen hier ihre oftmals überbordende Intelligenz dazu einsetzen, den Kollegen und Untergebenen das Leben schwerzumachen und es darin zur Meisterschaft zu bringen. Ich glaube nicht, dass es Bösartigkeit ist. Der Beruf und vor allem der lange und von Unsicherheiten geprägte Ausbildungsparcours macht das halt aus manchen. Diese Gefahr sehe ich bei mir nicht. Doch früh in meiner Laufbahn habe ich Kollegen, Mitarbeiter, Sekretärinnen und Mensapersonal angemahnt, sie möchten mich bitte sofort ungeniert darauf hinweisen, sollte ich entsprechende Anzeichen zeigen. Bis heute hat es keiner getan. Oder sich nicht getraut.
Noch fünfzehn Minuten, bis der Erste mit sorgenvoller Miene hereintritt und eine Verlängerung für eine Abgabefrist erbittet. Wahrscheinlich ist jemand gestorben. Oder fast. Auf jeden Fall ist ein bester Freund schwer krank, der Hund hat Blähungen, die Busenfreundin hat entbunden oder es ist eine schwere Lebenskrise über ihn hereingebrochen, justament dann, als die Hausarbeit zu schreiben war. Ich strecke mich noch einmal und leiste mir ein letztes Gähnen. Die Lebensgeister kehren zurück. Etwas Neues anzufangen lohnt jetzt nicht mehr, ich wende mich stattdessen von den beiden Bildschirmen ab und drehe meinen Bürostuhl langsam in Richtung der Fenster und darüber hinaus. Unter einem alten Wandregal mit Hunderten korrigierten Haus- und Abschlussarbeiten steht mein altes Akkordeon, auf dem ich im Alter von acht Jahren das Spielen gelernt habe. Es funktioniert noch einwandfrei, nur das gestrichene „g“ klingt ein wenig blechern. Bis heute klimpere ich auch im Büro gerne darauf herum, ab und zu habe ich die Weihnachtsfeier am Institut musikalisch umrahmt oder bei Abschieden von Kollegen ein kurzes Ständchen gegeben. Ansonsten spiele ich nur für mich, öffentliche Auftritte mit dem Instrument sind mir suspekt. Dann kommt das Regal mit den Büchern und Aufsätzen, die von mir stammen. Trotz der vielen Lehre ist doch einiges zusammengekommen. Ich trage mich mit einigen wissenschaftlichen Projekten, die ich noch angehen möchte, kann mich aber seit Jahren nicht aufraffen. Ich gehe mit etwas anderem schwanger. Weiter rechts sind die betreuten Doktorarbeiten in Buchform. Leute, die man (mit) ausgebildet hat, auf einige ist man stolz, bei anderen deckt man das Mäntelchen des Schweigens darüber, so wie sie sich in der Öffentlichkeit äußern. An der Tür hängen Postkarten ehemaliger Studenten, die mir Grüße sandten. Ein Scherzkeks schickt mir jedes Jahr eine Karte aus Las Vegas. Dorthin lädt ihn sein Arbeitgeber stets eine Woche ein, Weltmarktführer für Jalousien, wenn ich mich recht erinnere. Mit einem leichten Lachen frage ich mich, wann der Freistaat Bayern mich einmal nach Las Vegas zu schicken gedenkt. Über der Couch hängen meine Urkunden, eine ganze Batterie an Titeln und Ernennungen sowie ihrer Verlängerungen, sie sind gegenstandslos, Schall und Rauch, machen aber oft Eindruck. Ich hätte sie gerne selber an die Wand gehängt, hätte es aber nie so akkurat hingekriegt wie die eigens dazu abbestellten Mitarbeiter der Universität. Ich hätte nicht einmal gedurft. Der denkmalgeschützte Bau aus grauem Sichtbeton ist voller Asbest. Vater Staat passt auf seine Mitarbeiter auf, solange acht kleine Nägel in die Wand gehauen wurden, durfte ich nicht mal anwesend sein. Über dem Computerbildschirm hängt seit mittlerweile zwanzig Jahren eine kleine Pinnwand. Neben einem Fanschal des VfB Stuttgart finden sich dort Nettigkeiten aus den letzten dreißig Jahren: Gedichte, Anerkennungen, Zeichnungen, originelle Dankeskarten von Studenten und Kollegen, die mir besonders am Herzen lagen. Und natürlich einige Medaillen von sportlichen Großereignissen, wenn die Studenten die Dozenten wieder einmal aussichtslos herausgefordert haben, beim Fußball, Boule oder „Wikingerschach“. Während viele Kollegen, leider auch Studenten, den ersten Burnout schon hinter sich haben, kommt es mir insgesamt nicht wie Arbeit vor. Auch wenn Vorlesungen körperlich anstrengend sind, was ich vorher nicht glauben konnte. Der Beruf ist unwahrscheinlich privilegiert. Freie Einteilung der Arbeitszeit bei exzessiven Freiräumen, dazu ein Gehalt, mit dem eine Familie ernährt werden kann. Das mit Abstand Wichtigste ist für mich aber die sagenumwobene „venia legendi“. Wenn man habilitiert ist, also durch eine zweite große Veröffentlichung die wissenschaftliche Eignung zum Professor untermauert hat, erhält man dafür die offizielle Bestätigung der Lehrbefähigung. Es ist so etwas wie die Immunität parlamentarischer Abgeordneter. In letzter Konsequenz bedeutet sie die didaktische Freiheit, in den eigenen Lehrveranstaltungen machen und sagen zu dürfen, was man will, solange es nicht extremistisch ist. Ich nutze das vor allem, um neben dem fachlichen Brimborium dumm daherzureden, Unfug anzustellen, Anekdoten zum Besten zu geben und Shakespeare zu zitieren. Oft ertappe ich mich dabei, dass ich gerne noch blödeln will, während die Studenten schon lange wieder ernst sein möchten.
Mit zunehmendem Alter habe ich zu meinen ehemaligen Professoren und Vorgesetzten ein anderes Verhältnis bekommen. Nun betrachten sie mich als gleichgestellten Kollegen und öffnen mir auch gerne ihr Herz. Ich werde oft gefragt, wieso ich mich nicht auf Lehrstühle an anderen Universitäten bewerbe. Das habe ich getan, aber nie mit dem nötigen Ernst. Das liegt zunächst einmal daran, dass es heute mehr darum geht, wie viel Geld man für die Universität einzuwerben in der Lage ist, es geht weniger um wissenschaftliche Qualifikation. Das, was mir am meisten Spaß macht, die akademische Lehre, spielt qualitativ sogar überhaupt keine Rolle mehr. Daran will ich mich nicht beteiligen. Auch auf die damit verbundenen verwaltungsrechtlichen Aufgaben in der akademischen Selbstorganisation habe ich wenig Lust. Gremiensitzungen sind für mich eine Qual. In der Regel ist immer schon alles gesagt, aber halt noch nicht von jedem. Ich muss dann immer an den bayerischen Komiker und Sprachakrobaten Karl Valentin denken: „Gesegnet sind diejenigen, die keine Ahnung haben und trotzdem den Mund halten.“ Außerdem gäbe ich damit meine ziemlich herausgehobene Stellung auf. Es ist ausgesprochen amüsant, wenn meine Funktion am Institut es mit sich bringt, dass alle mit ihren Sorgen zu mir kommen. Dabei ergibt sich für mich ein ziemlich plastisches Bild der sozialen Dynamik zwischen den Menschen, und ich kann gut nachvollziehen, wie sie sich gegenseitig mehr oder weniger absichtsvoll missverstehen. Aber darüber hinaus: Wohin könnte mich ein Ruf des Ministers auf einen Lehrstuhl wohl bringen, außer noch weiter weg von meinem Zuhause im Bayerischen Wald? Einer der Kollegen, mein ehemaliger Vorgesetzter und heute geschätzter Freund, dem ich die Stellung zu verdanken habe, meinte spät in meiner Laufbahn:
„Du kannst mit allen Leuten gut umgehen und hast eine einnehmende Art, das fällt anderen einfach schwerer.“
Das ist sicher zu viel des Lobes und der Wertschätzung. Vielleicht nehme ich weder den Beruf noch mich selber zu ernst, vielleicht kann ich an den richtigen Stellen zu allem schweigen, und es macht mir nichts aus, dadurch den versnobten Hyperintellektuellen mit gravierenden sozialen Defekten ebenso für mich einzunehmen wie den unkomplizierten Kollegen, der aus einem niederbayerischen Bauernhof stammt. Auch wenn es mit dem Zweiteren viel weniger anstrengend ist. Der Kollege führte das auf meine Kindheit in Wirtshaus und Pension zurück. Vielleicht war die ja tatsächlich eine gute Voraussetzung für meine berufliche Laufbahn, sagte ich. Als Kind permanent wechselnden Gästeschaften ausgesetzt zu sein, mit allerlei Bedürfnissen und Hirngespinsten, am Stammtisch zwischen lautstark ausgetragenen Meinungsverschiedenheiten zu vermitteln, ist eine gesteigerte Diplomatenausbildung. Doch habe ich auch in mich hineingelacht. Ob er auch dieser Anschauung wäre, wenn er wüsste, was sich dort so zugetragen hat? Der Gedanke, mit dem ich die letzten Jahre schwanger ging, reift jetzt zur Blüte. Ich müsste mich nur hinsetzen und anfangen. Das Loch im Papier finden. Das sich stets dann zu öffnen pflegt, wenn gerade etwas anderes zu erledigen wäre. Noch zwei Minuten, dann wird der Erste an die Bürotür klopfen. Noch ist zugesperrt. Mit einem wehmütigen Lächeln schaue ich auf die wenigen gerahmten Bilder auf meinem Schreibtisch. Meine Frau mit unserem einige Monate alten Sohn, in unserer kleinen Wohnung, wie sie ihn mit geschlossenen Augen an sich schmiegt, einer der wenigen gelungenen Schnappschüsse. Daneben das unvermeidliche, teuer bezahlte Atelierfoto, auf dem wir zu viert (mit der wenig später hinzugekommenen Tochter) grinsen wie die Honigkuchenpferde. Für die Kinder bewusst produzierte Erinnerungen, es wirkt gekünstelt, trotzdem fühlt man sich ohne diesen „Familienschatz“ nicht wohl. Vater hätte gesagt, wir sehen darauf aus wie die in den achtziger Jahren berühmten holländischen „Kirmesmusikanten“, ein Duo mit riesigen Akkordeons. Ihr permanentes Lächeln war so aufgesetzt, dass er stets vermutete, sie hätten ihr Gebiss verkehrt herum eingesetzt bekommen. Neben den Bildern meiner Kinder und meiner Frau finden sich dort auch zwei meiner Eltern. Vater und Mutter in Südtirol, auf einem Bergrücken, von hinten fotografiert sieht es aus, als würden sie Richtung Himmel marschieren. Da die Sonne dem Fotografen entgegenscheint, wirkt das Bild wie ein Scherenschnitt. Vater voraus, den Blick nach vorne, an der Krümmung seiner Schultern und dem nach vorne gereckten Kinn sehe ich, dass er gerade ordentlich grantig ist. Mutter blickt sich um und legt den Kopf schief. Auch ihr Gesicht ist im Schatten, keine Konturen sind erkennbar, trotzdem ist mir, als zeichne sich ein vergnügtes Lächeln ab, als gefalle ihr, was sie sieht. Daneben auf einem anderen Foto Mutter, Vater und ich beim Frühstück mit den Gästen unserer Pension im Bayerischen Wald, ich halte meinen Kopf zwischen die ihren und blicke direkt in die Kamera. Papa schaut zur Seite, er sieht aus, als hätte er gerade einen Witz gemacht, aber in seiner Körpersprache kann man Stolz erkennen. Einer der seltenen Augenblicke, in welchem er sich ganz wohl fühlte. Mutter ruht ganz in sich selbst, kein Wunder, sie ist genau da, wo sie in dem Moment sein will. Ich erinnere mich genau daran, es war ein völlig friedlicher Vormittag, ein seltener Augenblick ohne Hektik und Sorgen. Ich nehme mir ein paar Minuten, soll die Kundschaft doch noch ein wenig warten. Heute wird der Sesam sich erst später öffnen. Oder halt gar nicht. Ich möchte eine Geschichte erzählen. Meine.
Hinterland
Im verschlafenen Walddorf Spiegelhütte war mein Zuhause. Eingepfercht zwischen den Hügeln des „Totenschädels“ (hier wurde dereinst ein grausiger Fund gemacht) und der „Ries“, im Schatten der mächtigen Erhebung des Großen Falkenstein, schmiegt sich der Ort an den direkt hinter ihm aufsteigenden Hochwald. Der Welt abgewandt und fern von ihren echten und imaginierten Problemen, war er Schutzraum und Idylle in einem. Eine Kindheit in einer Pension, die später zusätzlich zum Wirtshaus wurde, im hintersten Bayerischen Wald. In einem Ort, so klein, dass ihn außerhalb eines gezogenen Radius von zehn Kilometern noch heute kein Mensch kennt. In der Literatur, so habe ich einmal gelesen, gebe es nur zwei Themen von Belang, die Liebe und den Tod. Beides ist Bestandteil dieses Buches, doch ist es auch von Interesse, was hier geschah? Ein Motiv für diese Zeilen liegt in meiner späten Vaterschaft. Im zarten Alter von vierzig Jahren wurde ich erstmals Papa, gute zwei Jahre darauf noch einmal. Was würden meine Kinder von meiner Kindheit wissen wollen, die für sie irgendwann graue Vorzeit wäre? Erinnerungen an ihre Großeltern hatten sie nur begrenzt. Immerhin mehr als ich, ich habe fast keine. Nur eine Oma habe ich miterlebt, und die musste sich um die dreißig Enkel und eine erkleckliche Zahl Urenkel kümmern. Bei noch so viel Menschenfreundlichkeit zu viel für ein in die Jahre gekommenes Gehirn. Die andere Oma war gestorben, als ich zwei Jahre alt war. Ich weiß nur noch aus Erzählungen meiner Mutter, dass ich sie hinter dem Wohnzimmerschrank gesucht habe, als sie gerade eingegraben wurde. Sie hatte einen viel zu frühen, aber schönen und beneidenswerten Tod. Bei einem geselligen Beisammensein war sie so sehr von Lachkrämpfen geschüttelt, dass sie den Kopf zur Beruhigung auf der Tischplatte ablegen musste – und ihn nicht mehr emporhob. Die Großväter waren beide bei meiner Geburt schon nicht mehr am Leben, väterlicherseits war er Anfang der sechziger Jahre am Schlaganfall gestorben. Zuvor war ihm im Krieg, irgendwo in Russland, mit einem Fuchsschwanz das brandige Bein ohne Narkose amputiert worden, nachdem Granatsplitter es durchsiebt hatten. Sechs Männer mussten ihn festhalten. Am Bein, das ihm amputiert wurde, hatte er einen großen Leberfleck. Er trug deshalb den Spitznamen „Braunwadl“, den traute sich aber fast niemand in seiner Gegenwart auszusprechen, denn sein Jähzorn war legendär. Der Vater sprach auch auf Nachfragen nie über ihn, weshalb ich nicht mehr von ihm weiß, außer, dass er sein aufbrausendes Naturell, das die gesamte männliche Verwandtschaft kennzeichnet, in seinen dominanten Genen weitervererbt hat. Mutter erzählte mir spät im Erwachsenenalter, dass die Kinder der Familie grundlos arg geschlagen wurden, vielleicht war die Sprachlosigkeit das Ergebnis der Erinnerung an physische und psychische Schmerzen. Der andere Opa war am Herzinfarkt verstorben. Er war lebenslustig, spielte gern Zither und den Lebemann, was seine strenge Frau ihm in schöner Regelmäßigkeit zu verbieten suchte. Besonders den Konsum alkoholischer Spezereien, was ihr nicht oft gelang. Gar nicht abgewöhnen konnte sie ihm, so zu tun, als wäre er reich. Einmal hatte er durch glückliche Fügung zwei Tausendmarkscheine in seinem Besitz, was ihn dazu veranlasste, sie permanent mit sich zu führen und überall herumzuzeigen. Auch im Wirtshaus, wo er sich in der Regel so amüsierte, dass ein gedankenloses Hantieren damit angesichts ortsansässiger Schlawiner nicht ungefährlich war. Seine Frau brachte er damit auf die Palme. Vielleicht hatte er auch Angst vor ihr. Seine letzten Worte ihr gegenüber sollen von dem Schwur untermauert gewesen sein, nichts getrunken zu haben, weil er sich wegen seines akuten Herzleidens auf offener Straße erbrochen hatte. Die sehr frommen und tratschsüchtigen Nachbarn hatten dahinter natürlich einen ordentlichen Rausch bei hellem Tageslicht vermutet.
Für meine Kinder sollte das anders sein, sie sollten ein plastischeres Bild der Geschichte ihrer Kernfamilie väterlicherseits erhalten. Also suchte ich das Heil im Papier, um sicherzustellen, dass die eigene Kindheit nicht durch Vergessen verloren geht. Aber um ehrlich zu sein, die Mutter lag mir bereits seit Jahren in den Ohren, ich möge das Geschehene niederschreiben, weil so viel passiert und es doch „so schön gewesen“ sei, einfach als Erinnerung für uns. Die Entscheidung war also nur halb meine eigene. Die Mutter war Wirtin aus Leidenschaft, sie lebte diesen Beruf und existierte für ihn. Ohne Ausbildung hatte sie sich hingebungsvoll der Gastronomie gewidmet und ein Lebensarbeitspensum abgespult, das jeglicher Beschreibung spottet. Leben war Arbeit und umgekehrt, eigene Bedürfnisse wurden hintangestellt. Und schön war es in der Tat, es ist aber ein Wort, das es nicht ganz trifft. Für mich war es eine Kindheit und Jugend, prall gefüllt mit sozialen Kontakten, ein Fundus an aufeinanderfolgenden Erlebnissen und außergewöhnlichen Begebenheiten. Was der Tag bringen mochte, wusste kein Mensch. Das weiß man zugegeben nie, aber die Wahrscheinlichkeit, etwas Bemerkenswertes zu erleben, war groß. Das lag nicht wie heute an der verbreiteten Sehnsucht nach der optimalen Vermarktbarkeit des eigenen Alltags oder in aufgeblasenen Oberflächlichkeiten begründet, die ohne große Umwege in die sozialen Medien finden. Es war die Fähigkeit der Menschen, in ihrer alltäglichen Umgebung Großes zu bewirken, und es waren ihre Abgründe, die mich faszinierten. Ich fand hier Vorbilder in jeglicher Hinsicht, Menschen, denen ich nacheiferte, und welche, mit denen ich nichts gemein haben wollte. Einige prägen mich bis heute, nicht nur die, an welche ich gute Erinnerungen habe. Denn es war eben nicht immer „schön“, sondern oftmals bizarr, befremdlich, komisch und absolut schockierend gleichermaßen, und so detailwie pointenreich, was sich hier zutrug. Mancher Eindruck hat sich über die Jahre verändert und ich blicke heute aus unterschiedlichen Perspektiven auf die gleichen Geschichten – was ich früher lustig und großartig fand, befremdet mich heute, was ich einst abstoßend fand, interessiert mich nun. Vieles steht in milderem Licht. Früh prägte sich mir ein, dass jeder für das, was er so treibt, seine Motive hat, ganz gleich, wie sonderbar es sich für mich darstellen mag.
So wurde daraus ganz nebenbei eine kleine Milieugeschichte der Menschen des Bayerischen Waldes und derjenigen, die hier Urlaub machten. Mit der Zeit schälten sich Episoden aus dem Langzeitgedächtnis, die mir eine sehr frühe Kindheitserinnerung ins Gedächtnis riefen: Das kann nicht ganz real sein, was hier passiert. Gibt es solche Menschen wirklich? Passiert diese Situation, die so ausgesucht dasteht, als ob ein fürchterlich unbegabter Drehbuchschreiber sie sich kunstvoll ausgedacht hätte, in der Realität? Mit solcherlei Gedanken schwanger, wurde aus dem fröhlichen und lebendigen Buben gleichzeitig ein nachdenklicher und melancholischer. Und ein seltsamer, für andere Augen. Ich begann, alles und jeden infrage zu stellen. Meine Eltern bekamen es mit der Angst zu tun, als ich ihnen mitteilte, dass ich manche Menschen nicht für echt hielte. So, wie die sich aufführten, kein Wunder. Der Gedanke, dass alle Gäste mir nur Theater vorspielten, damit ich ja glaubte, ich sei der Sohn meiner Eltern, mag noch als klassisch gelten. Sich aber im zarten Alter von acht Jahren permanent ruckartig umzudrehen, weil ich die Realität dabei erwischen wollte, wie sie sich hinter mir auflöst und rasch wieder zusammensetzt, weil sie – von wem auch immer – nur für mich konstruiert worden war, versetzte die Mutter in größere Sorge. Dabei war das, wie ich später lernen sollte, nur ein Nachweis für die Befähigung zur Philosophie. Bis heute beschleicht mich bei Begegnungen mit allzu seltsamen Mitmenschen der Verdacht, die Welt, die ich sehe, sei eine Folie, ein Bildschirm. Ich schiele dann verstohlen auf die oberen Ecken meines Wahrnehmungsfeldes, in der Überzeugung, dort stehe wie bei alten Fotos irgendwo einmal ein Eselsohr ab, und ich könne dann die Scheinwirklichkeit abziehen und die wirkliche Welt dahinter sehen.
Hier, wo, wie es oftmals und angesichts des Eisernen Vorhangs nicht ganz unrichtig hieß, die Welt zu Ende war, war die ganze Vielfalt der Welt im Kleinen zu finden. Hier verbrachten fehlerhafte Menschen ihren Urlaub, den wir Mängelwesen ihnen anboten, in einer kleinen Familienpension, die meine Eltern aus dem sprichwörtlichen Nichts, der Armut und Verzweiflung aufgebaut hatten. Zwischen den Gästen aus aller Herren Länder, den mürrischen und liebenswerten Einheimischen, „geschnitzten Waidlern“ allesamt, und meiner Familie verbrachte ich meine Kindheitsjahre. Doch unabhängig von mir: Mit der Lektüre des Geschriebenen löste ich mich von der Vorstellung, diese Zeilen wären nur für meine Kinder oder stellten eine kleine Dorfgeschichte dar. Vielleicht sind sie ein kleiner Spiegel der Menschen der achtziger Jahre, ihres Humors, ihrer Lebensweise und damit einer verlorenen Zeit, vielleicht dienen sie nur der Auffrischung meiner Erinnerungen. Was sich dort zutrug, wo Fuchs und Hase sich gute Nacht sagten, ist Gegenstand dieses Buches. Alles andere ist Beiwerk, Nebenprodukt, vielleicht ein Kollateralschaden. Dieses Buch soll alles sein, eine Lebenserzählung, eine Erklärung, wie das heute Vorfindbare entstanden ist, vielleicht eine Rechtfertigung, aber auch ganz sicher eine Liebeserklärung an meine Heimat, meine Lebensgeschichte und vor allem an meine Eltern, denen ich unendlich dankbar bin für dieses gewöhnliche kleine Leben, das ich führen durfte.
Wenn ich die einzelnen Kapitel rückblickend lese, stelle ich fest, dass es immer viel um Eskapaden geht. Das liegt freilich in der Natur des Betriebs, aber nicht an den Menschen, von denen die wenigsten ein echtes Problem mit Alkohol oder anderen Süchten gehabt haben dürften. Die einzelnen Kapitel und Abschnitte verfolgen keine tiefere Logik, sie sind geordnet nach Themenbereichen, die mir immer mal wieder gedanklich zuflogen, und sollen einigermaßen chronologisch darlegen, was mir so widerfahren ist. An Erfreulichem, Traurigem und vor allem Verrücktem.
Doch Obacht, eine Warnung: Schwache oder sensible Gemüter, besonders hochmoralisch veranlagte Menschen, die mit dem Humor vermeintlich bildungsferner Milieus der achtziger Jahre nichts anfangen können oder sich kunstvoll darüber echauffieren, könnten schockiert sein. Besonders, was die zeitgenössisch bildreiche Sprache, Geschlechterverhältnisse, generelle Lebensgestaltung, erotische Einsprengsel, Umgangsformen, Alkoholkonsum oder das Fehlen einer kindgerechten Umwelt betrifft. Ich werde nichts verschweigen, auch wenn die Schilderungen drastisch sind, weder was mich noch andere betrifft. Wer glaubt, ich würde damit das Andenken lieber Menschen verraten, hat das Buch nicht bis zum Ende gelesen, womit ich leben könnte, oder hat es nicht verstanden, was mir auch egal ist. Regen Sie sich nicht auf, schon gar nicht künstlich! Ich hoffe, Sie tragen keine schwereren Schäden davon, sollten Sie bei der Stange bleiben. Immer daran denken: Ein Bub hat das seine gesamte Kindheit und Jugend hindurch ausgehalten, dann werden Sie es in Gottes Namen auch verkraften.
Der fünfzigjährige Bub sitzt immer noch in seinem Drehstuhl, das leise Murmeln vor der Tür wurde in den letzten Minuten zu einem verwirrten Grundrauschen. Zaghaft wurde einmal an der Tür geklopft. Ich habe es ignoriert. Einen Sturm der Entrüstung gibt es nicht, dafür ist die Kundschaft heutzutage zu brav, zu meiner Zeit wären wir wohl etwas fordernder gewesen. Ich höre am Rande mit, dass an benachbarten Bürotüren, der Heimat der Assistenten und Sekretärinnen, dafür umso lauter geklopft wird. Hier ist die Hemmschwelle niedriger. Ob die Sprechstunde des Herrn Professors ausfällt und was man nun machen solle. Ich höre die Befragten antworten, dass sie mich zwar heute schon gesehen hätten, ich ihnen über meinen Verbleib aber keine Rechenschaft schuldig sei. Im Grunde ist es aber gegenstandslos, die nächste Sprechstunde ist ohnehin schon am Tag darauf, sie dauert dafür dann eine Stunde länger und alle sind zufrieden. Das macht es mir leicht, die Augen zu schließen und wieder zum Kind zu werden. Das Gleiten zwischen den Episoden meines Lebens gelingt mir mit dem Alter immer müheloser. Da ich schon immer viel in der Vergangenheit gelebt habe und bestimmte Ereignisse meines Lebens meist erst im Nachhinein richtig erlebt habe, kann ich ganze Tage aus der Erinnerung wachrufen. Während vereinzelt auf Klassentreffen konstatiert wird, dass man sich an ganze Jahrgangsstufen nicht mehr zu erinnern vermag, kann ich problemlos kleinste Details wachrufen. Ob das ein Privileg ist oder Belastung, vermag ich nicht zu sagen. Bilder, Gerüche, Melodien bringen dann die vergangene Wirklichkeit zurück und ermöglichen es mir, das konkrete Gefühl des jeweiligen Tages wachzurufen, an manchen Tagen ist es mir möglich, einzelne Begebenheiten nachzuerleben. Ich gebe zu, dass die Erinnerung daran oftmals schmerzvoll ist, die ganze Grausamkeit der Melancholie schlägt dann mit Wucht zu. Als die Eltern noch jung waren, oder das Gefühl einer beschützten Kindheit, dieses sorgenfreie In-den-Tag-hineinleben. Es zieht dann im Magen und es gibt kaum unbelastete Gedanken. Vieles davon ist bestimmt vom Mitleid mit den Eltern, wie sie sich im hintersten Wald abgemüht haben, um etwas Eigenes aufzubauen und mir ein besseres Leben zu ermöglichen, als sie es hatten.
Das Kind im Dorf
Tief drin, im hintersten Bayerischen Wald, direkt an der tschechischen Grenze, findet sich der Landstrich zwischen dem Großen Arber und dem Großen Rachel, der als „Zwieseler Winkel“ bekannt ist. Hier ging der Philosoph Friedrich Nietzsche einst spazieren, konnte ich in einer überregionalen Tageszeitung in meiner Jugend einmal lesen. Der Schriftsteller Adalbert Stifter beschrieb die sanft gewellte, ineinandergreifende Ansammlung geschwungener Hügel als „Waldbuckelwelten“. Hermann Göring, der Reichsjägermeister, hätte gerne aus dem Landstrich einen privaten Jagdgrund für sich, andere Nationalsozialisten und Staatsgäste gemacht. Die einheimische Bevölkerung plante er zwangsweise umzusiedeln. Gott sei Dank war seine Zeit zu kurz bemessen. So blieb der Winkel den „Waidlern“ und die Welt von seinen sonstigen Einfällen verschont.
Zieht man auf einer Landkarte mit dem Lineal einen waagerechten Strich von Regensburg in Richtung tschechischer Grenze nach Osten, landet man genau in Spiegelhütte. Der ehemalige Glasmacherort liegt verloren im Waldmeer, die nächsten Ortschaften Jungmaierhütte und Scheuereck sind jeweils einen guten Kilometer entfernt und so klein, dass sie eher als Einsiedelei durchgehen, und so wirkte mein Zuhause mit seinen fünfundzwanzig Häusern und nicht einmal hundert Einwohnern auf mich geradezu städtisch. Obwohl Spiegelhütte so klein ist, verteilen sich die Bebauungen auf ein hügeliges Terrain, was dem Dorf Charakter verleiht.
Im Zentrum – dem Ursprung seiner Existenz – standen wie so oft im Bayerwald die großen Gebäude der ehemaligen Glashütte. Die hatte sich als Erste hier angesiedelt, worauf die Arbeiter folgten und ihre Behausungen herum bauten. Auf ihrem Höhepunkt beschäftigte sie mehr als zweihundert Arbeiter und war weltberühmt. Sie lag in der Talsohle des Weilers und bestand aus zwei großen Haupthäusern, in denen die Glasfertigung stattfand. Einige Jahre lang wurde hier vor allem Spiegelglas produziert, was dem Dorf seinen Namen gab. Die Gläser aus der Hütte, die dem Zahn der Zeit standgehalten haben, sind heute Raritäten und wertvolle Exponate. Einige davon finden sich in der Eremitage in St. Petersburg. Die Schleiferei, wo das Glas „gekugelt“, also durch Gravuren oder eben Schleifscheiben veredelt wurde, fand sich am südlichen Ende
Spiegelhütte in einer alten Aufnahme. Links die Jugendstilvilla, ganz rechts die ersten Häuser des „Zitronenviertels“, in der Mitte die beiden großen Gebäude der ehemaligen Glashütte. Genau dazwischen, teilweise von Bäumen verdeckt, unser Haus. Ca. 1950.
des Dorfes. Sie war am Ende eines steil abschüssigen Abhangs in Richtung Lindberg jenseits der später gebauten Hauptstraße zu finden, der bis heute die Bezeichnung „Schleif “ trägt. Als Kind mit dem Fahrrad den Berg „in d’Schleif “ hinunter und wieder hinauf zu fahren, galt als ebenso ultimative Herausforderung wie „d’ Hirschngred affe“ (einen kleinen, aber steilen Hügel in der Dorfmitte, benannt nach dem Eigentümer des dort einmal stehenden Wirtshauses und dem davor liegenden ebenen Platz, der „Gred“). Beides waren recht manierliche Steigungen, sie versinnbildlichten den wahrgenommenen Übergang zum großen Kind. Wer die „Hirschngred“ hinauftreten konnte, war schon wer. Das architektonische Highlight, wenn man die „Hirschngred“ hundert Meter weiter hinaufging, war hingegen die auf dem höchsten Punkt Spiegelhüttes thronende Jugendstilvilla der Glashüttenherrn. Es ist ein heute denkmalgeschützter, wunderschöner Bau mit alten Mosaiken in seinem Inneren und einem charakteristischen Zwiebelturm, der neben dem alten Schloss in Buchenau zu den Aushängeschildern des Winkels gehört. Als ich ein Kind war, wollte meine zehn Jahre ältere Schwester den Bau kaufen, um nach dem Vorbild der Mama einen Fremdenverkehrsbetrieb darin zu errichten. Die horrenden laufenden Kosten, die zahlreichen Regeln und Verbote bei einem eventuellen Umbau wegen Denkmalschutz und nicht zuletzt der Kaufpreis aber schreckten sie ab. Heute finden sich darin schmucke Appartements, die von Menschen aus aller Herren Länder zusammengekauft wurden, die seither als Eigentümergemeinschaft fungieren. Hinter der Villa gibt der Wald den Blick langsam frei auf den Großen Falkenstein, unseren Hausberg, und den Großen Arber, die etwas weiter entfernte, höchste Erhebung des Bayerischen Waldes. Neben seinem charakteristischen „Richard-Wagner-Kopf “ ist er geprägt von zwei Türmen mit futuristischen Kuppeln. Sie dienen heute der Überwachung des Luftraums in Tschechien bis hinunter nach Venedig, während des Kalten Krieges wurde ausschließlich gen Osten hineingehorcht. Mein älterer Bruder verhonepipelte die Feriengäste gerne, indem er ihnen auf Nachfrage eröffnete, es handle sich dabei um Gewächshäuser für den Bärwurz, den heimischen Schnaps. Ich versuchte es ihm gleichzutun und präsentierte die Legende vom sagenumwobenen „Wolpertinger“, einem Fabelwesen des Bayerwaldes. Der war eine Mischung aus Biber, Marder, Hirsch, Ente und allerlei sonstigem Getier und allein in der Morgendämmerung zu fangen, und auch dann nur, wenn ihm Salz auf die Pfoten gestreut wurde.
Neben der Glashütte in Richtung Norden stand das kleine, dem heiligen Stephanus geweihte Kirchlein, in welchem als Kind ministriert wurde, was das Zeug hielt. Ein schmuckloser Holzbau, aber gerade deshalb so authentisch, seine Mittagsglocke teilte für alle den Tag. Meine Tante, die Schwester meiner Mutter, verrichtete ihre Aufgabe der Mesnerei mit Hingabe und Leidenschaft. Sie war eine extrem kleinwüchsige, dünne Frau mit Rehaugen und einer gewissen Güte in der Stimme. Sie hatte eine Behinderung an einem Bein, die Oma war während der Schwangerschaft gestürzt. Wie früher üblich, wurden Menschen mit Handicaps vor der Gesellschaft zurückgehalten, was sie ein wenig seltsam werden ließ. Sie bereitete den Gottesdienst vor und läutete auch zu Mittag, was immer unfreiwillig komisch aussah. Ihr geringes Gewicht führte dazu, dass sie durch den nach oben schnellenden Strick, der die Glocke in Bewegung setzte, stets ein wenig in die Luft gehoben wurde. Stets befürchtete ich, sie würde einmal im Glockenturm verloren gehen, da die Kordel sie mit hinaufgezogen hätte. Daneben hatte sie die Totenglocke zu läuten, wenn jemand im Dorf verstorben war. Es war dieser Augenblick, in dem wir als Kinder im Spiel gespannt innehielten und darauf lauschten, ob das Läuten („Gebetläutn oda hod’s oan derprackt?“) zwischendurch aussetzte, das untrügliche Anzeichen, dass einer der Alten aus dem Leben geschieden war. Hinter der Kirche ging es wiederum steil bergauf, die Straße in Richtung des Grenzkamms hinauf. Im Gegensatz zum Dorfkern kamen die Häuser hier als Erstes in den Genuss der Morgensonne, und abends ging sie auch recht spät dort weg, was dem Teil des Dorfes im Lauf der Zeit den wenig ernsthaft gemeinten Namen „Zitronenviertel“ eintrug. Wie im Rest des Dorfes gedeihen hier aber nur die Obstbaumklassiker, wenn man Glück hat und der Biber nicht über Nacht alles fällt. Am westlichen Dorfausgang in Richtung Scheuereck stand das alte Schulhaus. Hier waren bis Ende der fünfziger Jahre des 20. Jahrhunderts die Dorfkinder untergebracht, alle in einer Klasse von einem Lehrer unterrichtet, von dem meine Mutter noch heute voller Begeisterung erzählt. Haselnussstecken und „Tatzen“ (ein schmerzhafter Schlag auf die Finger oder, besonders niederträchtig, auf den Hintern) zur Züchtigung waren an der Tagesordnung. Das Einzugsgebiet der Schule war indes nicht nur das Dorf selbst. Besonders in der Nachkriegszeit, als in den umliegenden Weilern und Einöden einzelne Flüchtlingsfamilien mehr hausten als wohnten, kamen die Schüler auch von weiter her. Das bemerkenswerteste Beispiel waren sicher die Kinder vom Schachtenhaus. Dort hatten sich nach den Wirren des Zweiten Weltkrieges zwei Familien zusammengefunden, um die ersten Jahre der Neuorientierung zu bewältigen. Die Kinder von dort hatten einen drei Kilometer langen Weg bergab hinter sich zu bringen, besonders in den eiskalten Wintern eine Herausforderung, wenn der Schnee schon für die Erwachsenen hüfthoch gefallen war. Sie schliefen in der Regel sofort nach Unterrichtsbeginn ein und wurden durch den Lehrer auch nicht geweckt. Nach Schulschluss traten sie den beschwerlichen Heimweg an, die gleiche Strecke steil bergauf. Diese Kinder gehörten zu unseren Gästen in der Pension, lange nachdem sie erwachsen und ins Württembergische ausgewandert waren, und sie erzählten mit leuchtenden Augen und in den buntesten Farben von ihrer Kindheit.
Unser Haus war vor über hundert Jahren die Residenz des Glashüttendirektors. Relativ nah am Dorfzentrum gelegen, wurde es nach 1931 ein Forsthaus, nachdem die Glashütte infolge eines verheerenden Sturms 1929 und im Zuge der Weltwirtschaftskrise schließen musste. Danach teilten sich mehrere Parteien den großzügigen Bau. Ganz oben unter dem Dach residierte fortan ein bis heute weitum bekannter Arzt, der den Menschen des Dorfes ebenso bei ihren Zipperlein half, wie er Kälber auf die Welt brachte. Das Haus stand gegenüber der Glashütte und wurde offiziell um das Jahr 1910 herum gebaut, auch wenn einzelne Hinweise auf ein viel früheres Baujahr, wahrscheinlich um 1870, existieren. Die Front des Hauses zeigt nach Süden und bietet bis heute an sonnigen Tagen nicht nur eine wunderbare Aussicht, sondern auch reichlich Wärme für die wenigen Balkontage, die im Bayerischen Wald möglich sind. Schließlich ist der im restlichen Bayern gebräuchliche Aphorismus, demzufolge es im Bayerwald ein halbes Jahr lang Winter sei und das andere halbe Jahr kalt, zumindest in meiner Kindheit zwar ein Vorurteil, aber doch nicht ganz falsch gewesen.
Im Gegensatz zu den meisten anderen Bauten im Dorf hatte unser Haus ein Blechdach, das durch die langen Jahre hinausgezögerter Renovierungen bereits Grünspan und eine ordentliche Portion Rost angesetzt hatte. Mehrere kleine Gauben zierten das Haus, sodass das Dach insgesamt ungemein verwinkelt daherkam und bei einer Modernisierung irgendwann richtig ins Geld gehen würde. Da es noch keine unterirdischen Stromleitungen gab, verlief die Hauptstromleitung über das Dach, wie bei allen anderen auch. Bei den oft mörderischen Gewittern und Stürmen kam es nicht
Postkartenmotiv von Spiegelhütte, mit der Orthografie nahm man es nicht immer so genau. Unser Haus von der Ostseite gesehen, das zweite Haus von rechts. Dahinter das spätere Forsthaus, ganz im Hintergrund am Waldrand das alte Schulhaus. Ca. 1950.
selten vor, dass der Strom tagelang ausblieb, weil irgendwo zwischen den Dörfern wieder eine Fichte umgefallen war und die Überlandleitungen zu Boden gerissen hatte. Da dann auch in den Folgetagen wegen der Reparaturen oftmals nur das halbe Dorf Strom hatte, tauschten die Nachbarn fleißig die Inhalte ihrer Tiefkühltruhen aus, bis wieder alles normal lief. Einige Abende verbrachten wir mit unseren Gästen in der Wirtsstube bei Kerzenschein und heimeligen Geschichten, ein willkommenes Abenteuer. Angst hatte ich keine, solange meine Eltern in der Nähe waren. Die eingeschränkte Verköstigung machte mir da schon mehr Probleme. Auf mein flehentliches Bitten, mir einen warmen Kakao zuzubereiten, antwortete Mama mir mit dem Hinweis auf fehlende Elektrizität. Dass das auch bedeutete, keinen Tee an seiner Statt schlürfen zu können, wollte mir nicht recht einleuchten.
Unter dem Dach war das oberste Geschoss mit einer Vielzahl kleiner Kämmerchen. Im Lauf der Jahre hatten die Eltern in zahlreichen Umbaumaßnahmen Nischen und Ecken gefunden, wo Duschen, kleine Sitzgruppen oder Kinderzimmer eingebaut werden konnten. Was übrig blieb, wurde zum Stauraum für Gerümpel. Das Dachgeschoss war daher ideal für Familien mit Kindern. Im Jugendalter diente es mir als Refugium für meine ersten harmlosen Liebeleien mit den Gästetöchtern. Das Blechdach erwies sich als doppelter Nachteil: Erstens wurde es direkt darunter stets fürchterlich heiß, unabhängig von der Jahreszeit genügte direkte Sonneneinstrahlung. Zweitens hatten sich in der dünnen Isolationsschicht zwischen Dach und Balken Zehntausende von Fliegen eingenistet, die dort fröhlich ihrer Fortpflanzung nachgingen und denen man auch bei täglicher Putzroutine nicht Herr wurde. Das mittlere Stockwerk war außen dunkel holzvertäfelt, in der Mitte der Südseite mit einem großen Innenbalkon versehen, in welchem so viele Schwalben nisteten, dass an eine Nutzung nicht zu denken war, so verdreckt war die Enklave. Die Gästezimmer in diesem Bereich waren aber recht beliebt, weil sehr hoch und herrschaftlich mit alten, imposanten Türzargen ausgestattet, die bei früheren Umbauten unangetastet geblieben waren. Der Nachteil dieser Räume bestand darin, direkt über der Gaststube zu liegen, in der es abends hoch herzugehen pflegte. Wer dort unterkommen wollte, musste entweder einer derjenigen sein, die stets als Letzte zu Bett gingen, oder einen entsprechend tiefen Schlaf haben.
Hinter dem Haus befand sich eine große Scheune. Sie fungierte bei vorherigen Eigentümern als Schweinestall und Speicher für Dinge, die
Nach 1945 war unter den aus den tschechischen Gebieten Vertriebenen ein Maler, der das Dorf in vielen Dutzend Zeichnungen detailgetreu wiedergab. Hier links unser Haus fast dreißig Jahre, ehe meine Eltern es erstanden, von den Gebäuden der Glashütte aus gesehen.
nicht entsorgt werden konnten oder sollten. Alte Dachziegel, Matratzen, Bretter und Dachlatten lagen dort kreuz und quer durcheinander. Besonders fasziniert war ich von einem großen Holzzugschlitten, der dort angelehnt war und auf dem die Holzhauer ihre halsbrecherischen, oft auch tödlichen Fahrten vom Hochwald herunter unternahmen, hinter sich mehrere hundert Kilo Holz aufgeschichtet. Mit den Jahren wurde auch dieser alte Bau einer Nutzung zugeführt. Erst legten sich die Eltern Tiere zu, Hühner, Schweine, viel später sogar einmal Kamerunschafe. Dann baute sich der Vater eine kleine Werkstatt mit einem Schleifbock ein, wo er an ruhigen Tagen seinem Beruf nachging, um sich etwas dazuzuverdienen. Ende der achtziger Jahre wurde die Scheune aufwendig renoviert und ein Wohnhaus für unsere Familie daraus gemacht.
Auch wenn die Rückschau immer romantisiert, so war es in der Tat ein Aufwachsen im Paradies. Das Haus war riesig und schon von daher ein ausgezeichneter Ort für Spiel- und Rückzugsmöglichkeiten. Hinter und neben dem Haus breitete sich jeweils eine große Blumenwiese aus, auf der zahllose Margeriten, Sauerampfer, der Hahnenfuß und rote Stängelgewächse (von uns als Kinder „Nasenbluter“ genannt) gediehen. Die Grünflächen dienten dem letzten Bauern des Orts als Weidegrund für seine wenigen Kühe. Die notdürftige Umzäunung konnte die Huftiere kaum bändigen, nicht nur einmal schaute ich nach Öffnen der Haustür in das teilnahmslose Gesicht einer Kuh, die ausgebüxt war und auf unserer Terrasse genüsslich wiederkäute. Ganz ungefährlich war das nicht. Ich erinnere mich lebhaft einiger gestarteter Angriffe auf harmlos vorbeigehende Spaziergänger und Wanderer, die in Panik Reißaus nahmen. Abends schickte mich die Mutter gerne hinüber zum Bauern, um einen Liter frische Milch zu holen. Ich hatte zwar wegen der beiden großen Hunde Angst, aber die Bäuerin schöpfte rasch mit einer großen Kelle die frisch gemolkene Milch aus einer breiten, flachen Schüssel in meine „Milbidschn“ (Henkelkrug), sodass ich schnell wieder verschwinden konnte. Die Hunde hatten ohnehin kein Interesse an mir. Gesundheitliche Bedenken hatte niemand, und ich entsinne mich des unvergleichlichen Geschmacks der euterwarmen Milch. Wenn ich zu Hause ankam, fehlten bereits einige große Schlucke. Der Bauer selbst war ein Schlawiner nach meinem Geschmack. Er hatte einen diebischen Spaß am Frühschoppen in der „Tanne“, dem Wirtshaus meines Onkels, das damals noch gegenüber der Villa betrieben wurde und das nach einem einstmals am Ortsausgang Richtung Jungmaierhütte stehenden riesigen Baum benannt war. Als Kind sah ich davon nur noch den am Boden verfaulenden Stamm. Der Bauer hatte seine helle Freude vor allem am Schafkopf, dem bevorzugten Kartenspiel. Dabei konnte er sich freuen wie ein kleines Kind. Gar nicht so sehr, wenn er Geld gewann, sondern wenn er jemand anderem die Tour vermasseln konnte und der „nach Böhmen fahren“ („ins Beehm fohrn“), also seine auf dem Tisch liegenden Münzen aus dem Geldbeutel aufstocken musste. Zur Dorfgemeinschaft hielt er stets eine kritische Distanz. Seine kindliche und freundlich ansteckende Boshaftigkeit war sein Markenzeichen, noch als erwachsener Mann unterhielt ich mich gerne mit ihm und lauschte seinen zahllosen Anekdoten. Sein Husarenstück lieferte er nach der Dorferneuerung, einer kostspieligen Neugestaltung des ganzen Dorfes im Rahmen einer großzügigen Förderung durch das Landesamt für Ländliche Entwicklung. In deren Zuge war auch der Dorfplatz neben der Kirche neu gepflastert worden, eine mühselige und langwierige Arbeit, in deren Verlauf ich die Arbeiter durch unser Küchenfenster derb fluchen hörte. Unmittelbar nach Fertigstellung war es seine erste Amtshandlung, seine Kühe von der Wiese neben unserem Haus in Richtung des heimischen Stalls zu treiben, selbstverständlich über die frisch verlegten Pflastersteine. Er ließ sich dabei so lange Zeit, bis wirklich die letzte Kuh ihren Fladen dort hinterlassen hatte, während er die Tiere ausgiebig lobte („Guad, Meusn!“, in etwa: „Gutes Mädchen!“) und sich sein diebisches Lachen nicht verkneifen konnte. Ein Skandal sondergleichen, der schöne neue Dorfplatz, kurz vor der Einweihung. Sogar der Bürgermeister und der Ortspfarrer hatten sich angekündigt, was würden die wohl sagen. Das unverwechselbare Äußere dieses kleinen, hageren Mannes fußte auf zwei Dingen: seinem wilden Vollbart und dem hellbraunen Cordhut. Als sich Jahre später abzeichnete, dass ich beruflich nach Regensburg gehen würde und er mit seiner gesamten Familie einmal bei uns zur Feier eines runden Geburtstags war, fixierte er mich über Minuten hinweg vom Nachbarstisch. Es war mir nicht unangenehm, ich mochte ihn ja sehr und fand ihn in seiner Art, der Welt körpersprachlich und verbal zu signalisieren, dass sie ihm den Buckel runterrutschen könne, vorbildlich. Irgendwann blickte ich zurück und bedeutete ihm wortlos mit einem Augenaufschlag, ob er etwas sagen wolle. Er nahm den Löffel, mit dem er schon geraume Zeit gespielt hatte, aus dem Mund und meinte:
„Wirst de Deandla in Rengschburg durchananda bringa wia a Holzfuchs!“
Was immer er damit meinte, es stimmte nicht. Es war das letzte Mal, dass ich ihn sah, mit ihm redete. Er starb nach einem Zusammenbruch auf der Wiese neben unserem Haus, angelehnt an einen Holzpflock, am schwachen Herzen. Seine Angehörigen haben nach seinem Tod ein Bild auf seinem Grabstein anbringen lassen, das ihn als das Original zeigt, das er zu Lebzeiten war. Wenn ich genau hinhöre, kann ich ihn dort lachen hören.
Für uns Kinder bot sich draußen eine Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten: Fahrradfahren kreuz und quer und ohne den unnötigen Ballast verkehrspolitischer Regelung, spontanes Fußballspielen auf einem jährlich selbst gemähten Platz, die Tore aus situativ gefällten Bäumen nebenan gezimmert, Pilze („Schwammer“) im Überfluss und kleinliche Streitereien, wie sie für die ländliche Idylle so typisch sind, mit eingepreist. Hinter dem Haus nichts als Wald, drei Kilometer bergauf, bis zur böhmischen Grenze, damals Sperrgebiet. Meterhohe Hinweisschilder in deutscher und englischer Sprache, dass man dabei sei, den amerikanischen Sektor zu verlassen und Lebensgefahr bestünde. Der Wald so hoch und dicht und schwarz, dass man im Sommer die drei Kilometer bis hinauf zu den „Schachten“ gehen konnte, ohne einmal in der Sonne zu sein. Die Schachten waren meine ganze Kindheit hindurch ein stets sofort erreichbarer Sehnsuchts- und Rückzugsort und blieben es bis heute. Es handelt sich dabei um Inseln im Waldmeer, die von den Glashüttenherrn der Umgebung gerodet worden waren. Ab dem 16. Jahrhundert ließen hier die frühneuzeitlichen Bauern ihr Jungvieh den Sommer über weiden, im Herbst wurde das Vieh abgetrieben. Es waren einzelne, teilweise riesige Lichtungen mit hohem Gras und Heidelbeersträuchern, soweit das Auge reichte. Im Glatthafer liegend konnte man einen ausgedehnten Mittagsschlaf halten. Den ganzen Tag sah man dort keinen Menschen. Auf ihnen standen verstreut alte, knorrige Bäume, die schon diverse Blitzschläge überstanden haben mussten und den Viehhirten einst als Unterstand dienten. In bizarren Verrenkungen boten sie vor allem bei Hochnebel einen faszinierenden Anblick und tauchten die Landschaft in eine gespenstische Szenerie. Diese Kleinode repräsentierten das Lebensgefühl der damaligen Zeit. Der Blick auf die böhmischen Berge gegenüber der Grenze versinnbildlichte, dass hier die Welt zu Ende war. Der Eiserne Vorhang machte die greifbar nahe Welt dort drüben unerreichbar. Oft saß ich mitten im kniehohen Gras und fragte mich, wie
Die Schachten, hier der Frauenauer Schachten („Almschachten“). Jeden Sommer unternahmen wir mehrere Wanderungen mit den Gästen hinauf in die malerische Landschaft, die von den wettergegerbten Baumriesen geprägt wurde. Ca. 1995.
es für die Menschen gegenüber wäre, hier in die so nahe und doch nicht zu erlangende Freiheit zu blicken. Die Wiesen wurden dadurch für mich noch kostbarer. Diese Perlen, kaum verzeichnet auf Wanderkarten, waren Geheimtipps und wollten sanft erkundet und vorgeführt werden. Nicht selten rückte dazu das ganze Haus aus.
Die Eltern und alle Hausgäste starteten nach dem Frühstück zu gemeinsamen Streifzügen in die Wälder und Berge auf, stets ein großes Ereignis für mich, denn Kinder waren immer dabei. Auch die Erwachsenen hatten daran ihre Freude, irgendjemand musste immer betreut werden, immer drohte einer auf dem Weg durch das urtümliche Urwaldgebiet „Höllbachgspreng“ auf den Falkenstein liegenzubleiben oder gar verlorenzugehen. Immer war einer kurz vor Herzinfarkt oder Schlaganfall, weil er Distanz und Schwierigkeitsgrad unterschätzt hatte, oder wenigstens wurde jemandem bei den riesenhaften Felsen, die Überbleibsel des kleinen Gletschers der letzten Eiszeit waren, schwindelig oder mindestens eine(r) grantig. Gott sei Dank war der Vater bestens ausgebildeter Notfallsanitäter. Zu diesem Zweck hatte er stets seinen alten Bundeswehrrucksack mit großen und kleinen Pflastern, Verbandszeug und vor allem mit den beiden wichtigsten Dingen dabei: Klopapierrolle und Flachmann mit Bärwurz-Notration. Beides kam stets zum Einsatz, vor allem die Männer bedurften des ein oder anderen Schluckes. Dass sich der ekelhafte Wurzelschnaps derartiger Beliebtheit erfreute, ist mir bis heute ein Rätsel. Schon die Bewerbung durch die Zwieseler Firma, die ihn herstellte, ließ nichts Gutes erahnen. In bildreicher Sprache wurde beschrieben, dass der erste Schnaps ganz furchtbar schmecken würde, der zweite nur noch halb so wild, während der dritte dann bereits als recht bekömmlich gefeiert wurde. Wir gaben den Gästen gleich am ersten Tag daher den Ratschlag, die ersten beiden Stamperl sofort in den Blumentöpfen zu entsorgen und erst den dritten zu trinken. Wenn die Gäste des Hauses auf den gemeinsamen Wanderungen die Luft tief einsogen, einen langen Seufzer der Erholung taten und mir einbläuten, ich wüsste gar nicht, was für gute Luft wir hier doch hätten, wusste ich nicht, was sie meinten. Vielleicht, so sinnierte ich beeinflusst von der seltsamen schwarzen Pädagogik meines ersten Religionslehrers, lebten sie ja in der Nähe der Hölle (wo irgendwo eine Gegend namens „Ruhrgebiet“ liegen musste), wo es meiner Vorstellung zufolge nach Schwefel riechen und ferne Brände den Himmel erhellen müssten. Die Winter hatten ihren Namen mehr als verdient, bis zu einem Meter Neuschnee über Nacht war keine Seltenheit. Der Schnee war bei entsprechender Kälte so weich und tief, dass das Spielen darin grenzenlose Möglichkeiten bot. Neben den üblichen Schneeballschlachten wurden Höhlen und Burgen gebaut, Berge aufgetürmt, von halsbrecherischen, todesverachtenden Fahrten mit Ski und Schlitten ganz zu schweigen. Doch musste die weiße Pracht auch irgendwohin. Unser großes Grundstück wurde mit „Schneehexen“ von uns geräumt, nach vorne konnte der Schnee in den vorbeifließenden Mitterbach geschüttet werden. An der seitlichen Umrandung türmten sich irgendwann gigantische Schneewehen von bis zu drei Metern auf, die wir Kinder nach dem Schaufeln sofort als Abenteuerspielplatz nutzten.
Wenn die Schneelast zu groß wurde, geriet es für die teilweise doch sehr alten Gebäude zum Problem. Ich begleitete dann den Vater gerne hinauf auf das Dach, um beim Abschaufeln dabei sein zu können. Einmal geriet die gesamte Schneelast ins Rutschen, während er auf dem Dach stand. Vater blickte erst irritiert um sich herum, wurde dann aber die fünf Meter hinunter in den weichen Schnee fortgerissen, das war nicht ungefährlich. Gerade als er mit rudernden Armen von der Dachkante stürzte, ging die Mutter im Vorderhaus am Fenster vorbei und konnte nur zusehen, wie er wenige Sekunden in der Luft herumfuchtelte und kurz darauf im Schnee wie in einer Daunendecke einsank. Statt dass sie sich Sorgen um sein Wohlergehen gemacht hätte, lachte sie lauthals und schlug sich auf die Schenkel, während der Vater sich mit einem verwirrten Gesichtsausdruck aus dem lockeren Schnee zu befreien versuchte.
Der Papa beschwerte sich wenig ernsthaft über ihre mangelnde Empathie, die eine Fortsetzung fand: Gute zwanzig Jahre später lebten wir schon im Hinterhaus. In einer Nacht schneite es fünfzig Zentimeter reinen, schweren Pappschnee, der ordentlich auf das Gebälk der ehemaligen Scheune drückte, es knarzte und quietschte an allen Ecken und Enden. Wir machten uns schon Sorgen, ob die Dachbalken die Last würden tragen können. Die Mama brachte sich mitten in der Nacht, aufgeweckt von den unheilvollen Geräuschen, lieber in Sicherheit und schlief vorne im Wirtshaus. Das Einzige, was sie zusätzlich zu ihrem Leben beschützte, war der neue und sündteure Staubsauger, den sie vorsichtshalber mit sich nahm. Den schnarchenden Vater ließ sie liegen.
Winter in Spiegelhütte, beim Abschaufeln des Dachs am Hinterhaus, links am Rand das Kirchlein, dahinter das alte Schulhaus, 1979.
Die Sommer waren geprägt von sonnigen, nicht zu heißen Tagen und abendlichen Gewittern, die ihrem natürlichen Auftrag gerecht wurden. Erst als die große Trinkwassertalsperre in Frauenau gebaut wurde, zog die Wassermenge die elektrisch aufgeladenen Zellen für alle Zeiten an. Bis dahin hatte ich erlebt, wie mein Vater bei allzu schweren Wetterstürzen um das Haus patrouillierte, um zu kontrollieren, ob noch jeder Stein auf dem anderen sei. Nicht nur einmal kam er schneeweiß zurück, weil er erlebt hatte, wie der Blitz in der Nähe einschlug, Funken und Flammen aus Steckdosen sprühten, Sicherungen flogen und durchschmorten oder er das Feuer in den abfließenden Regenmengen auf der gegenüberliegenden „Hirschngred“ gesehen hatte. Der Höhepunkt war ein Blitzeinschlag in unserem Haus. Mutter, Schwester und ich standen in der offenen Tür, um die anrollenden Gewitterwolken zu bewundern. Noch ehe es zu regnen begonnen hatte, war es auf einmal gleißend hell, begleitet von infernalischem Krachen. Mit einem Mal lagen wir alle drei auf dem Boden. Der Vater, der in seiner Werkstatt auf dem Schleifbock gesessen hatte, kam mit fahlem Gesicht zur Tür herein und schwor Stein und Bein, der Blitz sei links von ihm aus der Steckdose heraus und auf der gegenüberliegenden Seite der Werkstatt wieder hineingefahren. Ein Stamperl Bärwurz tat den Nerven gut, sodass die Arbeit rasch wieder aufgenommen werden konnte.
Es gab nur drei Fernsehprogramme, kein Handy, kein Internet, die Kinder des Dorfes (ich war der Jüngste, alle anderen bis zu fünf Jahre älter, was damals Lichtjahre zu sein schienen) fanden sich nach Schulschluss oder Hausaufgaben zum gemeinsamen Fußballspiel oder Skifahren zusammen oder versuchten sich auf dem Fahrrad in diversen Wettrennen zu überbieten. Das Glück bescherte uns die Auflösung der ortsansässigen Feuerwehr, freilich nicht ohne vorher noch rasch das hundertjährige Jubiläum in einem unanständig großen Dorffest mitsamt Bierzelt auf einer abschüssigen Wiese am unteren Ende des Dorfes, mitten in der „Schleif “, abzuhalten. Dass das Bier hier schief im Maßkrug stand, störte keinen Menschen, auch wenn der Heimweg für die deutlich angeschickerten Erwachsenen dem Kampf gegen Windmühlen gleichkam, sturmgebeugt, wie sie sich den steilen Berg hinaufmühten.
Unser Glück bestand nun darin, dass nach dem Verkauf des Feuerwehrautos das Gebäude für den Spritzenwagen ein Leerstand wurde. Eine Feuerwehr in einem Dorf mit so wenigen Einwohnern wäre ein heute
Eine Luftaufnahme zu Beginn der neunziger Jahre. Im Zentrum das einzige verbliebene Gebäude der ehemaligen Glashütte, rechts schräg gegenüber davon unsere Pension mit Hinterhaus. In der Mitte oben das „Zitronenviertel“, links unten die „Schleif “. Ca. 1991.
kaum mehr vermittelbares Unterfangen, es erfüllte aber ganz ohne Zweifel die Funktion des sozialen Zusammenhalts. Tatsächliche Notfälle gab es keine bis auf einen, und laut Erzählungen der Alten ging er zurück auf die Vorliebe eines Mitglieds der Feuerwehr für Zündeleien, ein wenig boshaft und sicher übertrieben wurde er als Pyromane bezeichnet. Als die Scheune neben dem Zelesnyhaus an der Durchfahrtsstraße nach Buchenau in meterhohen Flammen stand, war also der Tag gekommen: ein echter Einsatz. Wie der Zufall es wollte, waren viele Mitglieder der Feuerwehr im damaligen Wirtshaus „Zur Tanne“ und hatten umgehend den Weg zum Feuerwehrhaus hinunter angetreten. Dort aber verlor der Erste, der verletzungsfrei angekommen war, in der Aufregung den Schlüssel zum Spritzenhaus in der davor liegenden Wiese. Fortan bestand die Aufgabe der anderen Feuerwehrmänner darin, auf der Suche nach dem Schlüssel hektisch auf allen Vieren herumzurobben, derweil das Feuer sich gemächlich die Scheune einverleibte. Wer nicht bei der Feuerwehr war, umstand und bewunderte den faszinierenden Brand. Mit großer Enttäuschung und reichlich Schmach wurde festgestellt, dass die Feuerwehr aus dem zehn Kilometer entfernten Zwiesel schon mit den Löscharbeiten beschäftigt war, als sich die tapferen Männer noch zwischen den Maulwurfshügeln verlustierten. Ich bin mir nicht sicher, ob sich diese Geschichte so zugetragen hat, es klingt ein wenig nach Schildbürgerstreich. Aber aus verschiedenen Quellen habe ich sie ähnlich vermittelt bekommen. Auf jeden Fall bedeutete die nun freistehende Bebauung in der Dorfmitte für uns ein, wie man heute sagen würde, Jugendzentrum, neben dem Fußballplatz wurde es für uns zum Mittelpunkt des Dorfes. Als sich dann auch noch die Eltern eines Freundes bereit zeigten, darin ihre Tischtennisplatte aufzustellen, waren für uns die Zeiten legendärer Turniere gekommen, in welchen wir die Weltrangliste (im Tennis) nachstellten. Die Älteren hatten das Vorrecht auf die damals besten Spieler (Lendl und McEnroe), die Jüngeren mussten sich mit den Unbekannteren zufriedengeben. Heute kann unsere ehemalige Rangliste an der Hinterwand des Häuschens noch bewundert werden, die notdürftig aus Schreibblöcken herausgerissenen Pappstücke haben dem Zahn der Zeit getrotzt. Hier wurde gelacht, gestritten, gerauft, und es begannen die ersten schlüpfrigen, aber harmlosen Heftchen ebenso zu kursieren wie die ein oder andere Flasche mit „Schnaps“ (im schlimmsten Falle Sahnelikör). War ich einmal alleine zu Hause und kein Kind als Spielkamerad zur Verfügung, nutzte ich den Vorteil, dass unser Haus direkt gegenüber lag, schlich hinüber und konsumierte die vor den Erwachsenen gut versteckten Spezereien heimlich. Der Schlauchturm, wo nach Übungen und Einsätzen die Schläuche zum Trocknen aufgehängt worden waren, dient heute einer Hundertschaft von Fledermäusen als Unterkunft.