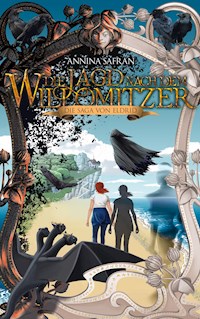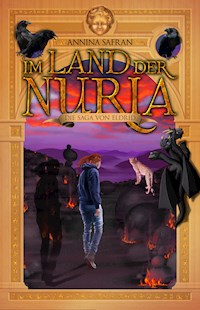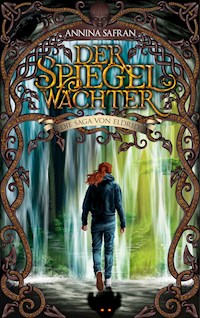8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Drachenmond Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Bearbind Lyceum – ein Ort, an dem sich die Wege von Hexen, Dämonen und Gewöhnlichen kreuzen und uralte Geheimnisse bewahrt werden. Gegen ihren Willen wird die 16-jährige Thilda auf das Bearbind Lyceum geschickt, ein Internat, das einst schon ihre Stiefmutter besuchte. Der düstere Ort, der an eine strenge Erziehungsanstalt erinnert, ist eine Hexenschule. Statt sie willkommen zu heißen, schlagen Thilda dort Hass und Schikanen entgegen. Mehr noch: Durch ein dunkles Ritual wird ein uralter Dämon an sie gebunden und ihr Schutzgeist meldet sich zu Wort, der sie seit vielen Jahren begleitet, von dem sie aber bisher nichts wusste. Gelingt es Thilda, mit seiner Hilfe die dunklen Geheimnisse von Bearbind zu ergründen und das wahre Motiv zu enthüllen, warum ihre Stiefmutter sie genau in dieses Internat abgeschoben hat?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 695
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Bearbind Lyceum
THILDA
ANNINA SAFRAN
Copyright © 2025 by
Lektorat: Maya Shepherd
Korrektorat: Lillith Korn
Schlussredaktion: Ute Berkels
Layout Ebook: Stephan Bellem
Illustration Print: Jana Stehr
Kartendesign Print: Magali Volkmann
Umschlag- und Farbschnittdesign Print: Jana Stehr
ISBN 978-3-95991-985-2
Alle Rechte vorbehalten
Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining
im Sinne von §44b UrhG ausdrücklich vor.
Inhalt
Playlist
Karte
Die Veränderung
Viola
Die Ankunft
Die Madame Matron
Der Schlafsaal
Der Morgenappell
Die Tests
Die Pflanzen- und Kräuterkunde
Die Beschwörung
Der Schutzgeist
Der Internatsalltag
Die PK-Kleingruppe
Das PK-Aufnahmeritual
Pria
Der Dschinn
Die Eisige
Die Aussprache
Das Ritual der Kiesel-Hexen
Die Nachricht an Shanti
Die erste Lektion des Dschinns
Die Suche nach einem Lehrort
Die Zutaten
Die Initiation
Der neue Alltag
Der Benimmkurs
Der Bericht des Bhuta
Das Nachsitzen bei M. M.
Die Isolation
Die Lehrstunden beim Dschinn
Nighty
Shanti
Der Dämon der M. M.
Der Ruf nach den Ahnen
Das Warten
Das Verhör und Urteil
Das Ritual der Hohepriesterin
Der langersehnte Besuch
Epilog
Danksagungen
Drachenpost
Dieses Buch ist für alle,
die an Magie glauben
und für meine Schwester,
die sich schon auf die nächste Reise begeben hat.
Playlist
Gin Wigmore – Hallow Fate
Taylor Swift – Fortnight (feat. Post Malone)
Dasha – Austin
Doechii – Anxiety
Lola Young – Messy
Lady Gaga & Bruno Mars – Die With A Smile
Billie Eilish – everything i wanted
Rockwell – Somebody’s Watching Me
Devlin – Watchtower (feat. Ed Sheeran)
Imagine Dragons – Demons
Halsey – Without Me
Hozier – Too Sweet
Alex Warren – Chasing Shadows
Wale – Lovehate Thing (feat. Sam Dew)
Billie Eilish – THE DINER
Imagine Dragons – Wrecked
Lord Huron – The Night We Met
David Kushner – Daylight
Keane – Somewhere Only We Know
Die Veränderung
An dem Morgen, der mein Leben für immer verändern sollte, saß ich beim Frühstück im Esszimmer meines damaligen Zuhauses, genoss den frisch gepressten Smoothie und die Ruhe. Das waren die schönsten Morgen, bevor es zur Schule ging. Kein Gezeter meiner Stiefschwestern, kein Rumgekeife ihrer Mutter und kein genervtes Zeitungsrascheln meines Vaters. Einfach nur Ruhe. Herrlich. Und dann kam es. Wie ein Knall. Oder eher wie ein Tsunami. Die Sekretärin meines Vaters rauschte herein, blickte sich kurz um und steuerte dann auf mich zu.
»Ah, Miss Thilda, gut, ich habe dich schon überall gesucht.« Sie wirkte gehetzt und für die frühe Stunde schon völlig fertig mit den Nerven.
»Du hast mich gesucht?« Ich tupfte mir mit der Stoffserviette den Mund ab und sah sie fragend an.
»Dein Vater schickt nach dir.«
»Schickt nach mir?« Ich lachte auf. »Edith, wie oft muss ich dir noch sagen, dass man das so nicht sagt, das ist total altmodisch.« Edith war schon seit vielen Jahren für meinen Vater tätig und ich quasi mit ihr aufgewachsen. Ihren leichten Akzent und die Ausdrucksweise hatte sie sich bewahrt, auch wenn wir oft darüber lachten. An jenem Morgen erwiderte sie mein Lachen nicht.
»Es ist ernst, Miss Thilda. Er ist sehr aufgebracht. Am besten kommst du sofort mit.«
Ich nahm einen letzten Schluck von meinem Smoothie, nickte dabei, damit Edith keine Schnappatmung bekam, und stand auf.
»Ich komme«, fügte ich hinzu, als sie sich an der Tür hektisch nach mir umdrehte. Sie musterte mein Outfit und zog kurz eine Augenbraue hoch. Ich trug die obligatorische Schuluniform der Privatschule, auf die ich ging. Mit einer Handbewegung deutete sie auf die Bluse, die ich noch nicht in den Rock gesteckt hatte. Ein Zeigefinger schnellte hoch zu meinen langen braunen Haaren, die ich hastig zu einem Knoten zusammensteckte, dann folgte ich ihren schnellen kleinen Schritten über den langen Flur. So aufgeregt hatte ich sie selten erlebt.
»Was will er denn?«, fragte ich, als ich sie endlich eingeholt hatte.
Sie hob die Schultern. »Kann ich nicht sagen.«
Ich bremste ab. »Vielleicht sollte ich es aber wissen, damit ich vorbereitet bin.«
Die schon in die Jahre gekommene Dame in dem schwarzen Kostüm drehte sich zu mir um und blickte mir in die Augen. Sie sah ernsthaft besorgt und traurig aus. »Miss Thilda, es tut mir sehr leid, aber darauf kann ich dich nicht vorbereiten und das solltest du von ihm selbst hören.« Hatte sie da etwa Tränen in den Augen? Ich starrte sie entgeistert an.
»So schlimm?« Ein Kloß bildete sich in meinem Hals.
Edith hatte sich jedoch schon wieder umgedreht und eilte auf die Tür zum Büro meines Vaters zu. Davor hielt sie kurz inne, atmete tief durch und klopfte dann fast energisch an.
»Herein«, ertönte die Stimme meines Vaters aus dem Inneren.
Sie öffnete die Tür für mich, trat aber nicht ein. Stattdessen blieb sie stehen, senkte den Blick und ließ mich an ihr vorbei in das Zimmer treten. Sobald ich ein paar Schritte in den Raum getan hatte, schloss sie die Tür hinter mir. Ganz leise und sacht. Ihr Verhalten gefiel mir gar nicht, es sorgte für ein ungutes Gefühl in der Magengegend. Der Nachgeschmack des Smoothies war plötzlich bitter.
»Du wolltest mich sprechen?«, fragte ich mit heiserer Stimme und blickte zu meinem Vater, der hinter seinem Schreibtisch saß. Der gesamte riesige Raum war in Dunkelheit getaucht. Es war zwar schon hell draußen, aber die schweren Vorhänge und der starke Baumbewuchs direkt vor den Fenstern verhinderten, dass zu viel Tageslicht hineingelangte. Mein Vater mochte es gern dunkel, wenn er arbeitete. Zu viele Lichtquellen irritierten ihn. Eigentlich liebte ich sein Arbeitszimmer. Es hatte dunkle Holzverkleidungen an den Wänden, Regale voller Bücher bis zur Decke, selbst der Boden war aus demselben dunklen Holz. Die wenigen Lichtquellen verliehen dem Raum eine schummrige fast verträumte Atmosphäre. Doch an diesem Tag wirkte alles bedrohlich auf mich. Das Gesicht meines Vaters lag im Schatten, aber schon seine Haltung verriet mir, wie angespannt er war. Nur die Lampe auf dem Schreibtisch brannte und warf einen Schatten auf seine Hände, die zu Fäusten geballt auf einem Stapel Papiere lagen.
»Hat Edith dich endlich gefunden«, stellte er mit eisiger Stimme fest.
Ich nickte und wagte ein paar Schritte auf ihn zu. »Ich war beim Frühstück«, hob ich an, aber mein Vater schnitt mir mit einer Handbewegung das Wort ab.
»Komm her, Thilda.« Er winkte mich zu sich heran.
Er nannte mich selten bei meinen Namen, als ob er es vermied. Meist hatte er Kosenamen für mich oder umging eine direkte Anrede. Das ›Thilda‹ verhieß nichts Gutes. Vorsichtig setzte ich einen Schritt vor den anderen. Dabei ließ ich meinen Vater nicht aus den Augen. Er trommelte mit den Fingern auf der Tischplatte, bis ich schließlich einen knappen Meter vor ihm stehen blieb. Ich wagte es nicht, mich zu setzen.
»Dieses Mal bist du zu weit gegangen.« Seine Stimme war vor Wut verzerrt und glich mehr einem Knurren.
»Was meinst du damit?«, flüsterte ich. »Daddy?«
»Nenn mich nicht so und verkaufe mich nicht für dumm.« Bei dem letzten Wort wurde seine Stimme lauter und noch eisiger. »Ich weiß Bescheid, ich weiß alles und du lässt mir keine Wahl.«
Ich versteifte mich, wagte jedoch nicht, noch einmal zu fragen. Ich war mir keiner Schuld bewusst, konnte mir nicht vorstellen, was ihn derart verärgert haben konnte. Und er war wütend. So wütend, wie ich ihn noch nie zuvor erlebt hatte. Offenbar erwartete er eine Reaktion oder eine Antwort von mir, denn er fing wieder an, mit Fingern auf die Tischplatte zu trommeln. Ich hatte keine Ahnung, was ich sagen oder tun sollte, also wartete ich ab.
Nach ein paar Sekunden des Schweigens und Anstarrens erhob er sich ruckartig. »Thilda, du hast mich sehr enttäuscht. Dein Verhalten ist inakzeptabel.« Sein Gesicht lag nun nicht mehr im Schatten, es war kreidebleich und seine dunklen Augen funkelten. »Wie konntest du nur so tief sinken? Drogen, Thilda? Kokain?«
In mir fing sich alles an zu drehen. Kokain? Ich nahm keine Drogen, erst recht kein Kokain. Meine Gedanken rasten. Was redete er da? Langsam schüttelte ich den Kopf.
»Hast du dazu überhaupt nichts zu sagen«, donnerte er so plötzlich los, dass ich zusammenzuckte. Er stützte sich mit beiden Händen auf dem Tisch ab und schob Kopf und Oberkörper vor. Instinktiv wich ich einen Schritt zurück.
»Papa, bitte, du musst mir glauben«, meine Stimme zitterte. »Ich nehme keine Drogen. Das ist die Wahrheit.« Schon in dem Moment, als ich es aussprach, wurde mir klar, dass er mir nicht glauben würde. Er hatte sich sein Urteil bereits gebildet, das verriet mir seine Haltung. Wenn er so weit war, konnte ihn so gut wie nichts vom Gegenteil überzeugen. Ich hatte jetzt schon verloren. Alles in mir sackte nach unten in die Magengegend. Drogen? Wie konnte er nur glauben, dass ich Drogen nahm? Und dann auch noch Kokain. Keine der weichen Partydrogen, die auf meiner Schule und in unserem Club im Umlauf waren, nein, Kokain. Natürlich kannte ich Leute, die das nahmen. Zu dem Klischee der ›rich kids‹ gehörte auch der Konsum von Kokain. Das war normal, zumindest in den Kreisen, in denen ich mich bewegte. Doch ich nahm weder weiche noch harte Drogen und erst recht kein Kokain. Was Drogen betraf, war mein Vater unerbittlich, das wusste ich. Schon vor Jahren hatte er mir das Versprechen abgenommen, keine zu nehmen. Daran hatte ich mich gehalten. Und jetzt traute er mir zu, Kokain zu nehmen? Ein tiefes Loch bohrte sich in mein Herz. Wie kam er nur darauf? Und dann hatte ich noch nicht einmal das Recht auf eine Verteidigung? Das war nicht fair. In diesem Moment wurde mir mal wieder bewusst, wie tief die Kluft zwischen uns war. Und alles nur wegen ihr. Ich biss mir auf die Unterlippe.
»Ist das alles?«, fragte er. War da auch noch Hohn in seiner Stimme? Mein Herz raste. Ich stand nur da, hob die Schultern, unfähig, mich zu verteidigen. Die Worte blieben mir im Hals stecken, denn ich kannte ihn, wenn er sich so verhielt. Nichts, was ich jetzt noch vorbrachte, würde er glauben. Er glaubte mir schon so lange nicht mehr. Resignation machte sich in mir breit. »Mehr hast du nicht zu sagen? Ich fasse es nicht.« Er sprach nun leise und beherrscht. Langsam, ganz langsam schüttelte er den Kopf. »Ich bin deine Lügen so satt, Thilda. Doch dieses Mal kannst du mich nicht um den Finger wickeln. Dieses Mal bist du zu weit gegangen.« Er lachte freudlos auf. »Es gibt Beweise.«
»Beweise«, keuchte ich. Was für Beweise? Hatte er das Zeug etwa hier? Im Haus?
Mein Vater hob drohend einen Zeigefinger, schwieg aber. Ich wagte es nicht, noch einen Mucks von mir zu geben.
In diesem Moment öffnete sich die Tür und eine Gestalt trat ein. Elegant, hochgewachsen, mit leisem Schritt. So wie er es liebte. Bloß keinen Lärm machen. Beim Anblick meiner Stiefmutter entspannten sich sofort seine Züge. Es war, als würde sie ein Beruhigungsmittel ausströmen, das nur er wahrnahm. Fast geräuschlos schloss sie die Tür wieder. Sie trug schwindelerregend hohe Schuhe, so wie immer, und dennoch schwebte sie über das Parkett, als sei sie barfuß. Ich presste den Mund zusammen. Natürlich musste sie sich einmischen. Seit sie in das Leben meines Vaters getreten war, gab es kein ›Wir‹ mehr für ihn und mich. Das ›Wir‹ gehörte jetzt zu ihr und ihm. Ganz langsam, aber zielsicher hatte sie mich in den letzten vier Jahren aus seinem Leben verdrängt und sich selbst hineingezwängt. Nichts entschied er ohne sie. In alles weihte er sie ein. Auch hier, bei diesem Vorwurf, musste sie natürlich an seiner Seite stehen. Oder hatte sie sogar etwas damit zu tun?
Misstrauisch betrachte ich sie, wie sie so selbstgefällig lächelnd neben mich trat und meinen Vater anstrahlte. Sie musste etwas damit zu tun haben. Wahrscheinlich hatte sie es sogar eingefädelt. Mir wurde schlecht.
»Marnie, Liebling«, seufzte er. »Ich bin gerade dabei, mit ihr zu sprechen.«
Wortlos hielt sie ihm einen großen Umschlag entgegen.
Mein Herz hämmerte in der Brust. Was ging hier vor? Unsicher blickte ich zwischen den beiden hin und her.
»Es ist alles arrangiert«, sagte sie mit leiser sanfter Stimme. Die blonden langen Haare lagen in perfekten Wellen über ihren Schultern. Ihr Outfit war wie immer bis ins letzte Detail abgestimmt, alles vom Feinsten und Teuersten, so wie sie es am liebsten mochte oder wie es meinem Vater an ihr gefiel. So genau wusste ich das nicht. Auch wenn es nicht mein Geschmack war, musste ich – nicht ohne Neid – zugeben, dass sie sich toll kleidete und pflegte. Sie war alles andere als unattraktiv. Das war aber auch das einzig Positive, was ich ihr zugestand. An diesem Tag trug sie eine steife faltenfreie weiße Bluse, einen dunkelblauen knielangen schwingenden Rock mit hohem Bund, darüber einen breiten Ledergürtel, der ihre schmale Taille noch besser hervorhob und, wie bereits erwähnt, Stilettos mit mindestens zehn Zentimetern Absatz. Sie lief immer mit hohen Absätzen durch die Gegend, was ihr den Spitznamen Barbie eingebracht hatte, zumindest in meinem Kopf. Eigentlich war Barbie ein viel zu netter Spitzname, aber er passte perfekt zu ihrem makellos durchgestylten Äußerem.
Das Schnauben, das mir aus der Nase entweichen wollte, konnte ich nur mühsam unterdrücken.
»Das kommt genau im richtigen Moment«, erwiderte mein Vater. Er nahm ihr den Umschlag aus der Hand und knallte ihn auf den Schreibtisch. Ich machte vor Schreck einen Satz. Diese Heftigkeit kannte ich nicht von ihm.
»Schau mich an, Thilda«, befahl er. Seine Miene war wieder angespannt, die Augen funkelten wütend. Marnie tänzelte um den Tisch herum und stellte sich neben ihn. Als sie meinen Blick bemerkte, lächelte sie triumphierend. Was für eine Show. Sie war brillant, wenn es darum ging, ihn um den Finger zu wickeln. Sie und ihre hinterhältigen Satansbraten.
»Unser letztes Gespräch über Diebstahl und Alkohol liegt nicht lange zurück.« Die Stimme meines Vaters war eisig. »Alkohol ist das eine, aber Drogen …« Er hielt inne und fixierte mich. »Harte Drogen, Thilda, du lässt mir keine Wahl mehr.« Ein weiteres Seufzen, fast ein Stöhnen, als leide er unter Schmerzen. »Marnie war so freundlich und hat ein hervorragendes Internat in Südengland rausgesucht, richtig, Liebes?«
Barbie nickte und lächelte süßlich. Sie hatte ihre Fassade fest im Griff.
»Internat?« Ich rang nach Luft und Fassung. Sie wollten mich loswerden, mich abschieben. Und zwar nach England. Nicht irgendwo in Deutschland, was vielleicht noch in erreichbarer Nähe gewesen wäre, insbesondere für meine Freunde, nein, nach England und wenn er Südengland sagte, dann meinte er sicherlich irgendwo in der Pampa. Meine Gedanken überschlugen sich. Das war also der Plan gewesen. Die ganze Zeit schon. Seit Monaten heckten die drei etwas aus. Barbie und ihre Töchter, Anastasia und Agnes. Die A’s, wie ich sie nannte. A wie Aasgeier. Ihre Engel und meine Erzfeindinnen. Oh, wie ich sie hasste. Diese Gören. Hinterhältig, verwöhnt, gierig und bösartig von der übelsten Sorte. Gezielt hatten sie mit ihren geplanten Aktionen den Weg für den heutigen Tag geebnet. Das wurde mir in dem Moment schlagartig klar. Alles hatte mit einer Vase begonnen, einem Familienstück meines Vaters, an dem er sehr hing, die zu Bruch gegangen war. Die A’s waren zu ihm gerannt und hatten mich beschuldigt, sie kaputt gemacht zu haben. Glücklicherweise hatte unsere Haushälterin eine von ihnen dabei beobachtet, wie sie das Stück absichtlich zerschmettert hatten. Sie war für mich in die Bresche gesprungen und hatte es brühwarm meinem Vater erzählt. Statt dass er die Boshaftigkeit hinter dieser Aktion durchschaut hatte, hatte er es auf die Unsicherheit der ›Kleinen‹ geschoben, wie er sie liebevoll nannte. Von wegen klein, sie waren 16 und 14 Jahre alt und alles andere als unsicher. Schließlich lebten sie schon seit Jahren bei uns. Er behandelte sie aber immer noch wie rohe Eier und ließ ihnen alles durchgehen.
Die zerbrochene Vase war nur der Anfang gewesen. Immer wieder tauchten Dinge in meinem Zimmer auf, Gürtel, Schals oder auch Tops, stets mit einem Etikett und einer Diebstahlsicherung aus einem Geschäft versehen. Damit wollten sie mir Diebstahl unterstellen. Natürlich stahl ich nicht. Wozu auch? Ich hatte stets genug Geld auf der Bankkarte und die Kreditkarte meines Vaters, wenn ich mir etwas kaufen wollte. Das sah mein Vater genauso, doch die Entdeckungen der vermeintlich von mir gestohlenen Gegenstände häuften sich und er wurde skeptischer. Erst konnte ich ihn noch von meiner Unschuld überzeugen. Schließlich kamen alle Teile aus Läden, die ich freiwillig nie betrat. Dort shoppten die A’s oder Barbie selbst. Ich fand den Kram überteuert und nicht cool. Doch irgendwann reichte ihm dieses Argument nicht mehr aus und die Indizien sprachen gegen mich, denn wie sonst hätten die Dinge in mein Zimmer gelangen sollen? Ich hatte nichts gegen die beiden in der Hand, das meine Unschuld und ihre Schuld bewies. Ich gab mir alle Mühe, einen Hinweis zu finden, doch sie hatten es schlau angestellt und keine Spuren hinterlassen. Weder in meinem noch ihren Zimmern und so ohne Weiteres konnte ich sie nicht beschuldigen. Mein Vater machte seiner Rolle als liebender Stiefvater alle Ehre, indem er sie in Schutz nahm und sie nachsichtiger behandelte als seine eigene Tochter. Der Höhepunkt dieser Aktionen lag erst mehrere Wochen zurück. Es ging um einen sauteuren Pullover aus einem dieser Luxusgeschäfte bei uns in der Stadt. Meine ach so lieben Stiefschwestern hatten ihn so unter meinem Bett positioniert, es war nur eine Frage der Zeit, bis unsere Haushälterin ihn finden musste. Und natürlich war der weiße Cashmere-Pullover mit einer schwarzen Diebstahlsicherung aus dem Laden versehen. Offensichtlicher ging es kaum. Auf dem Preisschild stand eine Zahl von weit über 2.000 Euro. Es gab einen riesigen Ärger. Ich konnte ihm nur sagen, dass ich keine Ahnung hatte, wie das Teil unter das Bett gekommen war. Das reichte ihm natürlich nicht und er glaubte mir auch nicht. Er strafte meine angebliche Unehrlichkeit mit Verachtung. Er schickte mich zu einem Therapeuten, der meine vermeintliche krankhafte Neigung zu Diebstahl behandeln sollte. Damit kam ich klar, doch viel schlimmer war, dass er mich für mindestens zwei Wochen ignorierte, wenn wir im selben Raum waren. Nichtbeachtung und das in einem Zuhause, in dem ich mich dank Barbie ohnehin schon unerwünscht fühlte, war die härtere Strafe. Eine Strafe für etwas, das ich nicht getan hatte. Meine Machtlosigkeit wurde mir in dieser Zeit besonders deutlich. Eigentlich gab ich nicht so schnell auf und ließ mir nichts gefallen. Bei den A’s hatte ich jedoch keine Chance. Mein Vater hatte einen starken Beschützerinstinkt ihnen gegenüber entwickelt, gegen den ich nicht ankam.
Doch jetzt ging es nicht mehr um Diebstahl, sondern um Drogen. Um Kokain. Stumm stand ich da und sah mit immer breiter werdendem Entsetzen zu, wie mein Vater in eine Schreibtischschublade griff und ein kleines durchsichtiges Tütchen herausholte. Darin befand sich ein weißes Pulver. Demonstrativ hielt er es in die Höhe. Mein Herz rutschte noch eine Etage tiefer.
»Marnie« – er nickte ihr zu – »hat dieses Tütchen in deinem Kleiderschrank gefunden, nachdem Agnes es entdeckt hat. Natürlich hat die Kleine sich nicht getraut, es auch nur anzurühren.«
»Agnes«, entfuhr es mir. Sofort presste ich die Lippen zusammen. Natürlich, Agnes, wer sonst?
»Ja«, erwiderte Barbie mit fester Stimme, den Blick erst auf mich und dann auf meinen Vater gerichtet. »Die arme Kleine wollte nur schauen, ob unsere Haushälterin mal wieder eure Strümpfe verwechselt hat, und entdeckte dann das.« Ein ausgestreckter Zeigefinger untermalte ihre perfekt inszenierte Lüge.
Ich brachte nicht mehr als ein Kopfschütteln zustande. Es war zwecklos. Egal was Barbie sagte oder tat, in den Augen meines Vaters hatte sie immer recht. Sie war die Perfekte. Die Frau, die er liebte, und noch schlimmer, er liebte auch ihre Brut. Sie, und damit meinte ich alle drei, konnten ihm inzwischen alles erzählen, er glaubte es, selbst wenn die Lüge so offensichtlich war, dass es fast wehtat. Er duldete keine Drogen in seinem Haus und damit war mein Urteil nach vier Jahren gesprochen. Barbies Herrschaft hatte ihren Höhepunkt erreicht. Sie hatte es geschafft. Ich würde das Feld räumen, gezwungenermaßen, und auf ein Internat gehen.
Barbie hatte sich ganz langsam in das Leben meines Vaters geschlichen und damit auch in meins. Meine Mutter war verstorben, als ich sieben Jahre alt war, und danach hatten viele Frauen versucht, ihren Platz einzunehmen. Mein Vater war ein sehr großzügiger und ebenso vermögender Mann, der sein Immobilienimperium als junger Mann aufgebaut hatte. Als Witwer war er sehr begehrt und ein gefundenes Fressen für alle Frauen, die auf der Suche nach Reichtum waren. Doch er trauerte und hatte viele Jahre keine andere Frau an seiner Seite gewollt. Weder für sich noch für mich. Da hatte er noch Rücksicht auf mich genommen. Viele Jahre war ich ihm das Wichtigste gewesen. Wir zwei, nur wir zwei und dann kam erst einmal lange nichts. Ich war seine Thilda, sein ein und alles. Er liebte mich abgöttisch. Bis Barbie mit ihren A’s in sein Leben getreten waren und ihn mir ganz langsam und unwiederbringlich für immer wegnahmen. Es war ein schleichender Prozess, von langer Hand geplant. Es hatte damit begonnen, dass er sich keine Zeit mehr für mich genommen hatte, sondern immer alles mit ihnen gemeinsam hatte machen wollen.
Erst war es nur das Mittagessen bei meinem Lieblingsitaliener gewesen, zu dem wir einmal die Woche verabredet gewesen waren. »Thilda, mein Schatz«, eröffnete er mir irgendwann, »wir können auch zu fünft zu deinem Lieblingsitaliener gehen. Marnie ist ganz vernarrt in das Thunfischtartar.« Ich hasste Barbie schon allein dafür. Sie konnte auch allein mit ihm ihr ›Thunfischtartar‹, schon bei dem Gedanken daran wurde mir übel, essen gehen und uns unsere Zweisamkeit lassen. Aber nein. Sie musste überall dabei sein. Und damit nahm sie mir die einzige feste Verabredung in der Woche mit meinem Vater.
Als Nächstes war das Wochenende an der Cote d’Azur dran gewesen. Traditionell fuhren wir einmal im Jahr dorthin, immer zum Geburtstag meiner Mutter und auch nach ihrem Tod behielten wir dies bei. »Thilda, mein Engel, ein Wochenende an der Cote d’Azur würde uns allen guttun, nicht nur uns zweien«, hatte mein Vater seine Entscheidung begründet.
Ich hatte versucht, ihm zu erklären, wie sehr ich unsere Zweisamkeit und ihn vermisste, doch er hatte nur gekontert: »Thilda, du musst akzeptieren, dass ich Marnie und ihre Mädchen liebe. Ich möchte, dass wir eine Familie sind, sie und wir. Für mich gibt es kein ›nur wir zwei‹ mehr, wir sind jetzt zu fünft. Ich erwarte von dir, dass du dir Mühe und ihnen eine Chance gibst.« Und als ob das noch nicht gereicht hätte, hatte er mich zu überzeugen versucht, dass Anastasia und ich so gut zusammenpassen würden: »Schätzchen, Anastasia und du seid doch fast gleich alt, werdet Freundinnen, du wirst sehen, das wird ganz toll.«
Nichts wurde toll. Barbie hatte sich längst an ihn geheftet wie eine Klette und das nicht nur an seine Fersen, sondern auch an seinen Geldbeutel. Sie ging sehr geschickt vor, das musste ich ihr lassen. Ganz langsam hatte sie sich in sein Leben geschlichen, bis sie es vollständig dominierte und mich hinausgedrängt hatte.
Einmal, das war noch vor der Hochzeit gewesen, aber die drei lebten schon bei uns, hatte ich ein Gespräch zwischen den beiden belauscht, als sich mein Vater nach mir erkundigt hatte. »Ich sehe Thilda gar nicht mehr. Sie begleitet uns nicht bei unseren gemeinsamen Essen und wenn wir übers Wochenende in eines der Ferienhäuser fliegen, will sie nicht mitkommen. Ich mache mir Sorgen.«
»Das musst du nicht, mein Liebling«, hatte Barbie gesäuselt. »Ich habe das im Griff. Lass uns Frauen das mal machen. Thilda ist zurzeit in einer schwierigen Phase. Sie muss sich an die neue Situation erst gewöhnen. Das ist schwer für sie. Gib ihr Zeit. Abstand ist da sicherlich am besten. Mehr als sie fragen, ob sie mitkommen möchte, kann ich auch nicht tun. Leider« – sie seufzte theatralisch – »sind die Gespräche mit ihr wahnsinnig schwierig. Sie lehnt alles ab, mich insbesondere. Ich bin langsam mit dem Latein am Ende.«
Und mein Vater? Er hatte volles Verständnis. Hatte Barbie bemitleidet und sie bewundert für ihre Geduld und Fürsorge, die sie mir entgegenbrachte.
Dabei brachte sie mir weder das eine noch das andere entgegen. Das sah er nicht oder wollte es nicht sehen. Ich wurde nie gefragt, ob ich irgendwohin mitwollte. Meist erfuhr ich von unseren Angestellten, dass die vier mal wieder unterwegs waren. Mehrfach hatte ich versucht, meinem Vater davon zu erzählen, aber jedes Mal war Barbie an seiner Seite. Alle Versuche, ihn allein zu erwischen und ihm die Wahrheit über diese Frau zu sagen, waren kläglich gescheitert.
Nur ein einziges Mal war es mir gelungen, ihn zu sprechen, und das auch nur am Telefon. Doch als ich ihm erzählen wollte, wie sehr mich Barbie ausschloss und mich gar nicht informierte, wenn ein Trip geplant war, schnitt er mir nach dem ersten Satz das Wort ab. »Wenn du es wagst, auch nur ein schlechtes Wort über deine zukünftige Stiefmutter und Stiefschwestern zu verlieren, dann werfe ich dich eigenhändig raus. Das Thema ist tabu. Ich liebe diese Frau und auch ihre Kinder. Sie sind ein Teil der Familie. Akzeptiere es oder uns steht eine sehr schwere Zeit bevor.« Seine Stimme hatte vor Zorn gebebt. »Ich habe fünf Jahre um deine Mutter getrauert, Thilda. Fünf lange einsame Jahre und jetzt habe ich die Frau meines Lebens gefunden. Mit ihr möchte ich den Rest meines Lebens verbringen.«
Und darin habe ich keinen Platz mehr, hätte ich am liebsten gesagt, traute mich aber nicht. »Ich kann zwar nicht verstehen, was dir daran nicht passt, aber ich bin glücklich mit ihr und dieses Glück lasse ich mir von dir nicht nehmen.«
Ich war innerlich zurückgezuckt. »Natürlich wünsche ich Dir Glück. Alles Glück der Welt«, hatte ich gestammelt.
»Dann ist ja alles gesagt«, hatte er erwidert und damit war das Gespräch beendet gewesen. Wir haben nie wieder über falsche Anschuldigungen, Lügen oder einfach nur über Barbie gesprochen. Nie wieder. Der eine Versuch hatte mir gereicht und ich hatte mich so ohnmächtig und machtlos gefühlt. Schon damals hätte ich erkennen müssen, dass ich keinen Platz mehr im Leben meines Vaters hatte. Er zog sie allem und vor allem jedem vor, einschließlich mir. Seit Barbie in sein Leben getreten war, hatte er sich verändert. In ihrer Gegenwart war er nachgiebig und sanft. Da war nichts mehr übrig von dem knallharten Geschäftsmann, der um seine Frau trauerte und sein Leben der Arbeit und seiner Tochter widmete. Ich gönnte ihm die Liebe und wenn ich ehrlich zu mir war, tat ihm Barbie in gewisser Weise gut. Er war ausgeglichener, achtete mehr auf sich und seine Gesundheit und er schien das Leben wieder genießen zu können. Sie konzentrierte sich voll und ganz auf ihn, fast aufopferungsvoll, und für mich war kein Platz übrig. Mein Vater zog seine neue Familie mir vor und das zeigte er mir so oft, indem er mich nicht fragte oder überredete, zu den gemeinsamen Ausflügen mitzukommen. So oft kam mir die Frage in den Sinn, ob es ihm egal war oder er sogar froh war, wenn ich nicht mitkam, denn dann gab es keinen Streit. In meiner Anwesenheit gab es den ständig. Zwischen den A’s und mir, Barbie und mir und auch ihm und mir. Und stets waren die Fronten klar: alle gegen mich. Nie ergriff er Partei für mich. Ganz im Gegenteil. Den A’s gegenüber verhielt er sich liebevoller und rücksichtsvoller als zu mir.
Barbie ließ mich spüren, wann immer mein Vater nicht in der Nähe war, wie sehr ich sie in ihrem Paradies störte. Zu ihrem Plan gehörte es, mich nach und nach aus seinem Fokus zu drängen. Als das geglückt war, fing sie gemeinsam mit den A’s an, mich schlecht zu machen, dann folgten die falschen Anschuldigungen. Gut, zugegebenermaßen war ich kein Engel und machte viel Party. Was blieb mir anderes übrig? Ich war die meisten Wochenenden allein zu Hause, mit unseren Angestellten versteht sich, also nicht ganz allein, aber immerhin so, dass ich machen konnte, was ich wollte. Und irgendwie musste ich mir ja die Zeit vertreiben. Also genehmigte ich mir den ein oder anderen Cocktail, warum auch nicht? Meine Freunde kamen liebend gerne zu uns nach Hause, wenn die anderen nicht da waren. Aber wir übertrieben es nie. Es gab keine Alkoholleichen und wir nahmen keine Drogen. Ich betone keine Drogen! Und natürlich stahl ich nicht. Doch Papa sah nur Barbies Augenaufschlag und glaubte ihr alles und mir nichts mehr.
Der letzte Coup, mir Koks unterzuschieben und mich damit aufs Internat abzuschieben, toppte alles, was sie in den Monaten zuvor ausgeheckt hatten. Ich war sprachlos, hilflos und machtlos.
»Internat«, hauchte ich erneut, weil ich es nicht fassen konnte.
»Es wird dir gefallen«, säuselte Barbie. Schon bei dem Tonfall musste ich einen Würgereiz unterdrücken. »Sie haben ein hervorragendes Programm an Zusatzfächern und du kannst dort nicht nur deinen Schulabschluss machen, sondern auch gleichzeitig eine Ausbildung beginnen.«
»Ausbildung?«, wiederholte ich ungläubig. »Erst mal mache ich mein IB …« Den Rest sparte ich mir, denn die Augenbrauen meines Vaters schossen in die Höhe.
»Es ist beschlossen«, polterte er. »Du packst deine Sachen am Wochenende, Sonntagnachmittag geht dein Flug.«
»Sonntag!« Ich schnappte nach Luft. Meine Gedanken rasten. Heute war Freitag.
»Wir sind über das Wochenende auf dem Land, also melde dich, wenn du dich eingelebt hast.«
Barbie legte behutsam eine Hand auf seinen Arm und schüttelte leicht den Kopf. Er nickte und murmelte. »Stimmt, das wird nicht gehen.« Er straffte die Schultern und sagte mit seiner festen Geschäftsstimme. »Es ist alles gebucht, die Schule hier weiß bereits Bescheid, im Internat wirst du erwartet. Du musst nur noch deine Sachen packen und am Sonntag in den Flieger steigen.«
Ich schluckte.
Barbie zog einen großen Umschlag aus dem braunen Kuvert. »Darin findest du eine Packliste, die vom Internat vorgeschrieben ist. Das meiste gibt es vor Ort, deshalb wirst du nicht viel brauchen. Auf dem Schulgelände ist Schulkleidung Pflicht, das erleichtert so viel.« Sie lächelte meinen Vater an. »Ich bin ganz aufgeregt, Liebling. Fast, als würde ich noch mal dort hingehen.«
»Das ist dein Internat?« Ich konnte die Worte nicht zurückhalten.
Barbie wandte sich mir zu. »Selbstverständlich, mein Schatz.« Ich hasste es, wenn sie mich so nannte. Natürlich tat sie das nur in Anwesenheit meines Vaters. »Was denkst du denn, wie wir so schnell einen Platz für dich bekommen haben? Mitten im Schuljahr. Das machen nicht viele Einrichtungen.«
›Einrichtungen‹, jetzt nannte sie es schon Einrichtung und nicht mehr Internat. Das konnte ja heiter werden.
Mein Vater hauchte ihr einen Kuss auf die Wange. »Das hast du ganz hervorragend gemacht, Liebling. Ich danke dir von Herzen.«
Fast hätte ich würgen müssen. Wegen dem Kuss und seiner Schmeichelei. Das tat sie doch nur für sich, nicht für ihn und am wenigsten für mich.
»Der Reiseplan befindet sich ebenfalls hier drin.« Sie wedelte mit dem Umschlag. »Ich habe dir einen Fahrer gebucht, der dich vom Flughafen abholen und zum Internat fahren wird. Damit du sicher dort ankommst.«
Damit du ganz sicher sein kannst, dass ich endlich aus dem Weg bin, dachte ich grimmig, statt es auszusprechen, nickte ich nur benommen. »Papa«, flüsterte ich, aber er schüttelte nur mit dem Kopf.
»Es ist alles gesagt. Am Sonntag geht dein Flug, wir sehen uns dann.« Er wandte sich fragend an Barbie. »Wann kommt sie das nächste Mal nach Hause?«
»In den Sommerferien.« Sollte das eine mitleidige Miene sein, die sie da zeigte?
Sommerferien? Es war Januar. Sollte das ein Witz sein? Keine Ferien in den nächsten sechs Monaten? Doch ich hatte keine Wahl, keine Macht, nichts, was ich dem noch hätte entgegensetzen können.
»Papa«, hob ich ein letztes Mal an. Ich nahm meinen gesamten Mut zusammen. Tränen drängten sich durch meine Kehle nach oben. »Ich habe dir versprochen, ich rühre keine Drogen an. Daran habe ich mich immer gehalten, das musst du mir glauben. Wir können …« Ich brach ab, als er mir mit einer Handbewegung jegliches weitere Wort verbot.
»Ich will nichts mehr von dir hören. Es ist beschlossen. Du gehst auf das Internat.«
Alles sackte in mir zusammen. Barbie hatte gewonnen. Mit hängendem Kopf und dem Umschlag in der Hand verließ ich das Zimmer. An der Tür drehte ich mich noch mal um. Sie hatten sich einander zugewandt. Mein Vater blickte seine neue Frau voller Zuneigung an, sie lächelte ihn an und dann umarmte er sie innig und zärtlich. Er schloss dabei sogar die Augen. Mir wurde schlecht. Wie hatte ich sie so unterschätzen können? Vielleicht wäre es klüger gewesen, wenn ich mich mehr angepasst hätte? Doch jetzt war es zu spät. Ich nahm all meinen Mut zusammen und fragte leise: »Sagst du mir noch auf Wiedersehen, bevor ihr fahrt?« Die Verzagtheit in meiner Stimme konnte ich nicht verbergen.
Er sah auf und mich kurz an. »Wann fahren wir, Liebling?« Er warf einen Blick auf seine Armbanduhr.
»Am frühen Nachmittag«, erwiderte sie mit ungewohnt harter Stimme. »Wir holen die Mädchen von der Schule ab. Sie haben heute schon um 14 Uhr aus.«
Ich stand da, den Umschlag an meine Brust gepresst und fühlte mich, als wäre ich wieder 7 Jahre alt und hatte gerade meine Mutter verloren. Nun hatte ich ihn auch verloren. Er sah mich nicht an, würdigte mich keines Blickes.
»Ich versuche es, Thilda«, sagte er nur. »Ich habe aber bis dahin noch jede Menge zu tun.«
In mir zerbrach etwas – scheppernd, in klitzekleine Einzelteile zerfallend, direkt in meiner Magengegend.
»Sonst noch was?«, kam Barbies Stimme von ganz weit her an mich heran geweht. Ich stand wie erstarrt in der Tür. Vage schüttelte ich den Kopf und wandte mich ab. Ich konnte den Anblick der beiden nicht mehr ertragen und zu sagen gab es auch nichts mehr.
Viola
Thi«, ertönte es aus meinem Handy. Die Hintergrundgeräusche waren laut, es ratterte und pfiff. »Thi, warum machst du nicht die Kamera an?« Meine Freundin Viola strich sich zum zigsten Mal durchs Haar und zeigte mir die Straße, auf der sie sich befand. »Covent Garden ist immer noch so cool«, schrie sie gegen den Lärm an. »Und gleich geht es natürlich zu Selfridges und auf die Bond Street.«
»Stimmt ja, du bist in London«, murmelte ich. »Wie hast du das mit der Schule gemacht? Hast du dich krankgemeldet oder schwänzt du?« Irgendwo in meinem tränenvernebelten Hirn kam die Erinnerung wieder, dass sie nach London geflogen war. Eigentlich war es unser Wochenende gewesen, unser Plan, gemeinsam nach London zu fliegen, aber meine beste Freundin hatte unbedingt schon am Freitag fliegen wollen und ich hatte mich nicht getraut, zu schwänzen. Ich hatte meinem Vater nicht noch mehr Stoff für Beschwerde und Unmut bescheren wollen. Wäre ich bloß geflogen. Was für einen Unterschied hätte das gemacht?
»Ach, Schule ist überbewertet«, meinte Vi lachend. »Das weißt du doch. Wish you were here, my Bestie.«
»Ich auch«, brummte ich weiter.
»Was ist los mit dir?« Viola sah zum ersten Mal richtig auf ihr Display. »Du hörst dich komisch an. Mach sofort die Kamera an.« Ihr Ton wurde herrisch und sie hob erwartungsvoll eine Augenbraue. Seufzend bediente ich das Handy und schaltete die Kamera ein. Ihr Gesicht kam näher. »Du siehst ja total verquollen aus. Hast du geweint?«
Ich zuckte nur mit den Schultern und sofort schossen mir die Tränen in die Augen.
Viola starrte mich entsetzt an. »Thi, Schatz, was ist passiert?« Bevor ich antworten konnte, wenn ich das überhaupt gekonnt hätte, denn die Schluchzer kamen jetzt wieder schneller, sagte sie: »Ich rufe dich gleich noch mal an. Gib mir fünf Minuten, fünf, okay? Okay, Thi?«
Ich nickte langsam und dann wurde der Bildschirm schwarz. Wie gebannt starrte ich auf mein Handy und wartete. Die Tränen liefen nun regelmäßiger, aber auch nur, weil ich weder sprechen noch mich zusammenreißen musste. Viola war meine beste Freundin. Wir kannten uns schon seit dem Kindergarten, unsere Mütter waren befreundet gewesen. Vis Mutter hatte immer versucht, mir eine Stütze zu sein. Doch da mein Vater unseren gemeinsamen Verlust wunderbar und liebevoll aufgefangen hatte, hatte ich mich ihr nicht geöffnet. Als dann Barbie ins Spiel gekommen war, war ich zu alt und es war zu spät gewesen, um eine enge Beziehung zu Violas Mutter aufzubauen. Dennoch hatte ich tatsächlich einmal versucht, mich ihr anzuvertrauen. Damals waren es nur Vermutungen über Barbies Absichten gewesen und Vis Mutter hatte sich verständnisvoll gezeigt.
»Thilda, Schätzchen, ich kann dich verstehen. Du bist misstrauisch und wahrscheinlich fühlst du dich bedroht. Du und dein Vater, ihr macht das so toll, habt ein enges Verhältnis und das ist einfach großartig. Eine neue Frau muss aber nicht heißen, dass sie sich zwischen euch stellt. Vielleicht wartest du erst einmal ab und freust dich für deinen Vater? Marnie wirkt nett und einfühlsam auf mich. Vielleicht versteht ihr euch ja und wachst zu einer neuen Familie zusammen? Das wäre doch schön, oder? Für dich und für deinen Vater.« Ich hatte ihr wirklich glauben wollen und hatte mich nach dem Gespräch bemüht, aufgeschlossener zu sein, aber mein Misstrauen hatte sie nicht ausräumen können.
Das Klingeln des Handys riss mich aus meinen Gedanken. Vi.
Schniefend nahm ich das Gespräch an.
»Hey«, flüsterte sie und blickte ernst in die Kamera. Sie schien in einem Café zu sitzen. Im Hintergrund waren nur leise Geräusche von klirrendem Geschirr zu hören.
»Hey«, erwiderte ich und versuchte zu lächeln.
»Was ist los? Was hat sie dir dieses Mal angehängt?«
Ich schluckte den nächsten Tränenschwall hinunter. »Sie schiebt mich auf ein Internat ab. In England.«
Meine Freundin starrte mich entsetzt an.
»Sag doch was, Vi, bitte.«
Sie schüttelte den Kopf und presste die Hand auf den Mund. Ich erzählte ihr von dem Gespräch, der Reaktion meines Vaters, einfach alles. Sie schwieg, nahm die Hand nicht von ihrem Mund und waren da Tränen in ihren Augen oder war das nur eine Reflexion? Nachdem ich schloss, blieb es einen Moment lang still.
»Vi?« Meine Stimme war nicht mehr als ein Wispern.
Sie nickte, nahm die Hand runter und fuhr sich mit dem Fingernagel des kleinen Fingers an den unteren Augenlidern entlang.
»Okay«, sagte sie langsam. »Wie bekommen wir das wieder hin? Wie können wir das verhindern? Du darfst nicht nach England auf irgendein beschissenes Internat gehen.«
Ich zuckte mit den Schultern. »Es ist beschlossen. Ich muss meinen Sachen packen. Am Sonntag geht der Flug. Barbie hat gewonnen.« Ich wedelte mit dem braunen Umschlag vor dem Handy herum.
»Hast du da schon einmal reingeschaut?«
Ich schüttelte den Kopf.
»Weißt du überhaupt, was das für ein Internat ist? Hast du dir mal die Homepage angeschaut?«
Wieder schüttelte ich den Kopf.
»Mensch, Thi, das wäre doch das erste gewesen, was ich gemacht hätte«, schimpfte sie, aber meinte es nicht ernst.
Ich lachte dumpf. »Genau, bevor oder nachdem du dir die Augen ausgeheult hast?«
»Ich komm dich besuchen, ganz oft«, versprach sie. »Warte mal.« Vi fummelte etwas an ihrem Handy herum. »Ich muss meinen Rückflug umbuchen.«
»Was? Nein, du bist doch gerade erst angekommen und bist so begeistert von London. Ich komme schon klar.«
»Was bringt mir Selfridges, wenn du in einem englischen Kloster verschwindest? Wann darfst du das nächste Mal nach Hause? Wie war das noch mal?« Immer noch blickte sie nicht in die Kamera, sondern tippte wie wild auf dem Handy rum.
»In den Sommerferien«, flüsterte ich und wieder stiegen die Tränen hoch. »Und wer weiß, ob ich da nach Hause kommen darf. Vielleicht verfrachten sie mich direkt auf eine Summer School oder so was.«
Vi sah mich kurz an. »Das hat sie letztes Jahr auch schon versucht. Damit kommt sie nicht durch, dafür werde ich sorgen. Sonst machst du wieder Ferien mit uns.«
Das entlockte mir ein Lachen.
»Mein Flug geht in drei Stunden, das müsste ich schaffen. Holst du mich ab?«
»Vom Flughafen?«
»Nee, vom Hafen, natürlich vom Flughafen, du Dummerchen.«
Wieder musste ich lachen. Vi war einfach die Beste. »Ich suche mir gleich einen Zug raus.«
Sie sah mich fragend an. »Wenn dein Dad und dieses Biest nicht da sind, kannst du sicherlich auch euren Fahrer nehmen. So als letzter Akt der« – sie setzte das Wort in Anführungszeichen mit den Fingern – »Rebellion.«
Ich grinste. »Ich schau mal, was ich da machen kann.«
»Perfekt, Babe, so machen wir das. Ich schicke dir gleich die Flugnummer und dann sehen wir uns später.«
Sobald Vi an meiner Seite war, fühlte ich mich sofort besser. Da sie alles für London dabeihatte, brauchte sie nicht nach Hause fahren, sondern verbrachte das gesamte Wochenende mit mir. Wir durchforsteten das Internet nach Fotos und Informationen über das Internat. Das war Vis Art, mit der Situation umzugehen. »Wir machen das Beste draus«, sagte sie und schmiss sich mit ihrem Handy auf mein Bett. »Und das können wir, wenn wir wissen, mit wem wir es zu tun haben.«
Das Problem war nur, dass wir keine Informationen über das Internat fanden. Es gab keine Homepage, keine Einträge auf Social Media, keine Hashtags mit dem Namen.
»Bearbind Lyceum«, murmelte ich unentwegt. »Klingt wie der angebundene Bär in einem höhere-Töchter-Internat.«
»Heißt es aber nicht«, neckte mich Vi und lachte.
»Ich weiß«, erwiderte ich seufzend.
»Und sie war wirklich auch dort?«, wiederholte sie nicht zum ersten Mal.
Ich nickte. »Das hat sie sogar vor meinem Vater zugegeben.«
»Sehr elitär scheint es aber nicht zu sein, wenn es noch nicht mal eine Website gibt.« Vi streckte sich. Seit Stunden saßen wir an den Handys.
»Marnie kommt nicht aus wohlhabenden Verhältnissen«, erinnerte ich sie. »Elitär können wir streichen.«
»Stimmt ja, also mein Ackerwindchen, dann bin ich gespannt, was dich dort erwartet.«
›Bearbind‹ war der englische Ausdruck für Ackerwinde, ein Unkraut.
»Bevor du mich nun so liebevoll nennst« – ich warf ihr einen übertrieben genervten Blick zu – »was hast du denn über die Ackerwinde rausgefunden?«
»Nicht viel, es ist ein Unkraut. Ziemlich widerstandsfähig, lebt mehrere Jahre und ist schwer zu bekämpfen.«
»Na toll, sie schickt mich auf ein Internat, das nach einem Unkraut benannt ist.«
»Vielleicht ist es die oberste Prämisse, das Unkraut zu vernichten«, meinte Vi düster.
»Sie hat es überlebt«, wandte ich ohne Ironie ein. Das mulmige Gefühl, das sich ständig in meinem Magen breitmachte, wenn wir darüber sprachen, wurde immer stärker.
»Dann wirst du es auch überleben. Es ist nur ein Name, Thi, und wahrscheinlich ein stinknormales Internat. Etwas altbacken, wenn es noch nicht mal eine Homepage hat, aber das passt ja dann zu Barbie.«
Ich sah sie stirnrunzelnd an.
»Na, altbacken. Barbie kommt auch langsam in die Jahre.« Vi klatschte sich wie selbstverständlich mit den Händen auf die Wangen und machte einen Schmollmund.
Ich musste lachen.
Während wir die Dinge zusammensuchten, die auf der Packliste standen, schmiedete Vi einen absurderen Plan nach dem anderen, wie ich wieder nach Hause kommen könnte. Wir malten uns immer wildere Geschichten aus, bis wir feststellten, wie wenig auf dem Bett lag.
»Das kann unmöglich alles sein«, murmelte ich.
»Da muss die zweite Seite fehlen.« Sie starrte auf den Berg von Unterwäsche. »Du kannst doch nicht in ganzen Tag in Schuluniform rumlaufen. Ab und zu hast du bestimmt Freizeit und dann …« Sie brach ab. Ihr Blick wanderte zum Kleiderschrank. »Nur das Allernötigste«, beschloss sie und fing an, wahllos alles Mögliche aufs Bett zu schmeißen. Für mich war es viel wichtiger, ein paar persönliche Dinge mitzunehmen: Ein Foto von meinen Eltern und mir, als ich noch klein war, meinen Lieblingspullover und einen Schal von meiner Mutter, mit dem ich im Bett immer noch kuschelte, als sei er ein Plüschteddy. Und da war noch etwas, an dem ich sehr hing, obwohl ich nichts damit anfangen konnte. Es war ein kleiner alter Gedichtband, nicht größer als ein Taschenbuch, in dickes Leder gebunden, mit merkwürdigen schillernden Zeichen auf dem Einband und in einer antiquierten Schrift verfasst. Ich erinnerte mich noch gut daran, wie meine Mutter es aufbewahrt hatte: stets in ein Leinentuch, wie eine Art Küchentuch, eingeschlagen und an einem besonderen Platz verwahrt, der für mich nicht erreichbar war. Auf Reisen nahm sie es immer mit. Einmal hatte sie mich dabei erwischt, wie ich darin blätterte, und hatte mir eine der wenigen Strafpredigten verpasst, an die ich mich überhaupt erinnern konnte. Ich musste ihr versprechen, dass ich das Buch niemals wieder anfassen würde, schon gar nicht ohne das Tuch. Nach ihrem Tod hatte ich das Buch mehrere Male inspiziert, aber nichts Besonderes daran feststellen können. Ein sehr altes Buch mit Gedichten, zumindest vermutete ich das an der Art, wie die Worte angeordnet waren, in einer mir nicht bekannten Sprache. Ohne weiter darüber nachzudenken, steckte ich den Band in meine Handtasche, wie ich es immer tat, wenn ich auf Reisen ging. Genau wie meine Mutter.
Als die Koffer gepackt waren, gingen wir aus, um mich abzulenken. Wir machten die Nacht zum Tag und genossen unsere letzten gemeinsamen Stunden vor meiner Abreise.
Der Sonntagnachmittag rückte immer näher und das mulmige Gefühl in der Magengegend wurde wieder stärker. Viola hatte es zwar geschafft, mir ein wenig die Angst zu nehmen, aber jetzt war die Nervosität zurück und größer als zuvor. Unser Abschied war tränenreich, mit vielen Versprechungen, uns so oft wie möglich anzurufen und noch viel öfter.
Wenige Stunden später stand ich am Ausgang des Terminals 4 von London Heathrow und hielt nach dem Fahrer Ausschau, von dem Barbie gesprochen hatte.
Die Ankunft
Es war bereits dunkel, als der Wagen von der Landstraße auf einen Schotterweg abbog. Eine hohe Hecke säumte die Straße, wenn man sie überhaupt so nennen konnte. Nach ein paar Minuten hielt das Taxi an und der Fahrer kurbelte das Fenster herunter. Wir standen vor einem hohen gusseisernen Tor. So eines, wie man sie aus den alten Filmen von Hitchcock kennt. Mehrere Meter hoch, sodass man den Kopf in den Nacken legen musste, um das geschwungene Ende zu sehen. Ich stellte mir vor, wie darin in Großbuchstaben ›Bearbind‹ eingelassen war. Von meinem Sitzplatz aus konnte ich es aber nicht erkennen.
Der Fahrer lehnte sich weit aus dem Fenster und presste einen Knopf an einer Säule, die aus dem Boden ragte. Kurz darauf ertönte ein Knattern, dann eine Stimme, die kaum verständlich war. Er brummte etwas Unverständliches zu sich selbst, schüttelte den Kopf und sagte dann mit einem unüberhörbaren britischen Akzent in Richtung der Freisprechanlage: »Fräulein Thilda Sommer.«
Stille, erneut war ein Knarren zu hören, gefolgt von einem kurzen Befehl. Dieses Mal erkannte ich deutlich eine Frauenstimme.
Der Fahrer wandte sich kopfschüttelnd zu mir um und hob die Schultern. »Endstation, Liebes. Hier muss ich dich rauslassen.«
Ich sah ihn erstaunt an. »Und mein Gepäck?«
Bedauern machte sich auf seinem Gesicht breit. »Sie hat gesagt, ich soll dich hier rauslassen. Es wird dich bestimmt gleich jemand abholen.« Als ich nicht reagierte, deutete er auf das Tor. »Schau, das Tor geht nicht auf.«
»Können wir dann nicht warten, bis jemand öffnet, und Sie fahren mich dann rein?«
Bevor er antworten konnte, rauschte erneut die Stimme über den kleinen Lautsprecher.
»Ihre Fahrt endet hier. Lassen Sie sie raus und fahren Sie.«
Der Fahrer warf mir einen bestätigenden Blick zu. »Bist du sicher, dass du hierher willst?« Er blickte mich voller Mitleid in den Augen an.
»Kennen Sie diesen Ort?« Sofort bereute ich es, ihn nicht schon während der Fahrt danach gefragt zu haben.
»Jetzt, bitte«, befahl die Stimme aus dem Lautsprecher.
Er nickte und schüttelte gleichzeitig den Kopf. »Ja, selbstverständlich, Madame.« Er wandte sich an mich. »Bitte, Fräulein, Sie müssen jetzt aussteigen.«
Ich seufzte ergeben und stieg aus. Hastig hob er die beiden Koffer aus dem Kofferraum und stellte sie neben dem Tor ab. Ein Dankeschön murmelnd streckte ich ihm einen 20-Pfund-Schein entgegen. Er sah verwundert darauf und schüttelte den Kopf. »Das ist nicht nötig. Für meine Bezahlung wurde gesorgt.«
»Das weiß ich, aber das ist für Ihre Unannehmlichkeiten, bitte«, erneut hielt ich ihm den Schein entgegen. Wir hatten uns die ganze Fahrt über seine Familie unterhalten. Er war verheiratet und hatte drei kleine Kinder. »Für ihre Kleinen?«, ergänzte ich unsicher.
Er sah mir in die Augen, erstaunt und dankbar zu gleich. Dann ergriff er das Geld. »Passen Sie auf sich auf, das ist kein guter Ort für freundliche Menschen. Ich danke Ihnen und Gott segne und beschütze Sie«, raunte er mir zu, bevor er wieder in den Wagen stieg. Er schien regelrecht verschreckt. Im Scheinwerferlicht des Autos – es musste rückwärtsfahren, da es keine Wendemöglichkeit gab – stand ich vor dem verschlossenen Tor und wartete. Nichts regte sich dahinter. Ein eisiger Wind wehte. War ich wirklich in England oder doch eher in der Antarktis gelandet? Zudem war es stockdunkel, weshalb ich froh war, dass das Taxi nicht die Anweisungen der Knarz-Stimme befolgt hatte, sondern mit eingeschaltetem Licht am Ende des Weges wartete. Ich winkte ihm zu und zwang mir ein Lächeln auf die Lippen. Prompt flammten die Scheinwerfer als Antwort auf. Ich war so dankbar für diese Geste.
Es kam mir wie eine Ewigkeit vor, bis sich schließlich zwei Gestalten dem Tor näherten. Sie waren in Umhänge mit Kapuzen gehüllt, die eine zog einen Bollerwagen hinter sich her, die andere trug eine altmodische Laterne an einem Henkel.
»Thilda Sommer?« Es war eine junge Stimme, eine Mitschülerin?
Ich nickte und schöpfte Hoffnung. Wie nett. Ein Empfangskomitee. Sicherlich würden sie mir gleich alles zeigen. »Das bin ich«, antwortete ich, wobei meine Stimme unsicherer klang, als ich das beabsichtigt hatte.
»Mein Gott, wofür denkt sie, braucht sie dieses viele Gepäck«, zischte die Zweite und zog einen riesigen Schlüsselbund unter dem Umhang hervor.
»Schau nur, gleich zwei Koffer. Die kann sie aber selbst ziehen«, erwiderte die Erste und nahm den Schlüsselbund an sich. Sie fing an, daran rumzufummeln, hielt jeden Schlüssel in das Licht der Laterne.
»Immer dasselbe, die, die sich für was Besseres halten, kommen immer besonders spät«, murmelte sie vor sich hin.
Mir rutschte das Herz in die Magengegend. Es war kalt, meine Füße inzwischen durchgefroren und auch wenn ich mir keinen herzlichen Empfang vorgestellt hatte, entmutigte mich diese Szene. Dennoch wollte ich noch einen Versuch starten, den ersten Eindruck, der offenbar nicht so geglückt war, wieder wettzumachen. Ich trat näher und zog mein Handy aus der Hosentasche. »Ich kann Euch auch leuchten«, bot ich mit fester Stimme an, das Zittern unterdrückend. Genervt presste ich die Lippen aufeinander.
Sie beachteten mich nicht und fummelten nun gemeinsam, die eine mit beiden Händen, die andere nur mit einer, da sie die Laterne hielt, an dem Schlüsselbund herum.
»Immer ist es der Letzte, der passt«, sagte schließlich die eine triumphierend und hob einen Schlüssel in die Luft. Es war ein riesiger altmodischer Schlüssel mit einem Loch in der Mitte und nur ein paar Zacken.
Ein kleiner Seitenflügel des Tores schwang quietschend auf. Keine machte Anstalten, mir zu helfen. Sie standen nur auf ihrer Seite des Tores und blickten mich aus ihren Kapuzen stumm an. Als ich nicht sofort reagierte, blaffte mich die Erste an. »Auf geht’s, wir haben nicht ewig Zeit. Aufladen und dann geht es hoch zum Schloss.«
Schloss? Das Bearbind Lyceum war ein Schloss? Das hatten Vi und ich nirgends gelesen. Ich nickte eifrig, worüber ich mich sofort wieder ärgerte. Warum sollte ich freundlich sein, wenn ich nicht so behandelt wurde? Stumm hob ich beide Koffer über die Schwelle des Tores, die sich wie eine Stolperfalle auf dem Boden befand, und wuchtete sie in den Bollerwagen.
»Noch mal«, murmelte die Zweite gepresst, als müsste sie irgendetwas unterdrücken. »Was hast du dabei? Du wirst nichts davon hier gebrauchen können.«
Dieses Mal sprach sie mich mehr oder weniger direkt an. Wow, ein Fortschritt. An der Freundlichkeit musste sie aber definitiv noch arbeiten.
»Ich habe mich an die Packliste …«, hob ich an, doch bevor ich den Satz beenden konnte, wandten sich die beiden ab und liefen mit der Laterne voran. Wütend über so viel Unfreundlichkeit ergriff ich den Griff des Bollerwagens und beeilte mich, hinterherzukommen. Das Ding war extrem schwerfällig, ich hatte Mühe, überhaupt voranzukommen. Grobe Kieselsteine bedeckten den Weg, was das Ziehen zusätzlich erschwerte. Die Idee, meine Koffer einzeln ohne Bollerwagen zu ziehen, verwarf ich gleich wieder. Ich würde stecken bleiben. Ich konnte meine Umgebung kaum wahrnehmen, da es stockdunkel war. Nur, dass die Hecken offenbar verschwanden, denn irgendwann erkannte ich rechts und links neben dem Weg Rasen. Meine Abholerinnen eilten vorneweg, die Laterne wackelte in der ausgestreckten Hand, und ich hatte große Mühe, Schritt zu halten. Nur einmal blieben sie stehen und die eine rief mir ein »Beeilung, wir haben nicht die ganze Nacht Zeit« zu.
Nach endlosen Minuten, sie kamen mir wie Stunden vor, lag vor uns eine Treppe und der Weg gabelte sich. Die Laterne, gefolgt von den beiden Umhängen, schwenkte nach links. Was, wenn ich einfach nach rechts abbiege?, fragte ich mich in einem Anflug des Wahnsinns. Inzwischen rann mir der Schweiß den Rücken hinunter. Wenigstens spürte ich meine Zehen wieder. Natürlich war ich zu einem rebellischen Akt nicht in der Lage, dazu fehlte mir der Mut. Der Weg führte über einen kleinen Hügel und ganz langsam kam ein Gebäude in mein Sichtfeld. Es erinnerte mich an eine Burgmauer, nur mit Dach und vergitterten Fenstern, durch die Lichtschein drang. Dahinter wuchs, majestätisch und trotz der Dunkelheit nicht zu übersehen, ein riesiges Schloss mit vielen verschieden hohen Türmen in die Höhe. Es war schwach beleuchtet, doch in fast jeder Etage brannten ein oder zwei Lichtquellen, wodurch der Bau in seiner ganzen Pracht zu erkennen war. Der Anblick allein hatte etwas Gruseliges, so still und düster lag das Anwesen da. Als Höhepunkt für dieses Bild schob sich der Mond hinter einem der Türme vorbei, der in den klaren Himmel ragte.
»Nicht stehen bleiben«, ertönte eine mir inzwischen bekannte Stimme. »Madame Matron möchte auch bald ihre Nachtruhe antreten.«
Madame Matron? Was war denn das für ein Name? Klang wie Matrone oder Matterhorn. Und was war das für eine Wortwahl: ›Ihre Nachtruhe antreten‹? Mein Englisch war eigentlich gut. Von klein auf hatte ich Einzelunterricht gehabt und stets einen Angestellten im Haus, mit dem ich nur Englisch gesprochen hatte. Diese Ausdrucksweise erinnerte mich an das antiquierte Englisch aus Büchern wie von Jane Austen, das man heute nicht mehr sprach. Was sollte das schon wieder? Wir waren doch unter uns, da musste sie sich nicht so geschwollen ausdrücken. Mir lagen tausend Kommentare und Fragen gleichzeitig auf der Zunge, stattdessen nickte ich nur und zog weiter kräftig an dem Gefährt hinter mir.
Wir erreichten eine Art Torbogen, der durch das mauerartige Gebäude hindurchführte. Der anfängliche Eindruck täuschte, da es kein Torbogen, sondern ein Durchgang war, der einem Tunnel glich. Es war stockfinster, keinerlei Beleuchtung an den Wänden, sodass ich mich noch mehr beeilen musste, die einzige Lichtquelle, die vor mir herschwankende Laterne, nicht komplett zu verlieren. Als es wieder etwas heller wurde, betraten wir einen Innenhof. Von hier aus hatte ich eine uneingeschränkte Sicht auf das Schloss. Es lag majestätisch vor mir, ein gewaltiger Bau mit Türmen an den Ecken und wohl auch im hinteren Teil, den ich von meinem Standort aus nicht sehen konnte. Für einen Moment hielt ich inne und betrachtete das Gebäude, das mich mit seiner Dunkelheit und Größe einschüchterte. Von weiter weg erkannte ich eine Ähnlichkeit zu Hogwarts, doch das war nicht der Fall. Es war kompakter gebaut, hatte mehr Türme und sah nicht sehr einladend aus. An den Ecken hingen Wasserspeier in Tiergestalt und auf den Vorsprüngen der Dächer, auf denen keine Türme saßen, hockten ebenfalls steinerne Figuren, meist mit monsterhaften Fratzen.
»Steh nicht rum«, motzte mich eins der Mädchen an. Ich zuckte zusammen und zog wieder an dem Karren, der sich über den feinen Kies noch schwerer ziehen ließ.
Wir bewegten uns direkt auf eine riesige Pforte zu, die mit einem abgerundeten Vorbau aus dem Schloss herausragte. Darin waren mehrere Türen eingelassen.
»Wir bringen dich jetzt zu ihr, dein Gepäck kannst du hier stehen lassen.« Die Stimme der Laternenträgerin hallte über den Hof und wurde nur von den Geräuschen unserer Schritte erstickt. Kurz zögerte ich und sah mich um. Mitten auf dem Hof vor dem Eingang sollte ich alles stehen lassen? Einfach so? In meinen Koffern waren für mich wichtige Dinge. Die wertvollsten, vor allem die Erinnerungsstücke an meine Mutter, hatte ich jedoch in meiner Tasche über der Schulter, dennoch fühlte ich mich bei dem Gedanken nicht wohl. Die beiden hatten die Pforte schon erreicht und sahen sich ungeduldig nach mir um. Ich hatte keine andere Wahl, als den Bollerwagen dort stehen zu lassen, wo er war. Ich beeilte mich, dieses Mal Schritt halten zu können. Wir betraten das Schloss durch eine riesige hölzerne reich verzierte Tür mit einem schweren Griff, der quietschte, als die Erste ihn hinunterdrückte. Beim Hindurchlaufen stellte ich fest, dass wir durch eine Tür in der Tür gingen. Eine kleinere Tür, die fast wie eine normale Eingangstür aussah, war in die riesenhafte hineingeschnitten, nur die hohe Türschwelle wies auf das doppelflügelige Portal hin. Wir kamen in einen weiteren, aber überdachten Innenhof, der mit grobem Kopfsteinpflaster belegt war. Er war in einem Fünfeck angelegt, zwei Ecken bildeten die Türen der Pforte, es gab noch eine weitere, die wieder in den Hof führte, die weiteren Ecken bildeten Treppen, die wiederum in Türen endeten. Der Hof war spärlich beleuchtet und es schien genauso kalt wie draußen zu sein. Offenbar spendete das Portal zum Schloss nicht genug Schutz. Hinter den drei Türen vermutete ich mehr Wärme und vielleicht sogar eine einladende Atmosphäre. Vielleicht wollte ich das letzte bisschen Optimismus nicht aufgeben.
Meine Begleiterinnen, wenn ich sie überhaupt so nennen konnte, liefen zielstrebig auf die Tür in der Mitte zu. »Hier geht es zu dem Büro von Madame Matron. Du kannst es nicht verfehlen«, erklärte die eine und wies auf die hölzerne Tür, die mir dank der kunstvollen goldenen Verzierungen aufgefallen war. Die restlichen Türen waren ebenfalls aus Holz, aber eher schlicht gehalten und ganz ohne Ornamente. Über jeder von ihnen thronten steinerne Köpfe, die mich sofort in ihren Bann gezogen hatten. Ausdruckslose oder zu Stein gewordene Grimassen blickten mir mit leerem Blick entgegen. Ich riss mich von dem Anblick los und ergriff die Gelegenheit, als die beiden sich zu mir umdrehten und stehen blieben.
»Wer ist Madame Matron?«, platzte es aus mir heraus.
»Willst du uns etwa sagen, dass du keine Ahnung hast, wer Madame Matron ist?« Empörung und Verachtung schwangen in dem Ton der Laternenträgerin mit, die dies fragte.
Ich nickte stumm und ärgerte mich gleichzeitig über mein Verhalten. Was musste ich mich einschüchtern lassen? Synchron schüttelten beide missbilligend den Kopf.
»Das wirst du schon merken, wenn du bei ihr bist, keine Sorge«, erwiderte die andere und lachte dabei so gehässig, dass sich meine Nackenhaare aufstellten. Was waren sie? Klone von Anastasia und Agnes? Sie hatten immer noch die Kapuzen ihrer Umhänge auf, ihre Gesichter waren kaum zu erkennen.
Eine von ihnen deutete auf die Tür. »Beeilung. Du hast sie schon viel zu lange warten lassen. Nach deinem Gespräch wird dich jemand beim Bollerwagen abholen und zum Schlafsaal bringen.«
Schlafsaal? Hatte ich mich verhört? Automatisch nickte ich und konnte mich noch gerade daran hindern, mich zu bedanken, wie ich es aus Gewohnheit tat. In dieser Situation wäre es so unpassend gewesen, zum Glück verzichtete ich geistesgegenwärtig darauf. Ich lief die Stufen zu der Tür hinauf, auf die sie gedeutet hatten. Als ich die schwere gusseiserne geschwungene Klinke hinunterdrückte und mich erneut umsah, waren die beiden bereits verschwunden.
Die Madame Matron
Also dann zur Madame«, murmelte ich zu mir, atmete tief durch und betrat das Innere des Schlosses. Ich war wütend über den unfreundlichen Empfang, müde von der Reise und dem Ziehen meiner Koffer und hungrig. Außerdem fühlte ich mich elend. Mir gefiel dieser Ort nicht, er bereitete mir ein ungutes Gefühl in der Magengegend und eigentlich wollte ich nur eins: Nach Hause. Trotz Barbie. Das hatte schon was zu heißen.
Langsam und unsicher atmete ich durch und sah mich um. ›Du kannst es nicht verfehlen‹, hallten die Worte der überheblichen Tussi in meinem Kopf nach. Ich sah mich um.