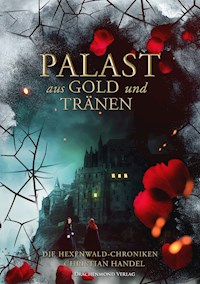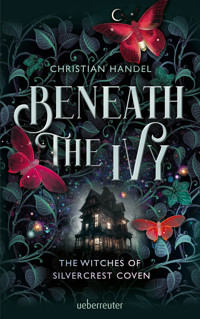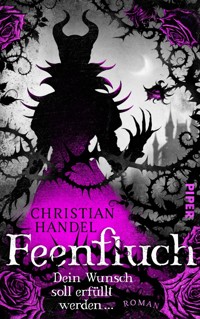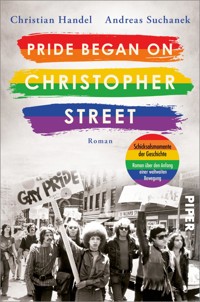Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ueberreuter Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Elektra
- Sprache: Deutsch
Wenn dein Leben eine Lüge ist ... Als die junge und schöne Elektra Hamilton bei einem Reitunfall ums Leben kommt, erhält Isabel ein unerwartetes Angebot. Sie, die Elektra wie aus dem Gesicht geschnitten ist, soll deren Platz einnehmen. Sie muss lediglich für immer verschweigen, wer sie wirklich ist. Ein Leben in Luxus winkt ihr - und die Verlobung mit dem attraktiven Phillip von Halmen. Zunächst scheint keiner Verdacht zu schöpfen. Doch Elektra hatte eigene Geheimnisse und während diese sie langsam einholen, wächst in Isabel die Gewissheit, dass Elektras Tod kein Unfall war. Wer trachtete Elektra nach dem Leben? Und wird der Mörder erneut zuschlagen? Isabel weiß nur, dass sie keinem trauen kann ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 511
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Sammlungen
Ähnliche
Über das Buch
Schön.
Reich.
Geliebt.
Verwöhnt.
Elektra Hamiltons Leben ist einfach perfekt.
Isabels ist das glatte Gegenteil davon, dabei sieht sie Elektra zum Verwechseln ähnlich. Als sie Elektras Identität annehmen soll, glaubt sie sich der Erfüllung ihrer Wünsche zum Greifen nahe. Doch alles hat seinen Preis und Isabel ahnt bei Weitem nicht, worauf sie sich da eingelassen hat …
Ein mitreißender All-Age-Thriller über eine Zukunft, in der das menschliche Klonen begonnen hat.
Inhalt
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Epilog 1
Epilog 2
Nachwort
Prolog
Samstag, 29. Mai 2083
Als Phillip mich auf der Tanzfläche herumwirbelt, komme ich mir einen Augenblick lang so vor wie in einem Märchen: Prinz und Prinzessin schließen sich nach einer Zeit harter Bewährungen endlich in die Arme. Mein Bräutigam schaut mir tief in die Augen und mein Kleid aus hellgrüner und cremefarbener Seide wogt um mich herum wie Meerschaum. Auf dem blank polierten Marmorboden tanzt unser Spiegelbild mit uns. Rund um uns herum, an die Wände des Saals, drängt sich eine beeindruckende Menschenmenge. Teils erdolchen uns unsere Gäste eifersüchtig mit Blicken, teils jubeln sie uns zu. Dieser Moment sollte sich anfühlen, als ob ein Traum in Erfüllung geht. Ich bin die Braut eines Prinzen, mit diesem Tanz feiern wir unsere Verlobung. Aber statt zu schweben, stolpere ich über meine eigenen Füße und gerate aus dem Takt. Mein Körper bebt vor Angst. Es gibt jemanden, der mich tot sehen will. Vielleicht ist es sogar mein Bräutigam selbst. Wer auch immer es ist, er setzt alles daran, dass ich diese Nacht nicht überlebe.
Denn das ist die Wirklichkeit: Ich bin nicht Cinderella. Und dies ist kein Märchen.
(Drei Wochen zuvor)
Kapitel 1
Samstag, 8. Mai 2083
Die klassischen Schulen mögen schon vor Jahren abgeschafft worden und individuellen Lerngruppen gewichen sein. Uns aber zwingt man weiterhin Tag für Tag in viel zu kleine Klassenräume. Man stopft unsere Köpfe mit Wissen voll, das wir vermutlich niemals brauchen werden. Mr. Langton wird nicht müde, uns einzureden, dass keiner weiß, was die Zukunft bringt, und eine gute Ausbildung niemals schadet. Ich glaube eher, dass man uns mit diesen Unterrichtseinheiten beschäftigt halten will. Warum sonst quält man uns mit dem biologischen Aufbau längst ausgestorbener Pflanzen? Warum sonst beschränken sie unseren Zugang zum Internet?
Wir sollen nicht auf dumme Gedanken kommen.
Aus Büchern weiß ich, dass früher Fächer wie Mathematik, Physik oder Chemie unterrichtet wurden. Was diese Gebiete angeht, ist unsere Ausbildung auffällig rudimentär. Unser Stundenplan fokussiert sich auf Hallensport, Freiluftsport, Literatur, Kunst, Geschichte, Biologie und ein paar Sprachen.
Wie die meisten anderen »Schüler« hier habe ich das Gelände des Instituts nie verlassen. Wenn ich Glück habe, muss ich das auch nie. Jedenfalls nicht bis zu meinem zwanzigsten Geburtstag, dem Zeitpunkt, an dem mich meine Eigentümer aus meiner Pflicht entlassen, weil dann die nächste Generation alt genug ist, unsere Plätze einzunehmen. Jedem, der früher gegangen ist, erging es schlecht.
Ich sehe nach rechts zu meiner Schwester Kelsey, die ihre Schulunterlagen schon fast komplett in ihren grauen Stoffbeutel gestopft hat. Ein Blick auf sie genügt, um zu wissen, dass ich recht habe.
»Was ist?«, fragt sie, als sie bemerkt, dass ich sie mustere. Eine Haarsträhne ist ihr in die Stirn gefallen.
Kelsey und ich glichen uns einst wie ein Ei dem anderen. Jetzt ist der Glanz aus ihren schwarzen Locken verschwunden, ihre Augen strahlen nicht mehr und sie wiegt sicher zehn Pfund weniger als ich.
»Nichts«, lüge ich, greife nach vorn und streiche ihr die Haarsträhne hinters Ohr. »Hast du Hunger?«
Sie schüttelt den Kopf. Kelsey hat nie Hunger. Nicht mehr seit damals.
»Lass uns in die Cafeteria gehen«, sage ich trotzdem. »Zu Aubrey und den anderen.«
Das bringt sie zum Lächeln und mir geht das Herz auf. Kelsey ist wunderschön, wenn sie lächelt.
Ich weiß, dass es seltsam klingt, wenn ich das sage. Es sollte bedeuten, dass ich auch mich wunderschön finde. Nichts ist weiter von der Wahrheit entfernt. Wenn ich in den Spiegel blicke, sehe ich nicht mich. Ich sehe auch nicht Kelsey. Ich sehe nur sie. Und ich hasse es.
Da ich keine Lust habe, mir den Appetit zu verderben, verdränge ich den Gedanken und packe meine Sachen ebenfalls zusammen.
Unsere Freunde warten sicher schon. Obwohl wir alle siebzehn Standardjahre alt sind, gehen wir nicht in die gleiche Klasse. Ich nehme an, ich darf bereits froh darüber sein, dass man Kelsey und mich nicht getrennt hat. Das ist nicht selbstverständlich.
Mr. Langton lächelt uns zu, als wir an ihm vorbeigehen. Während wir unsere Elastoscreens auf seinem Schreibtisch ablegen, frage ich mich, ob ich mich in ihm täusche. Vielleicht glaubt er ja tatsächlich an das, was er uns erzählt. Vielleicht will er wirklich unser Bestes und wünscht sich, dass uns mehr im Leben erwartet als der eintönige Alltag hier.
Nein, denke ich dann, als ich zurückblicke und sehe, wie er das Körbchen mit den Elastoscreens achtlos in den Wandschrank einschließt. Unsere Eingaben werden im Netzwerk ausgewertet, das weiß ich. Trotzdem wäre es schön gewesen, wenn sich Mr. Langton dafür interessiert hätte, wie wir uns geschlagen haben. Er hat jedoch nicht mal einen Blick auf unsere Arbeiten geworfen. Es ist ihm egal, wie wir in unseren Prüfungen abschneiden.
Wir sind ihm egal. Genauso wie dem Rest der Welt.
Ich lebe in einem Haus voller Spiegelbilder, zum Bersten gefüllt mit verzerrten Doppelungen einer Wirklichkeit, die nicht die meine ist. Kelsey, meine Freunde und ich – wir sind Menschen zweiter Klasse, nichts als perfekte Kopien von Leuten, die richtige Leben leben. Wir sind Klone. Während unsere Originale sich in einer Glitzerwelt aus roten Teppichen und mondänen Villen vergnügen, versteckt man uns hinter Mauern aus grauem Beton.
Vor vierundzwanzig Jahren hat die Regierung die Gesetze so verbogen, dass es jedem volljährigen Menschen erlaubt ist, Klone von sich und den leiblichen Kindern anfertigen zu lassen. Theoretisch jedenfalls. Kelsey und ich, wir gehören zu den ersten Züchtungen, die auf diese Weise entstanden sind. Zu den ersten Züchtungen, die zufriedenstellend produziert wurden, sollte ich wohl sagen.
Inzwischen leben fast hundert von uns im Institut. Und dieses ist nur eines von mehreren.
Natürlich sind wir trotzdem noch ein Luxusartikel. Nicht jeder verfügt über das notwendige Kleingeld, einen Klon herstellen zu lassen – oder zwei, oder drei. Wir sind Ersatzteillager für Organe, Extremitäten, Knochenmark und Hornhaut. Kein nervenaufreibendes Warten mehr darauf, dass die Organbank den passenden Spender findet. Ein Anruf genügt, und eine neue Niere wird auf dem Silbertablett geliefert – bzw. auf der metallenen Krankenhausliege, auf die man uns schnallt. Wir sind der Backup-Plan, wenn etwas schiefgeht; ein Allheilmittel, das dann zum Einsatz kommt, wenn die klassische Medizin versagt. Oder wenn ein viel zu junger, viel zu betrunkener Jugendlicher bei einem selbst verschuldeten Unfall sein Bein verliert.
Man kann uns ohne schlechtes Gewissen ausschlachten, denn wir wurden ja nur gezüchtet, nicht geboren. Wir sind keine freien Menschen, sondern Besitz. Man hat viel Geld in uns investiert – von dem wir selbst recht wenig sehen –, und deshalb glauben unsere Eigentümer, ein Recht darauf zu haben, uns zu benutzen, auszuweiden und wegzuwerfen, wenn nichts mehr übrig ist, was noch gebraucht werden kann. Ihr Geld mag uns das Leben geschenkt haben, aber ich hoffe, sie fahren allesamt zur Hölle.
Die Cafeteria lässt mich immer an Gänseblümchen denken. Ihre lindgrün gestrichenen Wände harmonieren mit dem Weiß der Tischplatten und dem Sonnengelb der Stühle. So soll vermutlich eine angenehme Atmosphäre entstehen.
Tut es auch, wenn ich ehrlich bin. Aber das liegt nicht am Farbkonzept, sondern daran, dass die Cafeteria dem am nächsten kommt, was wir aus Büchern und Filmen als »Restaurants« und »Cafés« kennen: ein Ort, an dem Menschen zusammenkommen, um miteinander zu plaudern, während sie essen.
Bis auf zwei Lehrerinnen und einen Lehrer, die den Bereich beaufsichtigen, in dem die Kleinen essen, überlässt man uns hier uns selbst. Die Cafeteria ist riesig. Vermutlich ist sie der größte Raum im Institut, sieht man mal von den Sporthallen ab. Alle essen hier.
Wir sind zur Mittagszeit später an der Reihe als die unteren Klassen. Uns überwacht auch kein Personal – jedenfalls nicht unmittelbar. Die Institutsleitung verlässt sich auf die Kameras, die in regelmäßigen Abständen installiert sind und jeden unserer Bissen filmen. Ich habe gelernt, sie auszublenden. Das Material wird, soweit ich weiß, ohnehin nur stichprobenartig gesichtet – und natürlich dann, wenn etwas passiert ist. Zum Beispiel, wenn die Lehrerschaft wissen will, wer für die Schlägerei verantwortlich war, an der sich im letzten Jahr mindestens zehn Schüler beteiligten. Aber so etwas kommt so gut wie nie vor. Wir sitzen alle im selben Boot, und das wissen wir.
Aubrey, Alex und Vanessa warten bereits an unserem Tisch. Manuel und Tobias sehe ich an den Essensautomaten.
Als wir die breiten Stufen hinuntergehen, die vom Eingang in den Sitzbereich führen, entdeckt uns Vanessa. Sie winkt uns so aufgeregt zu, als ob wir uns wochenlang nicht gesehen hätten. Dabei haben wir heute Morgen gemeinsam gefrühstückt und im Institut ist es ohnehin fast unmöglich, sich aus dem Weg zu gehen. Deshalb weiß ich, dass etwas im Busch ist. Alex legt ihr kurz die Hand auf die Schulter. Sie deutet nicht nach oben zu den Kameras, trotzdem beruhigt sich Vanessa sofort. Auch wenn sie zu den Menschen gehört, denen ihr Innenleben auf dem Gesicht geschrieben steht, ist sie nicht dumm. Ihre schräg stehenden Augen blitzen vor Intelligenz.
»Hallo, ihr zwei«, begrüßt uns Aubrey, als wir am Tisch ankommen. Kelsey beginnt zu grinsen und ich entspanne mich. Ein Blinder sieht auf eine Meile Entfernung, dass Kelsey auf Aubrey steht. Der Einzige, der das noch nicht bemerkt hat, ist Aubrey selbst. Ich wollte ihn schon öfter darauf ansprechen, habe aber Angst vor seiner Reaktion. Die Schwärmerei für Aubrey tut Kelsey gut. Manchmal scheint sie das Einzige zu sein, was sie noch aufrecht hält. Also werde ich den Teufel tun, das kaputt zu machen.
»Was gibt es?«, frage ich stattdessen.
Vanessa lehnt sich über den Tisch und flüstert begeistert: »Tobias hat ein Magazin mitgebracht.«
Unwillkürlich blicke ich auf den blauen Stoffbeutel, der auf dem Stuhl liegt, auf dem Tobias immer sitzt.
»Wie hat er das denn schon wieder geschafft?«
Alex wirft ihre blonde Haarmähne nach hinten. »Du kennst ihn doch.«
»Hat einen der Wächter bestochen«, murmelt Aubrey und widmet sich wieder seinem Essen: Fischstäbchen, Kartoffelbrei und eine grüne Masse, die hoffentlich Spinat ist, auch wenn sie nicht so aussieht. Nicht schlecht.
Ich lege meine Tasche auf meinen Stuhl. »Komm«, sage ich zu Kelsey. »Lass uns auch etwas holen.«
Es ist nicht so, dass mich das Magazin gar nicht kümmert. Aber ich bin nicht wie Vanessa, Alex oder Tobias, die daraufbrennen zu erfahren, was draußen vor sich geht. Mich deprimiert es zu sehen, was man uns vorenthält.
Lustlos schlurft Kelsey hinter mir her zu den Automaten. Wie chromglänzende Türme stehen sie in einer Reihe an der Innenwand der Cafeteria. Es sind achtundzwanzig, ich habe sie gezählt. Der große Ansturm ist bereits vorüber. Wir müssen nicht warten, bis wir vor einem der leuchtenden Displays stehen und uns durch die Menüauswahl scrollen. Hühnchen mit Reis, Salat, die Fischstäbchen … Ich berühre das Bild eines Nudelgerichts und presse meine Handfläche auf den Scanner.
Der Automat piept und ich stöhne auf.
Dann erscheint in dunkelblauen Buchstaben eine Textnachricht auf dem Display.
Es tut mir leid. Nummer 11, Spaghetti Bolognese, steht Ihnen diese Woche leider nicht mehr zur Verfügung.
Genervt wähle ich ein anderes Menü.
Piep.
Es tut mir leid. Nummer 7, Fischstäbchen mit Kartoffelbrei und Spinat, steht Ihnen diese Woche leider nicht mehr zur Verfügung.
»Das soll wohl ein Witz sein.« Während ich die Augen schließe und im Geist durchgehe, was ich in den vergangenen Tagen alles gegessen habe, legt mir Kelsey beruhigend die Hand auf die Schulter.
»Der Spinat sah ohnehin seltsam aus.«
Ich seufze. »Ich hätte mir den Hamburger und die Pommes gestern verkneifen sollen.«
Das Institut legt Wert darauf, dass wir uns gesund ernähren. Was nicht heißt, dass Pizza und Pasta nicht ab und an okay wären. Aber eben nicht jeden Tag, und offensichtlich habe ich mein Kontingent an fettigen Speisen diese Woche bereits ausgereizt.
Kelsey schiebt mich zur Seite, legt eine Hand auf den Scanner und bedient mit der anderen den Touchscreen.
Diesmal piept der Automat nicht. Er summt. Dann öffnet sich das Entnahmefach. Eine große Portion Spaghetti steht darin.
»Bitteschön«, murmelt Kelsey, während sie sich das Tablett schnappt und es herauszieht. »Ich nehme Nummer 2.«
Ich unterdrücke ein dankbares Lächeln. Natürlich verfügt Kelsey selbst noch über genug Units, um Spaghetti bestellen zu können. Vermutlich könnte sie zum Abendessen noch mal Pasta bestellen, ohne dass der Automat protestierte.
Sie wartet neben mir, während ich Nummer 2 wähle. Diesmal macht die Maschine keine Zicken. Dafür muss ich mich beherrschen, nicht die Nase zu rümpfen, als ich den dampfenden farblosen Brei herausnehme, für den sich Kelsey entschieden hat.
Ich kann nicht verstehen, wie meine Schwester diese Pampe herunterbekommt. Der Brei ist nahrhaft, aber von einer schleimigen Konsistenz, bei der es mich schüttelt. Obwohl es ihn in fünf unterschiedlichen Geschmacksrichtungen gibt – Veggie 1, Veggie 2, Pork, Beef und Fish – schmeckt er nach nichts.
Wir tragen die Tabletts zurück zum Tisch. Tobias und Manuel haben inzwischen ihre Plätze eingenommen und stochern in ihrem Essen herum. Offenbar gibt es auch für Manuel nur Nährbrei. Anders als Kelsey hat er nicht viel dafür übrig.
»Rutsch mal einen Stuhl weiter«, bittet Kelsey Vanessa. Die hebt zwar die Augenbraue, tut uns aber den Gefallen. Wir stellen unsere Tabletts ab und gehen noch einmal los, um uns Wasser zu holen – so als hätten wir es vergessen. Als wir zurück zum Tisch kommen, setzt sich Kelsey vor den Nährbrei, ich vor die Spaghetti. Die Kamera, die unseren Tisch filmt, befindet sich hinter uns, sodass auf den Überwachungsbändern nicht sofort erkennbar ist, welche von uns welche ist.
»Ich wünschte, ich hätte auch einen Zwilling.« Manuel wirft einen sehnsüchtigen Blick auf meine Nudeln.
»Halt den Mund«, raune ich.
»Sie werden dir spätestens morgen Früh ohnehin auf die Schliche kommen«, prophezeit Alex.
»Stimmt.« Ich habe nicht vor, mir den Appetit verderben zu lassen. »Aber das ist morgen.«
Jeden Morgen nach dem Waschen müssen wir zum Vita-Scan. Ausnahmen gibt es keine. Der Vital-Scanner sieht aus wie eine alte Fahrstuhlkabine, die komplett mit Plastik verkleidet wurde. Sie misst unsere Temperatur, unseren Puls und untersucht Körper und Blut nach dem kleinsten Anzeichen von Krankheiten. Unsere Eigentümer sind interessiert an gesunden Klonen. Der Scanner wird feststellen, dass ich den Essensautomaten heute ausgetrickst habe. Hart bestrafen wird man mich deshalb nicht. Wahrscheinlich darf ich mich allerdings darauf einstellen, die nächste Woche ausschließlich Nährbrei zum Essen zu bekommen. Was soll’s. Ich bin heute bereits den ganzen Tag über unruhig, ohne zu wissen, warum. Nicht alle Speisen, die uns über den Essensautomaten zur Verfügung gestellt werden, schmecken wirklich lecker. Die Spaghetti sind es wert.
Nach dem Essen tragen wir unsere Tabletts zu den Rollbändern, die das schmutzige Geschirr abtransportieren. Jetzt hätten wir die Gelegenheit, eine halbe Stunde auf dem Hof spazieren zu gehen, aber wir verlassen die Cafeteria nicht. Stattdessen gruppieren wir uns eng um unseren Tisch. Tobias holt das Magazin aus seinem Stoffbeutel. Es ist irgendein billiges Blatt mit Paparazzi-Fotos und hanebüchenen Schlagzeilen. Marisol Rodriguez – Warum sie niemandem ihre Tränen zeigt steht in großen Lettern unter dem Konterfei einer jungen Frau. Ich glaube, sie ist ein Popstar.
Als wir die Zeitschrift durchblättern und über den Artikel In nur zehn Tagen zur Strandfigur stolpern, giftet Alex: »Weil es genau so lange dauert, bis man einen Termin zum Fettabsaugen bekommt.«
»Ich bräuchte keine zehn Tage. Ich wäre jetzt schon fit für den Strand.« Vanessa lächelt verträumt.
Sandstrände kennen wir natürlich nur aus den Medien.
»Allerdings bräuchte ich einen Badeanzug. Mit denen aus dem Institut kann man sich ja nicht vor die Tür trauen.«
»Besser einen Bikini«, schlägt Tobias vor.
Ich verdrehe die Augen, aber Vanessa wirkt geschmeichelt. »Hallo: Narbe?«
Wie Kelsey hat man Vanessa bereits Organstoff entnommen. Anders als meinem Zwilling allerdings keine Niere, sondern einen Teil der Leber. Der Himmel weiß, warum ihr Original bereits mit sechzehn Jahren eine solche Spende benötigt hat. Aber transplantierte Leberstücke wachsen in der Regel nach und auch sonst hat Vanessa den Eingriff viel besser verkraftet als Kelsey. Sie hat keinerlei Schaden davongetragen, sieht man einmal von einer unschönen Narbe ab. Dem Arzt, der sie behandelt hat, war das offenbar egal. Wir sind schließlich keine Originale, bei deren Nachversorgung sorgsam darauf geachtet wird, dass keine äußerlichen Spuren zurückbleiben.
Tobias lässt nicht locker. »Ach, komm schon, die blöde Narbe. Die kann dich nicht entstellen.«
»Und du glaubst, du kannst das beurteilen?«
»Definitiv. Ich sage nur Schwimmunterricht.«
Alex hüstelt, aber Vanessa und Tobi befinden sich in ihrer eigenen Welt.
»Ich wusste gar nicht, dass du mich da so genau beobachtest.«
»Na ja, du …«
»Oh Mann, ihr zwei«, unterbricht Aubrey die Turteltauben. »Tut uns allen einen Gefallen und macht es endlich.«
Vanessa wird rot wie eine Tomate, was sie nur noch niedlicher macht. Tobi gibt sich entrüstet: »Aubrey!«
Der ignoriert ihn und konzentriert sich wieder auf die Zeitschrift. Ich muss ein Grinsen unterdrücken. Mir ist das Gleiche durch den Kopf gegangen, und ich bin mir ziemlich sicher, dass es den anderen ähnlich geht. Ebenso sicher, wie ich mir bin, dass Vanessa und Tobi nie miteinander schlafen werden. Dafür sind sie schon viel zu lange viel zu gut befreundet.
Sorgfältig darauf bedacht, dass unsere Oberkörper das Magazin vor der Kamera verdecken, blättern wir durch die Seiten.
»Ist das nicht Rosalind Stone?« Alex deutet auf die Seite, die Aubrey gerade aufgeschlagen hat.
Eine unglaublich schöne junge Frau mit roter Lockenmähne strahlt uns von einem Foto entgegen. Ein nicht minder attraktiver Asiate im schwarzen Anzug hat die Arme um sie gelegt und eng an sich gezogen.
»Wer ist das?«, fragt Vanessa neugierig. Sie ist selbst Asiatin, gehört aber zu den Schülern des Instituts, die keinen blassen Schimmer haben, wer ihr Original ist. Deshalb interessiert sie sich brennend für jeden Asiaten, den wir in einer Zeitschrift entdecken. Durch ein Magazin haben auch Kelsey und ich herausgefunden, wer wir sind. Unser Original heißt Elektra Hamilton. Sie ist die Tochter des Eigentümers des Instituts – des Mannes, der aus dem Klonen ein Geschäft gemacht hat. Als Mitglied einer der einflussreichsten Familien der Neuen Union tauchte Elektra schon im zarten Kindesalter an der Seite ihrer Familie auf Fotos in Zeitungen und Reportagen im Netz auf.
Als im Institut die Runde machte, von wem wir abstammen, waren einige Schüler sogar neidisch auf uns. Als wären wir etwas Besonderes. Als wären wir nicht ebenso Gebrauchsgegenstände wie sie. Und vielleicht – ich gebe es nicht gern zu – glaubte ich das eine Zeit lang auch selbst. Aber Kelsey hat ihre Niere verloren. Ich bin nicht stolz auf den genetischen Code, aus dem wir zusammengebaut wurden. Wenn überhaupt, schäme ich mich dafür.
Vielleicht kann Nicht-Wissen manchmal eine Gnade sein. Doch das versteht Vanessa nicht. Wir alle, die wir hier sind, besitzen keine Wurzeln. Vanessa glaubt, wenn sie herausfindet, welche Familie für ihre Existenz verantwortlich ist, würde sich das ändern. Sie glaubt, sie könne dann den Gedanken besser ertragen, einen Teil ihrer Leber gegeben zu haben. Weil ihre Spende so einen Sinn bekommt. Ich wünsche ihr, dass sie die Antwort auf ihre Frage nie erfährt. Dass sie nie endgültig begreift, was ihre Eigentümer getan haben und jederzeit wieder tun würden: sie wie Vieh zur Schlachtbank zu treiben.
»Shuichi Watanabe«, liest Aubrey vor.
Vanessa drängt ihn zur Seite. »Stilvoll: Die Tochter von Schauspielerin Miranda Stone kam in einer Robe von Patsy K. mit Werfterben Shuichi Watanabe zu den Eröffnungsfeierlichkeiten. Das ist Shuichi Watanabe? Ich dachte, der sei schwul.«
»Ich dachte, Rosalind Stone sei mit Phillip von Halmen zusammen?«, wirft Alex ein.
»Und ich dachte, dieser ganze Mist interessiert uns nicht.« Meine Schwester lehnt sich zurück und verschränkt die Arme.
»Kelsey hat recht«, stimmt ihr Manuel zu. »Blättert mal weiter. Da gibt’s irgendwo einen Artikel über die Tennis-WM.«
Ich bezweifle, dass ein Artikel in diesem Revolverblatt ernsthaft ergiebige Informationen über die Tennis-WM liefert. Aber ich habe nichts dagegen, das Thema zu wechseln, denn ich weiß sehr genau, dass Rosalind Stone nicht mehr mit Phillip von Halmen zusammen ist. Ich wechsle einen Blick mit Kelsey.
Weil Vanessa noch nicht bereit ist, das Thema fallen zu lassen, sagt Aubrey: »Die beiden haben sich getrennt. Vor Kurzem erst.«
Aubrey war bei uns, als wir vor zwei Wochen im Netz über die Meldung gestolpert sind. Wir waren gerade in der Bibliothek und recherchierten an einem der öffentlichen Elastoscreens für eine Hausarbeit. Mit unseren privaten Leihgeräten können wir nicht ins Netz.
Jetzt schaut Aubrey entschuldigend in unsere Richtung. »Von Halmen ist frisch verlobt. Mit Elektra Hamilton.«
»Was?«
»Habt ihr das gewusst?« Diese Frage richtet sich an Kelsey und mich.
»Warum habt ihr uns nichts erzählt?«
»Lasst gut sein, Mädels«, sagt Manuel, obwohl die letzte Frage von Tobias stammt. Der boxt ihm gespielt empört in die Schultern. Aber die anderen geben Ruhe. Sie wissen, wie unangenehm es Kelsey und mir ist, über unser Original zu sprechen. Ich nicke Manuel dankbar zu, und wir konzentrieren uns wieder auf die Zeitschrift.
Bis uns Alex hektisch darauf aufmerksam macht, dass einer unserer Lehrer zu uns herüberkommt. Tobias gelingt es gerade noch, sie in seinen Stoffbeutel zu stopfen, ehe Mr. Nyström bei uns ist.
Ein ungutes Gefühl macht sich in meiner Magengegend breit, als er seinen Blick zunächst auf Kelsey, dann auf mich richtet.
»Isabel. Du möchtest bitte ins Büro der Direktorin kommen.«
Kapitel 2
In meinem Rücken spüre ich die Blicke der anderen, während ich die Cafeteria verlasse. Bevor ich aufgestanden bin, habe ich unter dem Tisch Kelseys Hand gedrückt und bemerkt, wie sich ein kalter Schweißfilm darauf bildete. Sie ist ebenso nervös wie ich. Wir denken beide an das, was passiert ist, als Direktorin Myles vor einem Jahr Kelsey in ihr Büro bestellt hat.
Mr. Nyström begleitet mich nicht. Er weiß, dass ich seinem Befehl ohne Widerspruch Folge leiste. Wir sind perfekt dressierte Tierchen. Es könnte um etwas ganz anderes gehen, denke ich, als ich durch die hell gestrichenen Flure laufe, die mir plötzlich drückend eng vorkommen. Na klar, als ob es je um etwas anderes gehen würde.
Obwohl ich mir Zeit lasse, stehe ich irgendwann unweigerlich doch vor der eierschalfarbenen Tür von Direktorin Myles’ Büro.
Was könnte Elektra diesmal von uns brauchen? Eine von Kelseys Nieren hat sie schon. Mit einem Schaudern denke ich an Alissa und die beiden schwarzen Löcher in ihrem Gesicht, dort, wo einst ihre Augen saßen. Dann wische ich mir meine schweißnassen Handflächen an meiner Jeans trocken und klopfe an.
Direktorin Myles sitzt hinter ihrem riesigen Eichenholzschreibtisch und wirft mir einen aufmunternden Blick zu. Ich hingegen habe nur Augen für die beiden Personen, die auf gut gepolsterten Stühlen vor ihr Platz genommen haben und sich jetzt zu mir umdrehen. Es sind ein Mann und eine Frau, beide sehr elegant gekleidet. Die Finger der Frau spielen mit der Perlenkette um ihren Hals, die sicher mehr gekostet hat als meine Unterbringung hier für ein ganzes Jahr.
Ich habe sie noch nie in natura gesehen, aber ich weiß sofort, um wen es sich handelt, noch bevor Direktorin Myles sagt:
»Isabel, ich möchte dich mit Sabine und Priamos Hamilton bekannt machen.«
Sie tut so, als hätte sie mich zu einer verdammten Teestunde eingeladen. Mit klopfendem Herzen gehe ich auf die beiden zu, die von ihren Stühlen aufstehen. Er streckt mir mit einem freundlichen Lächeln die Hand entgegen. Sie allerdings sieht aus, als habe sie einen Geist gesehen. Das sind sie also, meine Eigentümer. Als ich Sabine Hamilton die Hand reichen will, pressen sich ihre korallenrot geschminkten Lippen zu einem Strich zusammen.
Ich unterdrücke ein Schnauben. Wenn sie glaubt, für sie sei diese Situation unangenehm, dann hat sie keine Ahnung davon, wie ich mich gerade fühle.
Ich weiß nicht, was ich unangenehmer finde. Ihre offensichtliche Abneigung mir gegenüber oder das seltsame Leuchten in Priamos Hamiltons Augen, während er mich mustert.
»Priamos, Sabine; das ist Isabel.«
»Das ist wohl kaum zu übersehen«, schnappt Mrs. Hamilton, während er sagt: »Klon Nr. 2066-VI-002.«
»003«, korrigiere ich ihn automatisch, obwohl ich es hasse, so angesprochen zu werden. 2066-VI-003 ist die offizielle Bezeichnung, die auf dem medizinischen Datenblatt steht, das bei meiner Züchtung angelegt wurde. Ich bin froh, dass die Betreuer im Institut zumindest den Anstand hatten, uns menschliche Namen zu geben. »Ich würde es allerdings bevorzugen, wenn Sie mich Isabel nennen.«
Er zuckt noch nicht einmal zusammen. Ich erwarte fast, dass Direktorin Myles mich rügt, aber das tut sie nicht. Stattdessen sagt sie: »Isabel ist eine unserer besten Schülerinnen.« Dabei betont sie meinen Namen.
Mr. Hamilton geht einen weiteren Schritt auf mich zu, bis er direkt vor mir steht. Dann besitzt er tatsächlich die Dreistheit, mein Kinn in die Hand zu nehmen und es hin und her zu drehen. Sein Griff ist fest, aber ich wehre mich nicht. Ich balle die Hände zu Fäusten und zwinge mich, an Kelsey zu denken. Kelsey, die mich braucht; die es vor allem nicht braucht, dass ich diejenigen verärgere, in deren Händen unser Schicksal liegt.
»Sie ist perfekt.« Es klingt, als spräche er von einem Apfel.
Aus den Augenwinkeln sehe ich, dass seine Frau ihm einen wütenden Blick zuwirft. »Das ist doch eine Farce!«
»Nicht hier, Sabine«, antwortet er gefährlich leise. Als er sich wieder mir zuwendet, lächelt er freundlich. Er lässt mein Kinn los und deutet auf die Ledercouch, die in einer Ecke steht.
»Nimm bitte Platz, Isabel. Wir möchten etwas mit dir besprechen.«
Wir werden dich leider aufschneiden müssen und dir die Hälfte deiner Organe entnehmen, weil unsere Tochter Elektra etwas unglaublich Verrücktes getan hat. Ich wünschte, mein Gedankenkarussell würde aufhören, ein Horrorszenario nach dem nächsten abzuspulen. Ich bin froh, mich setzen zu können, obwohl die Couch für meinen Geschmack viel zu weich ist. Aber mir zittern die Knie und ich habe wieder zu schwitzen begonnen.
»Medea, könnten wir etwas Wasser bekommen?«, fragt Priamos Hamilton Mrs. Myles, während er auf einem Sessel mir gegenüber Platz nimmt. Als er sie mit ihrem Vornamen anspricht, fällt mir ein, dass sie mit den Hamiltons verwandt ist. Eine Cousine zweiten Grades? Dritten?
Mrs. Myles schenkt uns Wasser aus einer hohen Karaffe ein. Ich traue mich nicht, nach dem Glas zu greifen, das sie vor mir auf einem Tisch abstellt. Stattdessen verschränke ich meine Finger ineinander und lege sie auf meinen Schoß. Ich will nicht, dass sie sehen, wie nervös ich bin. Obwohl das natürlich Unsinn ist. Es braucht nicht viel, meinen Gefühlszustand zu erraten.
»Isabel.« Mr. Hamilton spricht meinen Namen langsam aus. »Dir ist bekannt, dass unsere Tochter vor Kurzem einen Eheschließungsvertrag mit Phillip von Halmen geschlossen hat?«
Jetzt bin ich doch überrascht. Was soll dieses Thema?
»Ja«, antworte ich und denke daran, dass wir erst vor wenigen Augenblicken genau darüber in der Cafeteria gesprochen haben.
»Sehr schön.« Mr. Hamilton lächelt mir freundlich zu. Tatsächlich wirkt es beruhigend. Ein wenig. »Du kannst dir vorstellen, wie aufregend das für meine Familie ist.«
Ich nicke. Dass die Hamiltons und die Stones seit Jahren miteinander konkurrieren, ist kein Geheimnis. Noch nicht einmal das Institut ist so gut abgeschirmt, als dass wir davon nichts mitbekommen hätten. Ich werfe einen Blick hinüber zu Sabine. Vor ein paar Wochen war Phillip von Halmen noch mit Miranda Stones Tochter liiert, also mit der Tochter von Sabines Schwester. Jetzt hat er sich mit Elektra verlobt. Wie hat es sich wohl für Sabine angefühlt, die eigene Schwester zu übertrumpfen? Ich stelle mir vor, Kelsey und ich wären an ihrer Stelle. Nein, denke ich. Wenn ich Kelsey auf solche Weise geschlagen hätte, empfände ich das nicht als Sieg. Was Sabine Hamilton darüber denkt, weiß ich nicht. Sie presst immer noch die Lippen zusammen und mustert mich kalt. Einem direkten Augenkontakt weicht sie allerdings aus.
»Meinen herzlichen Glückwunsch«, sage ich, ohne mich von ihr abzuwenden. »Sie sind sicher überglücklich.«
»Gewiss«, erwidert Priamos Hamilton und zieht meine Aufmerksamkeit wieder auf sich. »Es gibt nur ein Problem. Elektra ist tot.«
Elektra? Tot?!
Einen Augenblick lang glaube ich, mich verhört zu haben. Das kann nicht sein. Wenn die einzige Tochter einer der reichsten Familien des Landes, die künftige Braut eines der begehrtesten Junggesellen der Neuen Union, gestorben wäre, hätten selbst wir das doch längst erfahren.
Meine Antwort fällt deshalb platt aus: »Was?«
Mrs. Myles legt mir beruhigend eine Hand auf mein Knie.
»Es ist erst gestern geschehen«, erklärt Mr. Hamilton. »Bisher konnten wir es geheim halten.«
»Was … Aber …« Ich weiß, dass ich stottere, kann jedoch nichts dagegen tun. Dann trifft mich die Erkenntnis wie ein Schlag. Ich bin frei. Wir sind frei! Unser Original ist tot. Kelsey und ich werden nicht mehr benötigt. Wir können gehen, das Institut verlassen, und endlich leben. Sicher, wir werden nur ein mageres Startgeld bekommen, aber endlich – endlich! – steht uns die Welt offen.
Ich spüre, wie sich ein Lachen seinen Weg aus meinem Bauch nach oben bahnt. Gerade noch kann ich es unterdrücken, indem ich nach dem Glas greife und große Schlucke trinke. Ich muss mich zwingen, die Nerven zu behalten. Die Hamiltons haben ihre Tochter verloren. Gestern erst. Sie sind bestimmt nicht gekommen, um mir eine frohe Botschaft zu verkünden. Warum hat Direktorin Myles nur mich gerufen, aber nicht Kelsey? Und warum trägt Sabine Hamilton kein Schwarz? Etwas stimmt hier nicht. Etwas stimmt hier ganz und gar nicht.
»Wir brauchen deine Hilfe, Isabel«, fährt Mr. Hamilton fort, immer noch ganz ruhig.
Ich schaue hilflos zwischen ihm, seiner Frau und Direktorin Myles hin und her. Als eine Pause entsteht, räuspert sie sich und schenkt mir ein schiefes Lächeln.
»Es ist eine Tragödie, Isabel.« So oft wie heute habe ich meinen Namen noch nie innerhalb von zehn Minuten zu hören bekommen. »Den Schmerz, den die Hamiltons erleiden, können wir uns nicht ausmalen.«
Erzähl mir nichts von Schmerzen, denke ich. Jetzt bin ich es, die die Lippen fest zusammenpresst.
Direktorin Myles fährt unbeeindruckt fort: »Und doch sind sie heute gekommen, um dir ein unglaubliches Angebot zu unterbreiten. Es ist eine riesige Chance. Mehr als das. Es ist die Chance deines Lebens! Alles kann sich für dich ändern.«
»Ich verstehe nicht.« Mein Kopf dreht sich.
»Wir möchten, dass du Elektras Platz einnimmst«, erklärt Mr. Hamilton. Ganz ruhig, als ob er sagen würde: Wir möchten, dass du in der nächsten Aufführung des Schultheaters die Julia spielst. »Unsere Familie hat jahrelang auf diese Verbindung hingearbeitet. So viel hängt davon ab. Wir können es nicht riskieren, dass uns der Hauptgewinn wie Sand wieder durch die Finger rinnt. Phillip von Halmens Vater wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eines Tages Präsident der Neuen Union. Meine Tochter muss ihn heiraten. Und deshalb musst du Elektra werden.«
Ich schaue ihn schockiert an. Sabine Hamilton schnaubt schon wieder und Direktorin Myles legt nun die Hand auf ihr Knie.
Mr. Hamilton ignoriert beide und mustert nur mich. »Versteh mich nicht falsch. Du bist nicht Elektra. Du wirst niemals ihren Platz in unseren Herzen einnehmen können und ihr … Verlust hat uns tief getroffen. Aber jetzt ist keine Zeit für öffentliche Trauer. Du siehst aus wie sie. Du bist ihr Klon, ihr Spiegelbild. Unversehrt und lebendig – und im gleichen Alter. Das ist eine einmalige Chance, und wenn du mitspielst, kannst du dabei sogar noch mehr gewinnen als wir: ein Leben in Luxus, schöne Kleider und Schmuck, Prestige, Anerkennung, die Hand eines attraktiven jungen Mannes, ja, sogar einen Adelstitel.«
»Heute Aschenputtel, morgen Prinzessin!« Sabine Hamiltons Stimme schneidet wie Glas.
Ihr Mann ergreift meine Hand. »Dir wird die Welt zu Füßen liegen.«
Mein Herz setzt für Sekunden aus, und beginnt dann schneller zu schlagen. »Wenn ich sie werde.«
»Wenn du sie wirst, ja.« Sein Griff um meine Finger wird fest. »Glaubst du, du kannst das, Isabel? Elektra werden? Von jetzt auf gleich dein altes Leben hinter dir lassen und nie mehr zurückblicken?«
»Ich … Was ist mit Kelsey?«
»Kelsey?«
»Der andere Klon«, sagt Direktorin Myles ruhig.
Priamos Hamilton schaut mich bedauernd an. »Dieser Plan wird nur funktionieren, wenn du alles hinter dir lässt, Isabel. Auch Kelsey.«
»Was?!«
»Hör mir zu«, mischt sich Direktorin Myles ein.
Sie weiß, wie nah Kelsey und ich uns stehen. Sicher ahnt sie, was gerade in mir vorgeht. Dieser ganze Vorschlag ist absurd, und zwar aus mehr als einem Grund.
»Du musst jetzt stark für euch beide sein. Das ist eine wunderbare Gelegenheit. Denk doch nur nach, was du alles tun könntest.«
Sie betont die Worte auf eine seltsame Art. Als ob es um mehr ginge als um Seidenkleider und Perlenketten.
»Auch für Kelsey«, fährt sie fort. »Die Hamiltons sind bereit, sich deine Kooperation etwas kosten zu lassen.«
Ich blicke hinüber zu Sabine, die das Gesicht verzieht, als hätte sie in eine Zitrone gebissen. Klar, die Vorstellung, mit einem Klon unter einem Dach zu leben und ihn als die eigene Tochter auszugeben, muss für eine arrogante Zicke wie sie ziemlich unerfreulich sein.
»Kelsey wird es an nichts fehlen«, versichert Mr. Hamilton mir. »Wir sind bereit, sie früher aus dem Institut zu entlassen als geplant. Mit einer stattlichen Leibrente noch dazu.«
»Kann sie mitkommen?«
Seine Miene wird hart. »Nein.« Er räuspert sich. »Bedauerlicherweise nicht. Elektra und sie – es gibt keinen Grund, weshalb ihr Kontakt haben solltet. Mir ist zu Ohren gekommen, dass Kelsey einige gesundheitliche Probleme hat. Ich verspreche dir, dass wir uns darum kümmern. Sie wird die beste medizinische Versorgung bekommen, die es gibt. Und sie erhält ihre Freiheit nicht erst mit Vollendung ihres zwanzigsten Standardjahres, sondern in dem Augenblick, in dem du mit Phillip von Halmen vor den Traualtar trittst.«
Am liebsten würde ich ihm mein Wasser ins Gesicht schütten. Gesundheitliche Probleme?! Er weiß genau, warum sie nicht mehr dieselbe ist wie früher. Jetzt begreife ich auch, warum ich es bin, der die Hamiltons dieses vollkommen absurde Angebot machen, und nicht sie. Die kränkliche Kelsey könnte niemals überzeugend zu Elektra werden. Die Frage ist, ob ich es kann. Bisher haben er und Direktorin Myles mir eindrucksvoll geschildert, was ich durch meine Zusage alles gewinne. Niemand spricht darüber, was ich verliere.
»Was ist«, frage ich vorsichtig, »wenn ich das nicht will? Wenn ich Nein sage?«
»Dann«, sagt Sabine Hamilton kalt, »haben wir keine Verwendung mehr für euch.«
Kapitel 3
Irgendetwas an der Art, wie Sabine Hamilton diese Worte ausspricht, macht mir Angst. Keine Verwendung mehr? Sicher meint sie das nicht so, wie es klingt? Unser Original ist tot, Kelsey und ich werden nicht mehr gebraucht. Es kann den Hamiltons egal sein, was wir aus unseren Leben machen.
»Du bist unsere einzige Chance, Isabel«, sagt Mr. Hamilton. »Und es war das letzte Mal, dass ich dich bei diesem Namen nenne.«
Meine Gedanken rasen. Zeit. Ich brauche Zeit.
»Wie schnell muss ich mich entscheiden?«, frage ich deshalb.
»Das wird nicht funktionieren.« Genervt steht Sabine Hamilton auf. Sie dreht mir den Rücken zu und geht hinüber zum Fenster, wo sie auf den Hof hinunterstarrt. Sie zeigt mir im wahrsten Sinne des Wortes die kalte Schulter.
»Unglücklicherweise sofort«, beantwortet ihr Mann meine Frage. »Entweder du hast es in dir, eine Hamilton zu werden, oder nicht. Wir haben leider nicht die Möglichkeit, dir Bedenkzeit einzuräumen. Du musst dich jetzt entscheiden.«
Als ich zögere, lenkt er ein.
»Es muss ja keine Entscheidung für immer sein. Probier es aus. Gib dein Bestes. Komm mit uns, lerne das Leben kennen, das du führen könntest. Die Verlobung soll erst Ende des Monats stattfinden. Wenn du in einer Woche feststellst, dass das nicht das ist, was du willst, kannst du immer noch einen Rückzieher machen.« Er lächelt mich aufmunternd an. »Ich zweifle aber daran, dass das passieren wird.«
Ich fange an, an meinem Daumennagel zu kauen, aber Direktorin Myles greift nach vorne und zieht an meiner Hand. »Diesen unschönen Tick musst du dir schnellstmöglich abgewöhnen.«
Schon klar, Elektra Hamilton hat vermutlich nie an ihren Nägeln gekaut.
Das ist alles verrückt. Es fühlt sich an, als würden die unterschiedlichsten Gedanken in meinem Kopf einschlagen wie ein Meteoritenschauer. Ich weiß einfach nicht, was ich tun soll. Kelsey kommt mir in den Sinn. Filmpremieren. Schöne Kleider. Manuel, der mich sanft in seine Arme zieht und über mein Haar streichelt. Das Leben in einem großen Haus. Bei einer richtigen Familie. Mr. Langton, der keinen einzigen Blick auf meinen Elastoscreen wirft.
Dann, ganz plötzlich, wird es mir bewusst: Elektra Hamilton ist tot. Und damit ist das Leben, wie ich es kenne, ohnehin vorbei, so oder so.
Warum also nicht nach den Sternen greifen? Warum nicht das Unmögliche versuchen? Warum nicht eine andere werden, damit alles anders werden kann?
»Also gut«, höre ich mich sagen. Meine Stimme klingt fremd in den eigenen Ohren.
Sabine Hamilton schließt die Augen. Ich bin mir nicht sicher, ob sie sich über meine Antwort freut oder ärgert. Aber Direktorin Myles strahlt und Mr. Hamilton lächelt so siegesgewiss, als hätte er von Anfang an gewusst, wie ich mich entscheide.
»Ich habe noch nicht zugestimmt.« Ich gebe mir Mühe, selbstbewusst zu wirken. Auch wenn ich mich an meinen nächsten Worten beinahe verschlucke. »Ich bin Ihnen … dankbar für die Chance, die Sie mir anbieten. Und ich verstehe, dass Sie schnell eine Antwort brauchen. Aber eine Entscheidung von einer solchen Tragweite … Geben Sie mir den Nachmittag, um alles in Ruhe zu durchdenken. Heute Abend kann ich Ihnen eine Antwort geben.«
»Isabel …«, beginnt Direktorin Myles, aber Mr. Hamilton unterbricht sie: »Eine Stunde. Und du darfst mit niemandem darüber sprechen.«
»Einverstanden.«
Ich strecke ihm meine Hand entgegen und er schüttelt sie.
»Ich meine es ernst. Kein Wort zu irgendjemandem. Noch nicht einmal zu Kylie.«
Ich mache mir nicht die Mühe, ihn zu verbessern. Mr. Hamilton mag sich freundlich und zuvorkommend geben, aber das liegt daran, dass er etwas braucht, das nur ich ihm geben kann. Und vielleicht Kelsey. Von der er noch nicht einmal den Namen behalten kann. Für ihn sind wir nur Nummern; Produkte seiner langjährigen Forschungsarbeiten.
Die Stunde Bedenkzeit gewähren sie mir. Aber dass ich wirklich den Mund halte, darauf vertrauen sie nicht. Den Hamiltons wäre es zweifelsohne am liebsten, sie könnten mich die ganze Zeit beobachten. Aber wenn die beiden ihre Argusaugen auf mich richten, kann ich nicht nachdenken. Also schließt mich Direktorin Myles ein. Und weil sie das Risiko nicht eingehen will, das in meinem Zimmer zu machen, wo einer der anderen auftauchen und unangenehme Fragen wegen der geschlossenen Tür stellen könnte, bringt sie mich in den Keller. Ein ziemlich trostloser Ort, um über seine Zukunft nachzudenken. In den verschlungenen Gängen aus rauem Stein und dem Gewirr von Röhren riecht es muffig, es ist feucht und dunkel, und auch wenn ich inzwischen viel zu alt dafür bin, um noch an Monster zu glauben, steckt mir Aubreys Gruselgeschichte vom Ungeheuer aus den tropfenden Leitungen in den Knochen.
Doch Direktorin Myles hätte keinen besseren Ort wählen können. Nachdem ich ein paar Minuten lang alibimäßig versucht habe, mich auf einem ausrangierten Stuhl am unteren Ende der Treppe zu konzentrieren, stehe ich auf. Niemand hat mir befohlen, mich nicht von der Stelle zu bewegen.
Also gehe ich in den Raum der schlafenden Prinzen.
Die Hälfte der Lampen hier unten ist entweder kaputt oder spendet nur flackerndes Licht. Als ich mich unter feuchten Kupferrohren hindurchducke, denke ich, dass Monster nicht in Kellern und Abwassersystemen hausen, sondern in Villen.
Den Raum mit den schlafenden Prinzen habe ich bereits vor Jahren entdeckt, als Kelsey, Aubrey, ich und ein paar andere an einem Sommerabend Verstecken spielten. Ich hatte es für eine glänzende Idee gehalten, mich in die Kellerräume zu verziehen, die wir sonst nie freiwillig betraten. Auf der Suche nach dem wirklich perfekten Versteck – eines, das gut verborgen war, aber nicht zu feucht oder gruselig –, bemerkte ich, dass sich außer mir noch jemand im hinteren Teil des Kellers aufhielt: einer der Männer der Sicherheitsfirma, die Tag und Nacht das Gelände des Instituts überwachen.
Neugierig heftete ich mich an seine Fersen. Er war nicht sonderlich gut in seinem Job, denn er bemerkte weder, dass ich ihm folgte, noch, dass ich ihn dabei beobachtete, wie er die einfallsloseste Zahlenkombination, die mir je untergekommen ist, in ein Kontrollkästchen an der Wand einhämmerte: 123456789. Seither kenne ich das vermutlich größte Geheimnis des Hamilton-Instituts.
Bis heute hat sich in diesem versteckten Kellerraum nichts geändert. Noch immer scheint er in magisch-grünem Licht zu glühen. Er ist länglich, die Decke hängt nicht sonderlich hoch. Ich kann darin gerade so stehen, ohne mir den Kopf zu stoßen. Das Glühen geht von sieben Glassärgen aus, die nebeneinander aufgereiht die komplette hintere Hälfte des Raums einnehmen. Weniger als ein Meter Platz ist zwischen ihnen; ihre Fußenden zeigen zur Tür. Sie sind mit einer Flüssigkeit gefüllt, die von innen heraus zu leuchten scheint. Und in dieser Flüssigkeit schwimmen die nackten Körper der verwunschenen Prinzen.
Natürlich sind die Särge nicht wirklich aus Glas und die Körper gehören auch keinen verzauberten Märchenfiguren. Ich vermute, die röhrenartigen Behälter sind aus einer Art durchsichtigem Plastik und die sieben Jungen, die darin schwimmen, Klone wie ich. Warum sie bewusstlos sind, habe ich bis heute nicht herausgefunden. Ob mit ihnen irgendetwas nicht in Ordnung ist? Sie gleichen sich wie ein Haar dem anderen. Sie scheinen perfekt und wirken unglaublich friedlich.
Vielleicht sind es Klone, bei deren Züchtung etwas schiefging. Aber warum hat man sie dann nicht entsorgt?
Über die Jahre hinweg habe ich sie heranwachsen sehen. Männliche Schneewittchen, nicht tot, aber auch nicht am Leben, in einem ewigen Dämmerzustand künstlich versorgt durch Maschinen. Ab und an muss sie jemand aus den Särgen holen und ihnen die Nägel und die Haare schneiden, denn die sind immer perfekt gestutzt und akkurat in Form gehalten. Sie sind in einem Alter, in denen ihnen längst mehr als leichter Bartflaum wachsen sollte, aber die Haut an ihren Kinnen ist makellos. Bis heute habe ich nie jemanden gesehen, der sich um sie kümmert. Manchmal hocke ich, den Rücken an die Wand gestützt, zwischen ihnen, starre ihre reglosen Körper an und stelle mir vor, sie würden bei Mondaufgang erwachen, aus ihren Särgen steigen und die Nächte durchtanzen. Wie männliche Vampirversionen der Prinzessinnen aus dem Märchenbuch, in dem Kelsey und ich so gern gelesen haben, als wir noch klein waren. Bevor wir begriffen, dass es nicht für alle ein Happy End gibt.
Trotzdem komme ich immer wieder hierher. Niemand stört mich hier unten, wenn ich nachdenken muss. So wie jetzt. Ich lasse die Fingerkuppen über das glatte Material der Särge gleiten. Es fühlt sich warm an, als würde die Flüssigkeit darin geheizt. Ich betrachte die sanften, geschwungenen Brauen eines der Prinzen und plötzlich weiß ich, dass ich das Angebot der Hamiltons nicht ablehnen kann. Nicht, weil ich mich nicht traue, und nicht, weil ich Angst vor den Konsequenzen habe, sondern aus dem Grund, dass ich nicht so sein will wie sie: untätig in einem Glassarg gefangen, abgeschnitten von der Außenwelt und unfähig, eigene Entscheidungen zu treffen.
Spielt es wirklich eine Rolle, wenn ich dafür nicht mehr ich sein kann? Wer bin ich schlussendlich schon? Ein Klon, den niemand mehr braucht.
Wenn ich den Platz von Elektra Hamilton einnehme, muss ich nicht zwangsläufig auch zu ihr werden. Sicher, ich muss meine Rolle spielen. Aber Menschen verändern sich. Wenn ich vorsichtig vorgehe, kann ich Elektra Hamilton neu erfinden. Ich kann mich neu erfinden. Ich kann vielleicht nicht die Welt verändern, aber mein Leben. Kelseys Leben.
Das ist der Moment, in dem ich mich entscheide. Ich hole tief Luft und werfe einen letzten Blick auf die schlafenden Prinzen. Die Stunde ist noch nicht vorbei, aber ich drehe mich um, schließe den Saal hinter mir und setze mich wieder auf den Stuhl. Sobald sie mich holen, bin ich bereit, den Hamiltons und Direktorin Myles meine Entscheidung mitzuteilen. Klon 2066-VI-03 wird heute noch sterben.
Als ich mit Direktorin Myles in unser Zimmer komme, sitzt Kelsey mit untergeschlagenen Beinen auf ihrem Bett. Sie sieht mich erwartungsvoll an. Unangenehm berührt erkenne ich, dass ihre Augen durch die Angst, die sich darin spiegelt, lebendiger wirken als irgendwann sonst in der letzten Zeit.
Direktorin Myles schließt die Tür und verschränkt die Hände ineinander. »Isabel wird gleich abgeholt. Ihr habt nur ein paar Minuten Zeit.«
Nach meiner Rückkehr aus dem Keller und meiner Zusage an die Hamiltons hat sie nach Kelsey geschickt. Ich bin ihr dankbar dafür, dass sie mir die Gelegenheit gibt, mich von meiner Schwester zu verabschieden. Aber jetzt, wo ich vor ihr stehe, weiß ich nicht, was ich zu ihr sagen soll. Sie haben mir eingeschärft, ja nichts zu verraten. Also setze ich mich neben sie aufs Bett. Sie greift nach meiner Hand. »Was wollen sie?«
Am liebsten würde ich mit allem herausplatzen. Dass Elektra tot ist, dass Priamos Hamilton mir ein bizarres Angebot gemacht hat – und von meiner irrwitzigen Hoffnung, unser Leben dadurch verbessern zu können. Ich habe keine Geheimnisse vor Kelsey. Wir erzählen uns alles. Oder wir haben das getan, ehe man Kelsey operiert hat und sie so still geworden ist. Sie wird glauben, dass man mich zu einer Operation abgeholt hat, bei der ich gestorben bin. Wie Bethany. Wie Max. Wie ein halbes Dutzend unserer ehemaligen Mitschüler. Sie wird nicht wissen, dass ich lebe und sie sich keine Sorgen zu machen braucht. Dass ich sie eines Tages – eines hoffentlich nicht allzu fernen Tages – nachholen werde.
»Isabel«, drängt sie.
Direktorin Myles räuspert sich.
»Geht es wieder um eine Niere?«
»Nein«, antworte ich zögernd. Es gefällt mir nicht, meine Schwester zu belügen. Sie gegen eine falsche Familie einzutauschen.
Aber die Hamiltons suchen ja nicht nach einer Tochter. Sie suchen nach einer Schauspielerin, um ihren politischen Einfluss zu festigen. Nur deshalb habe ich einen Wert für sie. Erstaunt stelle ich fest, dass mir der Gedanke eine gewisse Befriedigung beschert. Solange ich meine Rolle perfekt spiele, bin ich sicher. Also fange ich besser gleich an zu üben.
»Ich weiß es nicht.« Mein Herz klopft schnell und ich fühle mich wie eine Verräterin. Aber es ist besser so. »Es geht um Elektra, ja. Aber sie haben mir nicht gesagt, was sie diesmal braucht.«
Kelsey schlingt die Arme um mich und wir klammern uns aneinander. Tief sauge ich den Zitrusduft ihrer Haare ein. Sie hat sie heute Morgen gewaschen. Ich will den Duft in mir aufnehmen. Ich will mich immer an ihn erinnern können. Wir waren unser Leben lang zu zweit. Wie soll ich das, was kommt, allein schaffen?
»Elektra hatte einen Unfall«, fahre ich fort, ehe die Wellen der Panik über mir zusammenschlagen können. Und dann erzähle ich Kelsey, dass ich nicht genau weiß, was passiert ist und wie schwer unser Original verletzt ist. Aber dass sie Hilfe braucht und ich noch heute Abend in eine Klink gebracht werde. Dass ich nicht weiß, wie schlimm es um sie – und damit auch um mich – steht, aber dass sie, Kelsey, sich keine Sorgen machen soll. Dass ich in ein paar Tagen zurück bin, wenn alles gut geht. Spätestens nächste Woche.
Direktorin Myles steht die ganze Zeit in der Zimmerecke und hält den Kopf gesenkt. Was in ihr vorgeht? Ich habe keine Ahnung. Sie verhält sich wie ein Schatten, als wäre sie gar nicht richtig da. Sie gibt sich unberührt von all unserer Angst und Verzweiflung. Sie reagiert noch nicht einmal, als Kelsey wütend aufbegehrt.
»Das ist nicht fair. Sie wollen alles von uns. Und wir bekommen nichts. Noch nicht einmal eine Warnung.«
Es ist an mir, sie zu beruhigen.
»Alles wird gut.« Während ich ihr einen Kuss auf die Stirn drücke, rede ich mir das selbst ein. »Es wird schneller alles wieder vorbei sein, als wir jetzt glauben.«
»Du warst noch nicht dort.« Ich höre ungeweinte Tränen in ihrer Stimme. Mein Herzschlag setzt aus. Sie hat nie über ihre Zeit im Krankenhaus gesprochen.
»Kelsey …«
»Lass mich gehen.«
Ich versteife mich.
»Lass mich an deiner Stelle gehen«, wiederholt sie. »Sollen sie doch mich nehmen.«
»Du weißt, dass das nicht geht.«
Und dann klammern wir uns aneinander wie Ertrinkende. Es ist wieder wie vor einem Jahr. Die gleiche Wut. Die gleiche Panik. Nur, dass die Rollen diesmal getauscht sind. Kelsey ist die Schwester, die zurückbleiben muss.
»Wann geht es los?« Ihre Stimme klingt brüchig.
Ich sehe hinüber zu Direktorin Myles. Sie muss meinen Blick spüren, denn nun schaut sie doch auf.
»In zehn Minuten«, antwortet sie.
»Was? Isabel hat noch nicht mal gepackt.«
»Im Krankenhaus bekommt sie ein Nachthemd.«
Ich blicke an mir herunter. Auf meine hellgraue Hose und das fliederfarbene Shirt. Mit mehr als den Kleidern am Leib brauche ich das Institut nicht zu verlassen. Elektra hat keinen Bedarf an meinen abgetragenen Klamotten oder meiner Unterwäsche.
Kelsey steht auf und geht hinüber zu dem kleinen Regal, das über unseren Schreibtischen hängt. Unsere Holzschnitzarbeiten stehen darauf, die wir in der fünften Klasse angefertigt haben. Kelsey hatte sich an einer Arche versucht, aber das klappte nicht so ganz. Noch während des Schnitzens entschied sie sich um und wollte ein U-Boot daraus machen. Zum Schluss wurde es ein Blauwal. Meine stellt – wenn auch nicht sonderlich gut – einen Turm dar: ein hoch in die Lüfte ragendes Gebilde, das sich nach oben hin immer mehr verjüngt, ehe es sich an seiner Spitze wie eine Knospe öffnet. Der Elfenbeinturm. Kurz zuvor hatte ich Die unendliche Geschichte gelesen und fühlte mich selbst ein bisschen wie die Kindliche Kaiserin. Eingesperrt in einem Gefängnis. Unfähig, mich selbst zu retten, während um mich herum die Welt untergeht. Bethany war wenige Wochen zuvor gestorben und die meisten aus meinem Jahrgang begriffen plötzlich, was es wirklich bedeutet, ein Klon zu sein.
Zuerst glaube ich, Kelsey will nach einer der Holzfiguren greifen, aber dann sehe ich, dass sie sich ein Buch schnappt. Anne auf Green Gables von Lucy Maud Montgomery.
»Nimm wenigstens das mit.« Sie wirft das Buch neben mich auf ihr Bett.
Ich schüttle den Kopf. »Lieber nicht. Wenn es verloren geht …«
Tatsächlich will ich es nicht mit zu den Hamiltons nehmen. Es ist zu wertvoll für mich. Es handelt sich zwar nur um eine halb zerfledderte Taschenbuchausgabe; ich habe sie sicher bereits ein Dutzend Mal gelesen. Aber es ist mein Lieblingsbuch. Irgendwann erkannte ich, dass ich lieber Anne sein wollte als die Kindliche Kaiserin, und das gab mir Kraft.
»Es wird schon nicht verloren gehen«, widerspricht Kelsey. »Im Krankenhaus hast du Zeit zum Lesen. Was willst du sonst die ganze Zeit machen? Glaubst du, sie legen dich in ein Zimmer mit einem Elastoscreen?« Sie lacht bitter.
Ich nehme das Buch in die Hand und blättere durch die Seiten. Wir besitzen nicht viele Bücher. Die meisten, die ich gelesen habe, stammen aus der Bibliothek. Aber Anne habe ich vor vielen Jahren vom Institut geschenkt bekommen. Jeder Schüler bekommt zu Weihnachten und zu Beginn der Sommerferien ein kleines Geschenk. Eigentlich wollte ich es nicht mögen, weil es von ihnen stammt. Aber das ist albern, weil ich auch ihr Essen esse, ihre Kleider trage und in ihren Betten schlafe. Und mit Büchern ist das so eine Sache. Ich weiß, dass sie genau darauf achten, welche Romane wir lesen dürfen und welche nicht. Also habe ich mit der gebotenen Vorsicht mit dem Lesen begonnen. Annes Geschichte hat mich gegen meinen Willen verzaubert.
Sie handelt von einem unangepassten, rothaarigen Waisenmädchen. Im Kanada des 19. Jahrhunderts wird es von einem alten Geschwisterpaar adoptiert und wächst auf einer Farm auf. Mit ihrer Wildheit und ihren fantastischen Ideen wirbelt sie das Leben ihrer neuen Zieheltern ziemlich auf. Der Sturm im Wasserglas, heißt ein Kapitel. Was mich erwartet, ist ein Orkan. Vielleicht wäre es schön, etwas Vertrautes an meiner Seite zu haben. Etwas, das mir Kraft gibt.
»Du hast recht.« Um Kelsey zu beruhigen und meine Scharade aufrechtzuerhalten, packe ich neben dem Buch noch schnell ein paar Kleider in den Turnbeutel, in dem ich sonst meine Sportklamotten aufbewahre.
Dann muss ich aufbrechen. Direktorin Myles duldet keinen Aufschub mehr. Bevor ich gehe, drücke ich Kelsey einmal ganz fest. Ich traue mich fast nicht, noch etwas zu ihr zu sagen, aus Angst, dass meine Stimme bricht.
»Bis in ein paar Tagen.«
Sie lächelt schwach. »Bis bald.«
Dann hänge ich mir den Turnbeutel um und gehe zur Tür.
»Isabel!«
Ich drehe mich um. Kelsey steht mitten im Zimmer und reibt sich mit der Hand nervös den Unterarm, so fest, dass ich Angst habe, sie wird sich gleich die Haut abrubbeln. Aber ich sage nichts dazu. Kelsey muss sich jetzt selbst beschützen.
»Ja?«, frage ich.
»Ich bin froh, dass ich dir heute die Spaghetti aus dem Automaten gelassen habe.«
Wir schauen uns lange in die Augen. Es ist uns egal, dass Direktorin Myles uns hören kann.
»Ich auch.«
»Da sind wir wieder.« Direktorin Myles klingt betont fröhlich, als wir in ihrem Büro ankommen.
Mr. Hamilton mustert den Beutel um meine Schulter. »Was ist das?«
»Nur ein paar Sachen«, murmle ich.
Eine Weile lang sagt niemand etwas, dann nickt er, kommt zu mir herüber und nimmt mir den Turnbeutel ab.
»Das brauchst du nicht.« Er klingt freundlich, aber ich spüre, dass er in diesem Punkt nicht mit sich diskutieren lässt. Achtlos lässt er den Stoffbeutel auf den Boden neben der Couch fallen. Ich denke an Anne und das versetzt mir einen Stich.
Es ist nur ein dummes Buch, schelte ich mich. Halb zerfallen. Sobald ich bei den Hamiltons angekommen bin, kann ich mir das E-Book auf einen Elastoscreen ziehen. Wenn ich sein Spiel mitspiele, kauft mir Mr. Hamilton sicher auch eine neue Printausgabe.
Aber das ist nicht das Gleiche. Wem mache ich etwas vor? Ich kann mich nicht dazu bringen, vom Beutel wegzuschauen.
Direktorin Myles tritt in mein Blickfeld und hebt ihn auf. »Ich gebe ihn Kelsey in ein paar Tagen. Versprochen.«
Dann kommt sie zu mir herüber und tut etwas, das mich überrascht. Sie nimmt mich kurz in die Arme und drückt mich. Zuerst versteife ich mich. Ich weiß nicht, wie viele Jahre es her ist, dass mich tatsächlich eine der Lehrkräfte umarmt hat. Dann werde ich lockerer und lasse mich auf die Umarmung ein. Ich bin überrascht, dass ich es schön finde, dass sie mich umarmt.
»Viel Glück«, sagt sie leise.
Ich sehe Direktorin Myles und die anderen Erwachsenen im Institut als meine Gefängniswärter an. Sie sind die Hüter und unternehmen dennoch nichts, um uns zu beschützen. Das tut Direktorin Myles natürlich auch jetzt nicht. Sie lässt zu, dass mich Fremde in einen Handel pressen, in dem es für mich um Leben oder Tod geht. Ich sollte sie dafür verachten. Aber vielleicht hat sie für mich getan, was sie eben konnte. Als sie Viel Glück zu mir sagte, habe ich echte Wärme in ihrer Stimme gehört. Ich muss darauf vertrauen, dass sie auf Kelsey achtgibt. Sie ist die einzige Person hier, die weiß, was mit mir geschehen wird.
Plötzlich denke ich an Alex und Vanessa, Manuel, Tobi und Aubrey. Sie werden auf Kelsey aufpassen. Ich habe das Institut noch nicht verlassen und vermisse sie alle bereits.
»Medea«, sagt Sabine Hamilton schließlich. »Es ist Zeit.«
Und so gehen wir. Ich folge Mr. und Mrs. Hamilton aus dem Büro. Während ich mein altes Leben hinter mir lasse, frage ich mich, ob die beiden darauf bestehen werden, dass ich sie in Gesellschaft anderer Mom und Dad nenne, oder wie immer Elektra ihre Eltern auch angesprochen hat. Die Vorstellung verursacht mir Übelkeit.
Du spielst nur eine Rolle, rede ich mir ein, während ich zum letzten Mal die vertrauten Gänge entlanglaufe. Die Unterrichtseinheiten sind noch nicht zu Ende. Niemand begegnet uns. Aber wenn du Tag und Nacht eine Rolle spielst, was bleibt dann noch von der Person, die du eigentlich bist?
Kapitel 4
Direkt vor dem Hauptgebäude steht ein Automobil. Es sieht edel aus. Der schwarze Lack glänzt in der Sonne, die verchromten Stoßstangen reflektieren das Licht. Außer auf Fotoaufnahmen und Vidfiles habe ich noch keines gesehen.
»Ist das echt?«, murmle ich, als Mr. Hamilton darauf zusteuert. Seine Frau verdreht die Augen und wendet sich von mir ab, als wäre ich die Mühe einer Antwort nicht wert.
Das ärgert mich, obwohl ich weiß, dass meine Frage dumm war. Wenn sich jemand ein Automobil leisten kann, dann die Hamiltons. Automobile sind seit über zwanzig Jahren verboten. Na ja, nicht verboten, aber man benötigt eine Sondergenehmigung, um noch benzinbetriebene Fahrzeuge führen zu dürfen. Kaum jemand macht das mehr. Sie vernichten Rohstoffe, verpesten die Umwelt und das öffentliche Verkehrsnetz und die Verbreitung der Magnetaxen ist so gut, dass keiner mehr auf ein Automobil angewiesen ist. Nicht, dass ich aus eigener Erfahrung sprechen würde. Ich kenne die magnetisch betriebenen Beförderungsmittel nur aus dem Netz und dem Unterricht. Außerhalb des Instituts benutzt sie jeder. Selbst die, die keine Lust daraufhaben, sich mit zahlreichen anderen Fahrgästen in eine enge Kabine zu quetschen. Sie leisten sich eben eine der kleinen, dekadent ausgestatteten Einzelkabinen.
Je länger ich darüber nachdenke, desto weniger überrascht bin ich, dass Priamos Hamilton ein fahrtüchtiges Automobil besitzt. Es ist ein kostspieliges Statussymbol. Allein die Gebühr für die Genehmigung, es zu fahren, muss ihn ein kleines Vermögen kosten. Damit zeigt er der Welt: Seht her, hier bin ich. Das ist genau die Einstellung von jemandem, der nicht mit der Wimper zuckt, schon Stunden nach dem Tod seiner Tochter eine Doppelgängerin anzuheuern, nur damit er in seinem Pokerspiel um politische Macht nicht den Kürzeren zieht. Denn dass es bei der Verbindung zwischen den Hamiltons und den von Halmens um mehr geht als darum, ob sich nun Miranda Stones oder Sabines Tochter einen begehrten Junggesellen angelt, ist mir klar – schwesterliche Rivalität hin oder her.
Wie ein Gentleman der alten Schule hält uns Priamos die Fahrzeugtür auf und wartet, dass Sabine und ich einsteigen. »Mach es dir bequem«, sagt er, »und genieße die Fahrt.« Danach schließt er die Tür und geht zur Fahrerseite. Kein Chauffeur wartet auf uns. Priamos fährt selbst. Auch das sollte mich nicht wundern.
Beim Anblick der Inneneinrichtung des Automobils verschlägt es mir fast den Atem. Die Sitze sind mit weichem Leder bezogen, die Armaturen glänzen. Im hinteren Teil des Wagens, in dem Sabine und ich Platz nehmen, gibt es zwei Sitzbänke, die gegenüberliegend angeordnet sind. Ein Holztischchen steht dazwischen.
Sabine stellt seufzend ihre Handtasche neben sich ab und drückt auf die Tischplatte. Die Stelle, die sie berührt, sieht für mich nicht anders aus als jede andere. Aber kaum hat sie ihren Finger aufs Holz gelegt, gleitet die Platte auseinander. Ein kleiner Hohlraum kommt zum Vorschein, in dem dunkelgrüne Flaschen stehen.
Sie greift hinein und nimmt sich eine. Während Priamos das Automobil startet und ich mich verunsichert in meinen Sitz presse, öffnet sie die Flasche, führt sie an die Lippen und trinkt.
Ich beobachte sie dabei, aber als sie die Flasche absetzt, drehe ich meinen Kopf schnell zur Seite und schaue aus dem Fenster. Neben uns rollt die Gartenlandschaft des Instituts vorbei. Von außen sind die Scheiben verspiegelt. Von innen kann ich jedoch problemlos hinausblicken, auch wenn sich eine Art brauner Schleier über meine Sicht gelegt hat.
»Hier, nimm.«
Sabine hält mir eine der grünen Flaschen entgegen. Sie lächelt nicht.
Zögernd greife ich danach und mache mich daran, den Verschluss abzuziehen. Ich sage noch immer nicht Danke. Die Hamiltons haben das nicht verdient.
In der Flasche ist Wasser. Gekühltes Wasser. Wohltuend frisch rinnt es meine Kehle hinab und ich merke erst jetzt, wie trocken mein Mund geworden ist und wie durstig ich bin. Ich höre nicht auf zu trinken, bis die Flasche halb leer ist.
Verlegen drehe ich sie zwischen meinen Händen.
Sabine hat mich die ganze Zeit über beobachtet, aber sie sagt nichts. Ich kann beim besten Willen nicht einschätzen, was in ihr vorgeht. Sobald wir uns gesetzt haben, hat sie aus ihrer zweifellos ein Vermögen kostenden Handtasche eine Sonnenbrille herausgeholt und sich aufgesetzt. Ich kann vielleicht ihre eisblauen Augen nicht sehen, aber Sabine hat bisher mehr als deutlich gemacht, dass sie mich nicht mag. Nichtsdestotrotz ist sie offensichtlich bereit, diese persönlichen Gefühle beiseitezuschieben, um an ihr Ziel zu kommen. Auch Mr. Hamilton sagt nichts.
»Wie geht es jetzt weiter?«, frage ich, als mir das Schweigen zu unangenehm wird.