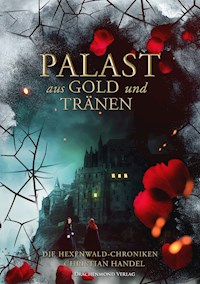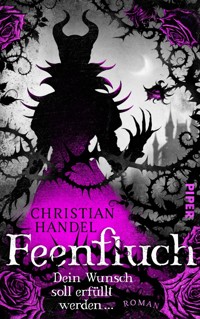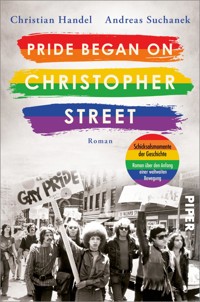Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Drachenmond Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Hexenwald-Chroniken
- Sprache: Deutsch
Fürchtest du dich, bei Mondschein das Grab einer Hexe zu betreten? Unter den Decknamen Schneeweißchen und Rosenrot ziehen die Dämonenjägerinnen Muireann und Rose durch die Lande. Sie bekämpfen Trolle, retten Jungfrauen vor Wassermännern und vertreiben Kobolde aus Mühlen und Bauernhäusern. Als sie von den Bewohnern eines kleinen Dorfs angeheuert werden, den spukenden Geist einer Hexe unschädlich zu machen, geraten sie allerdings in ein alptraumhaftes Abenteuer, das sie an ihre Grenzen führt. Und das ein gut gehütetes Geheimnis ans Licht bringt, das eine von ihnen vor der anderen gern für immer verborgen hätte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 203
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
Rosen und Knochen
Die Hexenwald-Chroniken
Christian Handel
Copyright © 2017 by
Astrid Behrendt
Rheinstraße 60
51371 Leverkusen
http: www.drachenmond.de
E-Mail: [email protected]
Lektorat: Alexandra Fuchs
Korrektorat: Michaela Retetzki
Layout: Michelle N. Weber
Umschlagdesign: Marie Graßhoff
Bildmaterial: Shutterstock
ISBN 978-3-95991-513-7
Alle Rechte vorbehalten
Inhalt
Rosen und Knochen
Nachwort
Der Flötenspieler
Grimmige Märchen
Danksagung
Bücher von Christian Handel
Rosen und Knochen
Geisterkinder führten uns zum Haus der Hexe.
Wie Irrlichter blühten sie als durchsichtige Schemen im Wald auf, schweigend und eine Handbreit über dem Boden schwebend. Sie markierten einen Weg, dem wir offensichtlich folgen sollten, über Baumwurzeln und unwegsames Gelände hinweg. Jedes Kind wies mit einer Hand in die Richtung, in welche wir uns durchs Unterholz schlagen sollten – bis zu der Stelle, an der wir den nächsten Geist trafen. Keiner von ihnen begleitete uns, aber ich konnte ihre Blicke im Rücken spüren, sobald wir an ihnen vorbeizogen.
»Nach allem, was die Dorfbewohner erzählt haben, hätte ich mit etwas Angsteinflößenderem gerechnet«, sagte Rose, während ich, von ihrem festen Griff gestützt, auf einen verwitterten Baumstamm kletterte. Er überspannte eine Schlucht als natürliche Brücke.
»Angsteinflößender?«
Ich hob die Augenbraue, was sie natürlich nicht sehen konnte. Vorsichtig setzte ich meinen linken Fuß vor den rechten.
»Trägt er dich?«, fragte Rose stattdessen. Ich spürte ihre Hände an meiner Hüfte. Sie würde mich nicht stürzen lassen. Also belastete ich mein linkes Bein mit meinem vollen Gewicht. Der Stamm hielt.
»Vermutlich können wir es wagen«, murmelte ich und machte einen weiteren Schritt. »Er ist morsch, aber stabil.« Ich streckte beide Arme aus, um das Gleichgewicht zu halten, und spürte, dass Rose ihre Hände von meinen Seiten löste.
»Willst du meinen Stab zum Balancieren?«, fragte sie.
Rose trug stets einen langen Eschenstab bei sich, den sie sowohl zum Wandern als auch zum Kämpfen benutzte. Dankend lehnte ich ihr Angebot ab. Das schmale Stück würde ich auch ohne schaffen.
»Dann los«, sagte sie aufmunternd und kletterte hinter mir auf den Baumstamm.
Unvorsichtigerweise richtete ich meinen Blick in den Abgrund. Es ging tief hinunter, mindestens acht Mannslängen. Der Abhang zu beiden Seiten war steil und steinig, und durch das Tal floss ein rauschender Strom. Es wäre sicher kein Vergnügen, dort hinunterzustürzen. Entschlossen presste ich die Lippen aufeinander und richtete den Blick wieder nach vorne, heftete ihn auf die kleine, blau flackernde Gestalt auf der anderen Seite, die uns aus dem Schatten einer alten Weide heraus beobachtete.
Langsam balancierte ich über den bemoosten Stamm. Vor sechs Tagen hatten Rose und ich einen Troll bekämpft und von seinen Schlägen taten mir immer noch die Rippen weh. Zumindest wenn ich tief einatmete. Ich wollte meinen Prellungen durch einen unbedachten Schritt nicht noch weitere hinzufügen. Wobei in den Sternen stand, ob ich mir über Prellungen noch Sorgen zu machen brauchte, wenn ich wirklich das Gleichgewicht verlor. Die Schlucht war verdammt tief.
»Ja, angsteinflößender«, knüpfte Rose an unser vorheriges Gespräch an. Wie immer ignorierte sie die große Höhe unbekümmert. »Ich meine, sie stehen nur da, schauen uns aus großen Augen an und weisen den Weg, ohne ein Wort zu verlieren. Nicht sehr unheimlich.«
»Ach, ich weiß nicht. Nachts ist es sicher gruseliger«, gab ich zu bedenken. »Stell dir vor, du schlägst dich im Dunkeln durch die Bäume und plötzlich taucht ein kleiner blauer Kindergeist auf.«
»Mir macht das keine Angst. Mich machen sie allenfalls traurig.«
Ich wusste sofort, was sie meinte. In den Augen der Geisterkinder lag etwas Einsames, Verlorenes. Sie wirkten nicht grausam. Die Bewohner des kleinen Dorfes am Waldrand – unsere Auftraggeber – hatten hingegen von grauenerregenden Erscheinungen berichtet. Von Höllenhirschen mit brennenden Augen und Schaum vor den Nüstern, die auf Waldwegen entlanghetzen und Menschen angriffen. Von einer Wolke aus Staub und Schatten, die wie Nebel aufzog und der durchdringendes Geschrei entstieg. Sogar von einer alten Frau in einem vor Schmutz starrendem Kleid war die Rede gewesen, die in ihrer Hand einen gewaltigen Knochen schwang, an dem noch Blut und Fleischfetzen hingen. Zumindest den Gerüchten nach. Einzig Geisterkinder hatte niemand erwähnt.
Als ich auf der anderen Seite der Schlucht vom Baumstamm sprang, flackerte die kleine Gestalt unter der Weide hell auf und verschwand. Einige Meter von der Stelle entfernt begann die Luft blau zu leuchten und die durchscheinende Silhouette eines Mädchens mit furchtsamem Blick erschien. Ich legte den Kopf in den Nacken und sah, dass die Sonne sich linker Hand anschickte, auf die Baumwipfel herabzusinken. Das bedeutete, wir mussten nach Nordosten, zumindest für den nächsten Abschnitt unserer Reise.
Hinter mir hüpfte Rose leichtfüßig ins Gras und trat neben mich. Sie angelte nach der Wasserflasche, genehmigte sich einen großen Schluck und bot sie dann mir an. Ich schüttelte den Kopf.
»Eine ganz schöne Tortur, sich hier durchs Unterholz zu quälen.« Missmutig betrachtete sie einen Riss in ihrem Hemdärmel. »Verdammte Dornenhecken.«
Ich schenkte ihr ein kurzes Lächeln. »Den kann ich dir heute Abend flicken.«
Rose grinste breit zurück und verstaute die Flasche wieder an ihrem Gürtel. Ich wusste, dass sie mir dankbar für dieses Angebot war. Sie verabscheute jegliche Arbeit mit Nadel und Faden, obwohl ihre Mutter und Großmutter geschickte Näherinnen waren und ihre Schwester sogar bei einer Schneiderin in die Lehre ging. Doch Rose war schon als Kind wilder gewesen als andere Mädchen. Sie hatte sich lieber mit den Jungen im Dorf Schlammschlachten geliefert und Streiche ausgeheckt, anstatt mit Puppen zu spielen oder brav bei der Hausarbeit zu helfen. Ihren ältesten Bruder hatte sie so lange genervt, bis er ihr das Kämpfen beibrachte. Was gut war, denn immerhin verdienten wir damit unseren Lebensunterhalt. Anders als Rose, machte es mir dennoch nichts aus, Beinkleider zu flicken, Hemden auszubessern oder Socken zu stopfen. Handarbeiten entspannten mich.
»Wir sollten weitergehen«, drängte ich zum Aufbruch, nachdem wir uns einen Augenblick ausgeruht hatten. »Ich will die Hütte vor Einbruch der Dunkelheit finden.«
»Fürchtest du dich, bei Mondschein das Grab einer Hexe zu betreten?«, neckte mich Rose.
»Nein.« Ich schüttelte den Kopf und dachte an all die gruseligen Dinge, die wir beide bereits erlebt hatten. Ein Erdhügel, unter dem tote Knochen lagen, jagte mir nicht sonderlich viel Angst ein.
Zu diesem Zeitpunkt wusste ich es noch nicht besser.
Seit vier Jahren zogen Rose und ich als Dämonenjägerinnen durch die Lande. Wir bekämpften Trolle, retteten Jungfrauen vor Wassermännern und vertrieben Kobolde aus Mühlen oder Bauernhäusern. Man kannte uns unter unseren Decknamen Schneeweißchen und Rosenrot. Schneeweißchen, das war ich. Rose hatte mir diesen Spitznamen wegen meiner hellen Haut gegeben. Rosenrot hingegen war eine Anspielung auf ihren richtigen Namen, Rosalie, den sie nicht mochte. Weshalb ich mir angewöhnt hatte, sie Rose zu nennen, ausgesprochen in der Zunge meiner Heimat, mit der Betonung auf dem O und einem stummen E. Wenn wir in Gesellschaft waren, nannte ich sie jedoch Rosenrot, passend zu ihren dunkelroten Locken. Es hatte sich als sicherer herausgestellt, unsere Decknamen zu verwenden. Wir durften nicht unter unseren Geburtsnamen auftreten. Das hätte es unseren Gegnern zu leicht gemacht, unsere Familien aufzuspüren. Na ja, Rose’ Familie zumindest. Gleich zu Beginn unserer Laufbahn als Dämonenjägerinnen war es zu einem unschönen Zwischenfall mit einem Schwarzalben gekommen, der für Rose’ Lieblingsbruder beinahe tödlich ausgegangen wäre. Der pure Zufall hatte es gewollt, dass wir uns zu diesem Zeitpunkt gerade in der Nähe befanden und ihn retten konnten. So etwas wollten wir alle nicht noch einmal erleben. Und so wurden wir zu Schneeweißchen und Rosenrot.
Unsere Erfolgsbilanz war beeindruckend. Dennoch hatten wir nie darüber nachgedacht, uns den königlichen Hexenschlächtern anzuschließen, einer Gruppe militärisch organisierter Jäger, die auf Befehl des Adels hin Dämonen und schwarzmagisches Gelichter zur Strecke brachte. Für ihre Arbeit wurden die Schlächter sehr gut entlohnt und sie suchten ständig nach neuen Rekruten. Aber Rose und ich waren ein Team. Wir konnten uns voll und ganz aufeinander verlassen und kamen gut allein zurecht. Vor allem aber brauchten wir niemanden, der uns sagte, wie wir unsere Arbeit erledigen sollten, oder – schlimmer noch – welche Aufträge wir annehmen durften und welche nicht. Wir blieben niemals länger als ein paar Nächte an einem Ort und obwohl ich mich mein halbes Leben lang nach einem echten Zuhause gesehnt hatte, fühlte ich mich freier und glücklicher als jemals zuvor. So glücklich man eben sein konnte, wenn man Nixen auflauerte und Riesen bekämpfte – oder Wolfsmenschen, die Appetit auf Menschenfleisch entwickelt hatten. Hexen jagten wir nur selten. Aber diese Dorfbewohner brauchten Hilfe. Sie waren bereit, uns im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu entlohnen, und wir scheuten nie eine Herausforderung. Außerdem war die Hexe bereits tot. Ob das die Aufgabe leichter oder schwerer machen würde, musste sich noch herausstellen.
»Der König lebt zu weit entfernt«, hatte der Gastwirt des Auerochsen gemurrt, bei dem wir tags zuvor eingekehrt waren. Bereits zwei Mal hatte das Dorf einen Boten an den königlichen Hof entsandt, mit dem Ersuchen, seine Hexenschlächter zu schicken, um dem Spuk im Wald ein Ende zu bereiten. Bis heute war die Bitte ungehört geblieben.
»Wir können nicht viel zahlen«, hatte er uns gestanden. Die Schenke war, wie alle Gebäude im Dorf, klein und schäbig, und so war seine Offenbarung nicht überraschend gekommen. »Aber was wir haben, geben wir euch gerne. Wenn ihr nur diesem schrecklichen Spuk ein Ende setzt.«
Dann war die ganze Geschichte aus ihm herausgesprudelt: von der Hexe, die mitten im Wald gelebt und kleine Kinder in die Falle gelockt hatte. Niemand, der nach ihrer Hütte suchte, war in der Lage, sie zu finden. Suchtrupps hatten wochenlang das ganze Unterholz durchkämmt – erfolglos. Was sie nicht vermocht hatten, war schließlich einem ihrer Opfer geglückt. Ein junges Mädchen war in der Lage gewesen, sich zu befreien. Mehr noch. Es war ihm gelungen, die Hexe zu töten. »Hat das getan, was man mit jeder Hexe tun sollte«, hatte der Wirt gesagt. »Hat der Teufelsbuhle den Garaus gemacht.«
»Mutiges Mädchen«, hatte Rose gesagt, durchaus mit Bewunderung in der Stimme, und ich hatte ihr zugestimmt. Es gehörte viel dazu, sich aus dem Bannzauber einer Hexe zu befreien und diese gar zu besiegen. Falls die Geschichte stimmte.
Aber das Grauen hörte mit dem Tod der Hexe nicht auf. Ihr Körper mochte vernichtet worden sein, nicht aber ihre Seele. Als rastloser Geist suchte sie den Wald heim. Sie verwandelte harmlose Tiere in angriffslustige Bestien, streifte mit Gespensterhunden über die Waldwege, lockte Wanderer in die Irre und trieb Jäger und Sammler in den Wahnsinn.
Der Weg durch den Wald war nicht länger sicher. Das war für die Dörfler ein Problem, denn durch den dichten Mischwald führte die kürzeste Route zur nächsten Stadt. Rose und ich hatten die kleine Siedlung von Norden her erreicht; wir waren allerdings über ein ziemlich unwegsames Gebirge gekommen. Das war jedoch kein Weg, den man jedermann zutrauen konnte. Seit die untote Hexe zwischen den Buchen, Tannen und Eichen ihr Unwesen trieb, blieben die fahrenden Händler aus. Die Dorfbewohner fühlten sich abgeschnitten vom Rest der Welt. Es blieb also nur eins: Die Hexe musste weg.
Die Sonne war fast hinter den Baumwipfeln verschwunden, als wir die Lichtung erreichten. Eben noch hatten wir uns durchs Unterholz gekämpft, im nächsten Augenblick lichtete sich der Wald und wir blickten auf einen halbrunden Platz, der von Nadelbäumen und am gegenüberliegenden Ende von einer steil aufragenden Felswand begrenzt wurde. In ihrem Schatten kauerte eine Hütte, an welcher der Zahn der Zeit deutlich nagte. Die Schindeln auf dem Dach waren grün bemoost und sahen faulig aus, das Fachwerk aus Lehm und Stroh, das auf einem Steinsockel errichtet war, verwittert. Die Hütte wirkte harmlos. Die einzigen Gefahren, die von ihr auszugehen schienen, waren morsche Balken und rostige Nägel. Hier sollte die Hexe gelebt haben? Hier sollte sich ihr Geist verstecken, der nachts durch die Wälder streifte und Wanderern das Grauen lehrte?
Als wir aus dem Schatten der Bäume auf die Lichtung traten, drehte ich mich noch einmal um. Der Geisterjunge, der als Letzter aufgetaucht war, warf mir einen warnenden Blick zu. Dann flimmerte er hell auf und verglühte wie eine ersterbende Flamme. Ein Schauer kroch mir das Rückgrat entlang. Ich war in meinem Leben schon einigen Geistern begegnet, aber diese kleinen, stummen, unschuldig wirkenden Gesellen berührten mich auf eine Art und Weise, die völlig übertrieben war. Rose legte mir die Hand auf die Schulter und brachte mich dazu, mich wieder umzudrehen. Während sie die Augen zu schmalen Schlitzen zusammenkniff und die Hütte sowie die Umgebung sorgfältig nach etwas Ungewöhnlichem absuchte, ließ ich die Riemen meines Wanderranzens von meinen Schultern gleiten. Ich wühlte zwischen den Gegenständen im Inneren herum, bis ich die schmale Glasphiole fand, in der wir getrockneten Klee aufbewahrten. Kurz entschlossen griff ich außerdem nach einem kleinen Säckchen mit Linsen und band es an meinen Gürtel. Vor zwei Jahren waren wir einer Horde Boggarts entkommen, indem wir ihnen mehrere Handvoll Korn entgegenschleuderten. Unsere Gegner hatten sich gezwungen gefühlt, die Körner zu zählen statt uns zu verfolgen. Zwar handelte es sich hier um Linsen und nicht um Getreide und wir hatten es auch nicht mit Boggarts zu tun, aber man konnte nie wissen.
Während wir langsam auf die Hütte zugingen, öffnete ich das Glasgefäß. Früher hatte offenbar ein hüfthoher Holzzaun den Grund der Hexe von der Wildnis getrennt. Jetzt steckten nur noch hier und da einzelne Latten im Boden. Die größten Teile des Zauns waren in sich zusammengefallen oder niedergetrampelt worden. Das, was einst ein Gemüsegarten gewesen sein musste, war nur noch zerwühltes Erdreich. Unkraut spross neben Wildblumen und Kräutern; zwischen riesigen Rhabarberstauden lugten die violetten Kelche des Gefleckten Lungenkrauts hervor. Es mochte sein, dass die Hexe ihr Gärtchen einst gepflegt hatte, doch mittlerweile hatte die Natur es zurückerobert.
Bevor wir die Grenze zwischen Wald und Garten überschritten, schüttete ich ein paar der getrockneten Kleeblätter auf meine Handfläche und pustete sie in die Luft über dem Grundstück. Gespannt hielten Rose und ich den Atem an. Der ausgeblichene Klee sank fröhlich tanzend zu Boden.
»Es sollte alles in Ordnung sein«, sagte ich. Hätte die Hexe ihr Zuhause mit schwarzer Magie gesichert, wären die Kleeblätter in Flammen aufgegangen oder zumindest verglüht.
Rose warf mir einen skeptischen Blick zu. »Oder dein Gestrüpp ist einfach viel zu alt und vertrocknet. Vertraue lieber auf deinen Dolch.«
Ich seufzte, wusste aber, dass sie recht hatte. Also zog ich meine Waffe.
Rose versicherte sich mit einem Griff, dass sie ihre eigene schnell aus der Gürtelscheide ziehen konnte. Dann umschloss sie ihren Kampfstab mit beiden Händen. Es war Zeit, den Garten der Hexe zu betreten.
Der schmale Trampelpfad, der zum Haus führte, war zwischen den hochwachsenden Gräsern und Nesseln kaum auszumachen. Ich presste die Arme eng an meinen Oberkörper, als wir uns daranmachten, auf die Hütte zuzugehen. Wie immer, wenn wir uns einer potentiellen Gefahr näherten, ging Rose voran und ich folgte dicht hinter ihr.
Die Stängel eines besonders hohen Brennnesselbuschs schob ich mit meinem Dolch zur Seite, um mich an ihm vorbeischieben zu können. Die Klinge meiner Waffe war silbern, damit sie auch gegen Dämonen und Hexenwerk etwas ausrichten konnte. Vor vier Jahren hatte Rose sie mir zum Geschenk gemacht. Damals war sie mir unbezahlbar vorgekommen. Inzwischen konnten wir gut von unserem Gewerbe leben, und ich hätte mir längst einen neuen, schöner gearbeiteten Silberdolch kaufen können. Doch ich behielt diesen. Er war mein Talisman.
Wir waren nur noch wenige Schritte von der Hütte entfernt, als Wind aufkam. Er wirbelte feine Staubkörnchen und Laubfetzen vom Boden auf und blies sie uns ins Gesicht. Ich sah, dass auch Rose ihren Silberdolch zog. Eine Strähne löste sich aus meinem Pferdeschwanz und ich schob sie hinters Ohr. Mit jedem Schritt, den wir auf die Hütte zugingen, wurde der Wind stärker. Zu stark, um natürlichen Ursprungs zu sein.
»Rose …«, rief ich und sah, wie sie kurz nickte.
»Ich weiß. Sie will uns nicht hierhaben«, antwortete sie. Mehr nicht.
Mein Griff um den Silberdolch wurde fester. Plötzlich, von einem Moment auf den anderen, verwandelte sich der Wind in einen Orkan. Er fuhr durch das Geäst der Bäume, heulte um die Hütte und trieb mir Tränen in die Augen. Eine alte Tanne neben uns schwankte gefährlich.
»Als ob …«, murmelte Rose und ging unbeirrt weiter voran.
Es waren jetzt nicht mehr nur Staubkörnchen, die die Böen vom Erdreich aufwirbelten. Vertrocknetes Gras, ganze Erdbrocken, Fetzen von Moos, modriges Laub, Aststückchen, selbst kleine Steine wurden von der Gewalt des Windes erfasst, nach oben gerissen und uns entgegengeschleudert. Rose schlug ein Kreuzzeichen, auch wenn ich vermutete, dass sie ahnte, wie nutzlos das war. Es brachte fast nie etwas. Aber es war eine alte Gewohnheit, die abzulegen ihr nicht gelang. Ich konnte es ihr nicht verübeln. Auch wenn ich schon vieles gesehen hatte, ließ das, was sich jetzt vor uns abspielte, mein Blut in den Adern gefrieren. Der Sturm setzte die Aststückchen und das Laub, die Erdflocken und die Kieselsteine zu einer Form zusammen, alles andere als willkürlich. Der Wirbel aus Staub und Blättern verdichtete sich zu einem Gesicht. Zu einem riesigen, zornigen Antlitz, dessen Züge von spitzen Steinen, Dreck und Ästen gebildet wurden und das von fauligen Laubhaaren umrahmt war. Nichts an ihm wirkte freundlich. Kleine Insekten krochen über die Züge, die sich fortwährend wandelten, sich verformten und zu erschreckend menschlich wirkenden Formen zusammenrotteten. Es wuchs und wuchs, wurde immer größer, bis es uns den Blick auf die Hütte komplett verwehrte. Irgendwann war es mindestens fünf Schritt hoch – und wütend. Das Gesicht riss das Maul auf, als wollte es uns anbrüllen. Der Sturm, der um uns herum tobte und an unseren Kleidern zerrte, dröhnte in meinen Ohren und übertönte jedes andere Geräusch. Dann spie uns die dämonische Fratze eine Fontäne aus Holzsplittern und Steinen entgegen. Gerade noch rechtzeitig gelang es mir, meinen Kopf zur Seite zu drehen und ihn mit meinem rechten Arm zu schützen. Trotzdem spürte ich, wie mich harte, spitze Gegenstände am Arm und an der Wange trafen und mir die Haut aufrissen. Ich biss die Zähne zusammen und hielt die Luft an, bis der Schwall abebbte. Dann spähte ich vorsichtig hinter meinem Arm hervor. Das Gesicht brüllte immer noch. Zwar hatte es aufgehört, uns Schmutz und Kiesel entgegenzuspeien, aber dafür begann es nun, sich auf uns zuzubewegen. Erst langsam, dann schneller und schneller werdend. Fauchend fuhr es auf uns zu.
VERSCHWINDET!
Ich wusste nicht, ob die Stimme echt war oder ich sie nur in meinem Kopf hörte. So oder so, die Botschaft war unmissverständlich. Die Windfratze riss ihr Maul immer weiter auf, bis die Öffnung aus Astwerk und vertrockneten Buchenblättern wie der Eingang zu einem düsteren Tunnel wirkte, in dessen Inneren eine lebendige schwarze Masse umherwirbelte. Rose griff nach meiner Hand und drückte sie fest. Ich wusste, sie würde nicht loslassen.
»Es kann uns nichts tun!«, brüllte sie über den Sturm hinweg, und ich wünschte, ich wäre mir da ebenso sicher.
Dann war die schreckliche Fratze bei uns angekommen und verschluckte Rose und mich.
Wir befanden uns mitten im Auge des Sturms. Ich spürte die Kieselsteine und Erdbröckchen; ausgetrocknetes Gras peitschte mir ins Gesicht, kleine Äste verfingen sich in meinen Haaren und immer mehr Strähnen wurden aus meinem Pferdeschwanz gerissen.
So fühlt es sich an, zur Unterwelt hinabzufahren, fuhr es mir durch den Kopf und ich hatte Mühe, diesen unliebsamen Gedanken beiseitezuschieben. Die Situation war unwirklich. Ich bekam kaum noch Luft. Wir drohten in einer wirbelnden Masse aus Staub, Blattwerk und kleinen Insekten zu ertrinken. Etwas drang in meinen Mund ein. Einer der schwarzen Käfer? Ich wollte würgen, aber mein Hals war verstopft. Ich konnte nicht mehr einatmen! Ich würde ersticken!
Dann war es vorbei.
Von einer Sekunde auf die andere verstummte der Wind. Äste und Laub flatterten auf den Boden. Ich keuchte, spuckte aus und sog dann gierig Luft in meine brennende Lunge, während ich ungläubig Blätter, Steine und Dreck vor mir betrachtete. Eine leblose Masse, als wäre sie nie mehr gewesen.
Bei all dem, womit wir es bei unseren Aufträgen zu tun bekamen, hätte mir ein solcher Spuk eigentlich keine Angst mehr machen sollen. Trotzdem spürte ich, wie wackelig meine Beine waren, als ich mich langsam wieder aufrichtete und versuchte, mir Staub und trockene Laubfetzen von den Kleidern zu wischen.
Rose tat es mir gleich.
Nachdem wir uns wieder einigermaßen sicher auf den Beinen fühlten, lächelten wir uns schwach an. Dann griff Rose nach vorne und pflückte mir irgendein Insekt aus dem Haar. Eklig.
»Das fängt ja gut an. Dabei haben wir die Hütte noch nicht mal betreten«, sagte sie und ich nickte.
»Du spürst es also auch?«
»Irgendetwas ist seltsam. Ich hatte wirklich Angst, als dieses … Gesicht auf uns zugerast kam. Meine Glieder waren wie gelähmt. Weißt du noch? Unsere Begegnung mit den Gewitterhunden in dieser Burgruine?« Ich wartete ihre Antwort gar nicht ab. »Selbst damals habe ich mich nicht so sehr gefürchtet. Mein Herz klopft immer noch wie verrückt.«
»Schwarze Magie«, grummelte Rose wütend.
Ich schüttelte den Kopf. »Die Kleeblätter …«
»Vergiss die Kleeblätter. Hier treibt eine Hexe ihr Unwesen. Eine tote Hexe. Sie nährt sich vermutlich von Angst und sorgt dafür, dass wir sie verspüren. Du kannst mir nicht weismachen, dass mich sonst ein bisschen Wind und Schmutz so aus der Ruhe bringen würden. Ich sage dir, das ist Hexenwerk.«
Vermutlich hatte Rose recht. Nichts verunsicherte sie derart schnell. Mir fiel wieder ein, was die Dorfbewohner am Vorabend über den rastlosen Geist der Hexe, über ihre Höllenhirsche und Irreführungen erzählt hatten und wie sie andere in den Wahnsinn trieb. Ein Mann, der mit seiner Frau zum Holzhauen tiefer als ratsam in den Wald vorgedrungen war, verlor seinen Verstand.
»Er ging mit seinem Beil auf die eigene Frau los«, hatte uns die Wirtsfrau mit gesenkter Stimme erzählt. »Hat sich dann kurz nach seiner blutüberströmten Rückkehr ins Dorf erhängt.«
Lebende Hexen zogen ihre Kraft aus Blut. Vielleicht war etwas dran an Rose’ Theorie, dass der Geist sich von der Angst seiner Opfer nährte.
Ich atmete tief ein und nickte Rose zu.
Sie strich sich eine Haarsträhne aus der Stirn und drehte sich in Richtung des Hauses. »So leicht wirst du uns nicht los«, sagte sie laut und deutlich.
Dann gingen wir weiter.
Ich sah, dass Rose auf die Tür des Häuschens zuhielt.
»Vielleicht sollten wir erst einmal um die Hütte herumgehen«, schlug ich vor.
Rose zögerte. »Eine gute Idee«, sagte sie dann.
Wir verließen den Trampelpfad und schoben uns durch hüfthohe Nesseln. Der Boden war aufgewühlt und erdig, der Pflanzenbewuchs hielt sich in Grenzen. Hier und da wucherte Unkraut in kleinen Büschen und ein ziemlich kümmerlicher Apfelbaum streckte seine knotigen Äste in den Himmel. Der Pfad selbst war frei von Gestrüpp und der Holzzaun zu unserer Rechten besser intakt als das Stück an der Frontseite. Aus der Nähe konnte man sehen, in welch desolatem Zustand sich die Hütte tatsächlich befand. Graublaues Flechtwerk zog sich über die rissigen, stumpf gewordenen Holzbalken, und einer der grün gestrichenen Fensterläden hatte sich aus den Angeln gelöst und war ins hohe Gras gefallen. Zu meiner Überraschung erkannte ich Glas im Fensterrahmen, auch wenn die Scheibe staubblind war. Ich bedeutete Rose mit einem Handzeichen zu warten, ging hinüber und versuchte, einen Blick in das Innere zu erhaschen.
Durch das verdreckte Glas konnte ich nicht viel erkennen. Allerdings war ich mir ziemlich sicher, nur einen einzigen großen Raum auszumachen. Alles andere verschwamm im Zwielicht zu formlosen Schemen.
»Und?«, hörte ich Rose hinter mir fragen.
Ich zuckte mit den Schultern. »Schwer zu sagen. In der Mitte steht ein Tisch, der mit allerlei gedeckt ist, und weiter hinten ist der Raum mit Tüchern abgehangen, glaube ich. Aber um sicher zu sein – ahhh!«
Ein schwarzer Schatten huschte durch mein Blickfeld und ich fuhr erschrocken zurück.
»Da drinnen hat sich gerade etwas bewegt!«
Rose war sofort neben mir und legte ihre Hand auf meine Schulter. Dann schob sie mich zur Seite, um selbst durch das Fenster zu schauen. Eine Weile lang sagte sie nichts. Schließlich zuckte sie mit den Schultern und drehte sich zu mir um. »Ich kann nichts entdecken. Vermutlich wird es irgendein Nager gewesen sein.«
Ich konnte hören, dass sie sich über meinen kleinen Schreckmoment amüsierte, und das ärgerte mich. Schließlich befanden wir uns auf Dämonenjagd. Wenn ich etwas gesehen hatte, dann sollte sie das ernst nehmen. Dummerweise war ich mir inzwischen selbst nicht mehr sicher, ob ich mir den vorbeihuschenden Schemen nur eingebildet hatte. Außer dem Rauschen der Blätter, dem Vogelgezwitscher um uns herum und dem Knacken vom Geäst, das vom Wald her zu uns herüberschallte, konnte ich nichts hören. Alles wirkte verlassen und friedlich. Doch das war es garantiert nicht.
»Sollen wir …«, begann Rose, aber ich unterbrach sie, weil ich keine Diskussion aufkommen lassen wollte.