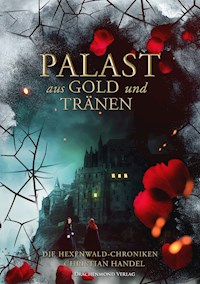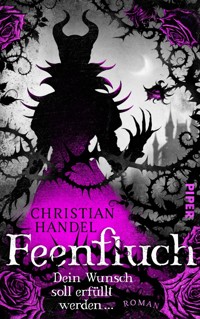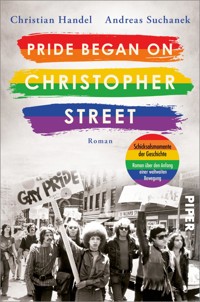Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ueberreuter Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Elektra
- Sprache: Deutsch
Was bleibt von dir, wenn dein Herzschlag nur gestohlen und dein Leben dir entrissen wurde? Die atemberaubende Fortsetzung des gefeierten Near-Future-Thrillers "Becoming Elektra" – noch düsterer, spannender und ergreifender als zuvor! Als Elektra erwacht, kann sie sich an nichts erinnern. Dann erkennt sie das Bett, ihr Zimmer, das Ferienhaus ihrer Familie. Erst beim Blick in den Spiegel zuckt sie zusammen. Wem gehören die langen Haare, die dünnen Beine, die Narbe über dem Bauch? Langsam dämmert ihr, dass sie sich in einem fremden Körper befindet. Doch damit nicht genug. Irgendjemand ist nachts in ihrem Zimmer … und hinterlässt eine rätselhafte Botschaft: "Bereust du es?" Erlebe Kino im Kopf mit der langersehnten Fortsetzung von "Becoming Elektra"! Doch bist du bereit für die Wahrheit hinter dem Spiegelbild?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 438
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Sammlungen
Ähnliche
Über das Buch
Als Elektra erwacht, kann sie sich an nichts erinnern. Dann erkennt sie das Bett, ihr Zimmer, das Ferienhaus ihrer Familie. Erst beim Blick in den Spiegel zuckt sie zusammen. Wem gehören die langen Haare, die dünnen Beine, die Narbe über dem Bauch? Langsam dämmert ihr, dass sie sich in einem fremden Körper befindet. Doch damit nicht genug. Irgendjemand randaliert nachts in ihrem Zimmer. Und hinterlässt eine rätselhafte Botschaft: "Bereust du es?" Die atemberaubende Fortsetzung des Near-Future-Thrillers "Becoming Elektra".
Dieses Buch setzt die Geschichte von BECOMING ELEKTRA fort und kann ohne Vorwissen gelesen werden. Wer jedoch die Ereignisse rekapitulieren will, findet eine Zusammenfassung hier.
In I AM ELEKTRA gibt es einen Moment, in dem sich die Hauptfigur mit einem Gedankengang beschäftigt, der betroffene Personen unter Umständen triggern könnte. Dabei handelt es sich nur um eine einzige Szene. Der Fokus des Buchs liegt nicht auf diesem Thema. Falls du vor dem Lesen wissen möchtest, worum es genau geht, lies bitte hier.
Für Janna & Julianna.Und für alle von euch, die sich dieses Buch gewünschtund sich dafür eingesetzt haben.Danke!
Inhalt
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Epilog
Epilog 2
Epilog 3
Prolog
Sommer 2083SeeYa-Chat von Elektra und Hektor Hamilton, 30. Juli 2083
[Elektra Hamilton; 21:13 Uhr]
Das kann auch nur jemand aus deiner Familie bringen: ein Interview aus dem Gefängnis zu geben.
[Hektor Hamilton; 21:26 Uhr]
Du hast es also schon gelesen?
[Elektra Hamilton; 21:31 Uhr]
Nachdem mir ein halbes Dutzend »Freundinnen« den Link geschickt hat …
[Hektor Hamilton; 21:33 Uhr]
Dad ist beinahe ausgerastet. Wie geht’s dir damit?
[Elektra Hamilton; 21:33 Uhr]
Dass Phaedre sich als Opfer darstellt? Soll sie ruhig. Sie hat es nicht geschafft, mich mit ihrem Getränk zu vergiften. Es wird ihr auch nicht mit Worten gelingen.
[Elektra Hamilton; 21:33 Uhr]
Wieso ist Priamos ausgerastet?
[Hektor Hamilton; 21:35 Uhr]
Urteil noch aussteht. »Die ganze Verlobung von ihr und Phillip ist eine Farce«, so die Angeklagte. »Sie lieben sich nicht.«
Kavanagh behauptet, Hamilton und von Halmen hätten dem Druck ihrer jeweiligen Familien nachgegeben und die Verlobung fingiert. Warum, darüber schweigt sie sich aus. Die Vermutung liegt nah, dass die Kandidatur von Frederic von Halmen für die kommende Legislaturperiode sowie die Gerüchten zufolge angestrebte Verschärfung der Klon-Gesetze dabei eine Rolle ge-
[Hektor Hamilton; 21:35 Uhr]
Elektra Hamilton ruhig geworden ist, steht außer Frage. Hat der Traumprinz die einstige Party-Queen gezähmt? Oder steckt mehr dahinter?
»Es stimmt, dass Elektra sich verändert hat«, verrät Niama Goel, eine enge Freundin. »Sie ist nicht mehr die Gleiche wie noch vor ein paar Monaten. Sie geht nicht mehr aus und meldet sich kaum. Phillip ist ziemlich besitzergreifend.« Sie habe gehört, von Halmen habe in
[Elektra Hamilton; 21:37 Uhr]
Und das regt Priamos auf?!
[Hektor Hamilton; 21:38 Uhr]
Dad ist momentan wegen allem und jedem auf 180.Und dann hat er auch noch mitbekommen,dass du dich mit der OAC getroffen hast.
[Hektor Hamilton; 21:38 Uhr]
Das wird Daddy nicht gefallen!
Was haben die Tochter des CEOs von Hamilton Corp. und die Nummer drei in der Führungsriege der Organisation Against Clones miteinander zu besprechen?
[Elektra Hamilton; 21:39 Uhr]
Das tut mir aber leid.
[Hektor Hamilton; 21:40 Uhr]
Er ist eh schon stinkwütend auf dich, weil Frederic diesenGesetzesentwurf noch nicht einreichen will.
[Elektra Hamilton; 21:41 Uhr]
Ganz ehrlich, dein Vater macht mir keine Angst mehr.
[Hektor Hamilton; 21:42 Uhr]
Nimm das nicht auf die leichte Schulter.
[Elektra Hamilton; 21:43 Uhr]
Lass uns nächste Woche persönlich darüber sprechen, okay? Ich will mir nicht meine letzten beiden Tage in Sydney vermiesen lassen.
[Hektor Hamilton; 21:44 Uhr]
Na gut. Tu nichts, was ich nicht auch tun würde.
[Elektra Hamilton; 21:45 Uhr]
Das wäre auch praktisch unmöglich.
[Elektra Hamilton; 21:46 Uhr]
Ich freu mich auf dich, du Freak.
[Hektor Hamilton; 21:47 Uhr]
Und ich mich auf dich, Hochstaplerin.
[Elektra Hamilton; 21:47 Uhr]
Gib Nestor einen Kuss von mir.
[Hektor Hamilton; 21:48 Uhr]
Mach ich. Und du Phillip.
[Elektra Hamilton; 21:48 Uhr]
Träum weiter.
***
Von: [email protected]: [email protected]: Re: Budget 2084
Priamos,wenn wir die Klone zehn Jahre länger im Institut behalten sollen, kostet das nun mal Platz, Personal und Credits. Du kannst nicht einerseits von mir erwarten, dass ich das alles umsetze, und dich andererseits darüber beschweren, dass sich die Kosten erhöhen.Vergiss bitte nicht, dass die Klone auch beschäftigt werden müssen. Wir können sie schlecht einfach zehn Jahre weiter unterrichten lassen, oder wie stellst du dir das vor?Lass uns gegen Ende der Woche mal gemeinsam durch die Zahlen gehen, okay?VGMedea
Von: [email protected]: [email protected]: Re: Re: Budget 2084
Liebe Medea,es ist mir egal, wie du das Institut organisierst und was du mit den Klonen anstellst, solange sie zur Verfügung stehen, wenn sie für Organentnahmen gebraucht werden, ihr Gesundheitszustand optimal ist und sie nicht rebellieren.Vor deiner Einstellung hast du mir versichert, dass du diese Stelle willst und allen mit ihr einhergehenden Herausforderungen gewachsen bist.Ich erwarte dein überarbeitetes Budget bis Freitag Abend.Priamos
Von: [email protected]: [email protected]: Vertraulich
Sascha,können Sie mir die Bewerbungsunterlagen von Daniel Rossi noch einmal zukommen lassen?Herzlichen DankPriamos
Von: [email protected]: [email protected]: Fwd: VertraulichAttachment: E-Mail »Re: Re: Budget 2084«
Hast du heute Mittag Zeit? Wir müssen uns über Medea unterhalten.Priamos
Voicemail von Oliver Schreiber an Priamos Hamilton vom 1. August 2083, 14:46
Priamos,bitte ruf mich sofort zurück, wenn du das abhörst.Es hat funktioniert! Sie kommt langsam zu Bewusstsein. (zögert) Und wir müssen noch über das andere Thema reden. Die Ergebnisse sind zurückgekommen. Uns bleibt weniger Zeit als erwartet. Tut mir leid. Ruf mich zurück.
***
Kapitel 1
Mörderische Kopfschmerzen wecken mich. Fuck. Es fühlt sich an, als schneide sich ein glühender Draht direkt durch mein Gehirn. Es tut so weh, dass ich glaube, mich gleich übergeben zu müssen. Und dann ist da noch dieser schwere Geruch nach Rosen, so intensiv, dass ich kaum Luft bekomme.
Was war das denn bitte für eine Nacht? Das frage ich mich wirklich, weil ich mich gerade an nichts erinnern kann. Ich hoffe, sie war die Schmerzen wert. Kurz blinzle ich, presse aber schnell wieder die Lider zusammen und lege mir den Unterarm über das Gesicht. Das grelle Licht schmerzt in meinen Augen, und das ertrage ich gerade echt nicht. Nicht, solange dieser sägende Kopfschmerz nicht etwas nachlässt.
Wie spät mag es sein? Der Drache hat mich noch nicht nach unten beordert, also ist es vermutlich vor Mittag. Vielleicht hab ich ja Glück, und sie ist in die Stadt gefahren, mit einer Freundin essen. Welcher Tag ist heute? Samstag? Sonntag? Ich habe keine Ahnung.
Mit einem Stöhnen greife ich quer übers Bett und taste nach meinem Nachtschränkchen. In der obersten Schublade liegen noch ein paar Schmerzpflaster. Das Problem ist, dass ich den Griff der Schublade nicht finde. Meine Hände fassen immer wieder ins Leere.
Also richte ich mich auf, was krass anstrengend ist, und öffne vorsichtig die Lider. Das Licht blendet mich so sehr, dass es mir Tränen in die Augen treibt. Mehr als Schemen kann ich nicht erkennen. Trotzdem merke ich sofort, dass etwas nicht stimmt. Als ich die Tränen fortblinzle und meine Augen mit der Hand beschirme, gewinnen die verschwommenen Schemen um mich herum an Kontur.
What the fuck?
Ich bin nicht zu Hause.
Ich liege zwar in meinem Bett, aber nicht daheim. Das hier ist mein Zimmer in unserem Ferienhaus. Beim Anblick der pinkfarbenen Tapete dreht sich mir der Magen um. Oder würde es, wenn mir nicht ohnehin schon so schlecht wäre. Fand ich das wirklich mal schön?
Wie zur Hölle bin ich hierhergekommen?
Langsam, weil ich keinen Bock habe, die Kopfschmerzen noch zu verschlimmern, sinke ich zurück ins Kissen. Angestrengt versuche ich mich daran zu erinnern, was gestern Nacht geschehen ist. Es ergibt überhaupt keinen Sinn. Prometheus Lodge liegt meilenweit von der Stadt entfernt. Ich war seit über drei Jahren nicht hier.
Hab ich Scheiße gebaut?
Bin ich hierhergekommen, damit mich der Drache nicht so sieht? Aber wie soll das überhaupt gehen? Ein Magnetaxi schafft es gerade mal bis zum Waldrand und in meinem Zustand bin ich sicher nicht mit Dads Automobil gefahren.
Jedenfalls hoffe ich das.
Vielleicht hat Hektor mich gebracht.
Shit, warum fühle ich mich überhaupt so beschissen?
Marcus, fällt es mir da wieder ein und ich erinnere mich an die kleinen, kanariengelben Plättchen, die er mir in die ausgestreckte Hand hat fallen lassen.
Fuck!!
Ich hab mir geschworen, keine Drogen mehr anzurühren. Eine Nierentransplantation reicht ja wohl.
Daran sind nur meine Erzeuger Schuld. Und dieser ganze beschissene Plan.
Hab ich mir Marcus’ Plättchen eingeworfen? Muss wohl, wenn ich mich so zerstört fühle. Dieser Arsch, er hat geschworen, das Zeug sei sauber. Ich drehe mich zur Seite, langsam, ganz langsam, und taste nach meinem Elastoscreen. Er ist nicht da.
Ganz toll.
Frustriert richte ich mich wieder auf, was erschreckend anstrengend ist und mir den Schweiß auf die Stirn treibt. Leider liegen meine Kleider nicht auf dem Fußboden, wie ich gehofft habe. Wo sind sie? Und was trage ich überhaupt für ein peinliches Kleinmädchen-Nachthemd?
»Hektor«, grummle ich. Vermutlich war nichts anderes im Schrank, aber bestimmt hat er sich totgelacht, als er es mir angezogen hat. Wenn er davon Fotos gemacht hat, drehe ich ihm den Hals um.
Wimmernd schiebe ich meine Beine über die Bettkante. Irgendwie sehen die so dünn aus. Mein Blick verschwimmt und ich muss mir mit beiden Händen den Kopf halten.
Klasse, Elektra, denke ich. Ganz großartig hast du das wieder hinbekommen.
Ich bin nur froh, dass Mom mich nicht so sehen kann.
Sobald sich mein Zimmer nicht mehr um mich dreht, stehe ich auf. Oder will es zumindest, doch meine Beine knicken unter mir weg, als wären sie Strohhalme.
Der Schreck fährt mir in die Glieder, aber ich bin zu überrascht, um laut aufzuschreien. Das schneidende Gefühl in meinem Kopf geht in ein Hämmern über.
Das ist der beschissenste Hangover ever.
Langsam stemme ich mich auf und schlurfe mit ausgestreckten Armen nach Gleichgewicht suchend hinüber zum Badezimmer.
Langsam gewöhnen sich immerhin meine Augen an das Licht. Durch die gläserne Außenwand meines Zimmers werfe ich einen Blick auf das leuchtendgrüne Laub der Bäume draußen. Wow. Wenn es mir nicht so beschissen ginge, fände ich den Anblick richtig toll. Hab vergessen, wie schön es hier draußen ist, am Arsch der Welt.
Es dauert ewig, bis ich vor dem Waschbecken stehe und mich mit beiden Händen an seinen Rändern abstütze. Meine Beine zittern leicht und ich spüre unangenehm den Schweiß unter meinen Achseln und auf meiner Stirn.
Nachdem ich einmal tief durchgeatmet habe, blicke ich in den Spiegel.
Eine Fremde starrt mir daraus entgegen.
Sie besitzt das gleiche dunkle Haar wie ich, aber es ist stumpf, fast schon strähnig. Außerdem ist es viel zu lang. Die Locken reichen mir fast bis hinunter zu den Ellenbogen.
Und mein Gesicht!? Es wirkt abgehärmt. Blass. Es ist nicht nur das Licht im Badezimmer. Meine Augen liegen tief in den Höhlen.
Das Blut rauscht mir in den Ohren, als ich, von einer dunklen Ahnung getrieben, mit zitternden Fingern nach dem Saum meines Nachthemds greife und es langsam nach oben ziehe, über die Hüfte bis unter die Brust.
Von rechts oberhalb meines Bauchnabels leuchtet mir eine hässlich gezackte Narbe entgegen.
Eine eiskalte Hand greift nach meinem Herz. Das. Bin. Nicht. Ich.
Die Fremde im Spiegel öffnet den Mund und beginnt zu schreien. Dann wird alles schwarz.
»Elektra.« Dads Stimme. »Elektra, wach auf.«
Was will Dad in meinem Zimmer? Ich bin müde, mir ist schlecht und ich will mir einfach nur die Decke über den Kopf ziehen und weiterschlafen. Ich … reiße die Augen auf. Spöttisch zwinkern mir die Glastropfen an dem albernen Kronleuchter an der Decke mit Lichtreflexen zu. Meine Hand tastet nach meiner Hüfte, nach der Narbe. »Was?!«
»Ruhig.« Dad beugt sich über mich, greift nach meinen Schultern und drückt mich sanft, aber bestimmt zurück in eine liegende Position. Ich blicke ihn ängstlich und verwirrt an. Er schenkt mir ein zuversichtliches Lächeln und streichelt mir mit dem Handrücken über die Wange. Trotzdem versteift sich mein Körper.
»Alles ist gut«, verspricht Dad. »Hab keine Angst.«
Als wäre das so einfach. »Was ist passiert?« Meine Stimme klingt furchtbar. Dünn und heiser. Als hätte ich stundenlang über laute Musik hinweggegrölt. Habe ich das? Immer, wenn ich mich an letzte Nacht zu erinnern versuche, schlägt ein Blitz in meinem Gehirn ein. Trotzdem stemme ich mich auf den Ellenbogen in die Höhe.
»Hier. Trink erst mal etwas.« Dad reicht mir ein Glas Wasser.
»Ich habe keinen Durst«, behaupte ich, aber nachdem er es an meinen Lippen angesetzt hat, ich die kühle Flüssigkeit auf meiner Zunge spüre, merke ich selbst, dass das nicht stimmt. Sie schmeckt ein bisschen bitter. Trotzdem beginne ich gierig zu trinken. Zwei Schlucke. Drei.
»Das genügt«, sagt Dad streng und nimmt mir das Glas wieder ab. »Nicht zu schnell.«
Erschöpft lasse ich mich zurück ins Kissen fallen und atme ein und aus. Anschließend konzentriere ich mich auf Dad, der auf der Bettkante sitzt. »Warum sind wir in Prometheus Lodge?«
Er runzelt die Stirn und greift nach meiner Hand. »Du erinnerst dich immer noch nicht? An nichts?«
»Dad …«
»Du hattest einen Unfall.«
»Was?«
»Du bist vom Pferd gestürzt.«
Das klingt so albern, dass ich beinahe laut auflache. Das letzte Mal von einem Pferd gefallen bin ich mit elf. Konstantin würde mich nie … »Was ist mit Konstantin?«
»Deinem Pferd geht es gut.«
Erleichtert hole ich Luft. »Wie …?« Mehr bringe ich nicht heraus.
Dad kneift sich mit zwei Fingern an der Nasenwurzel, dann nickt er und drückt einmal kurz meine Hand. »Du darfst dich nicht aufregen, Lexi, okay?«
Natürlich beschleunigt sich mein Herzschlag dadurch sofort.
»Dein Unfall. Er war sehr schwer.« Er schließt die Augen, sucht nach Worten. »Du hast … Wir haben …«
»Warum sehe ich aus wie eine wandelnde Leiche?« Durch meinen Kopf schießt das Bild dieses Gesichts im Spiegel: das glanzlose Haar, die Schatten unter den eingesunkenen Augen. Als wäre ich ein Vampir, den man monatelang ausgehungert hat. Die Tränen fließen wieder. »Warum habe ich eine Narbe an der Hüfte, Dad? Meine Niere?«
Marcus und seine beschissenen Drogen. War ich wirklich so dumm? Schon wieder?
Dad beruhigt mich etwas. Zunächst. »Mit deiner Niere hat es nichts zu tun.« Noch einmal kneift er sich an der Nasenwurzel. Das tut er sonst nie. »Es war ein wirklich schlimmer Unfall, Lexi.«
»Was soll das heißen?« Ich spüre meinen eigenen Herzschlag am Kehlkopf.
»Du warst schwer verletzt. Wir mussten dich in ein künstliches Koma legen.«
»Was?!« Als ich hochfahren will, hält mich Dad auf. Ich kämpfe gegen ihn an, aber er ist stärker.
»Du bist noch schwach«, erklärt er. »Du darfst dich nicht aufregen.«
Na klar! Wie bitte soll das funktionieren? Als ich mich weiter gegen seinen Griff stemme, gibt er auf und greift wieder nach dem Glas auf dem Beistelltischchen.
»Trink noch etwas.«
Den Gefallen tue ich ihm nur, weil ich einen Augenblick Zeit brauche, um mich zu sammeln. Und weil ich echt krass Durst habe. Da ist es egal, dass das Wasser abgestanden schmeckt. Fast schon brackig, wenn ich darüber nachdenke.
Nachdem ich das Glas halb geleert habe, reiche ich es ihm wieder. Neben dem Schmerz in meinem Kopf spüre ich jetzt auch noch ein Stechen oberhalb der Leiste. Bilde ich mir das nur ein?
»Warum«, meine Stimme zittert, »habe ich eine Narbe an der Hüfte?«
Dad lächelt mich an. Es soll zuversichtlich wirken, aber ich erkenne die Sorge in seinen Augen. Plötzlich wird mir so übel, dass ich kotzen möchte.
»Dein Körper … Du warst zu schwer verletzt, um dich wieder aus dem Koma zu holen. Die Drogen …«
»Ich schwöre, ich habe seit Jahren keine mehr genommen!« Ist das die Wahrheit? Kann ich mir da sicher sein? Plötzlich wird es dunkler im Raum und ich spüre, wie ich wieder müde werde.
»Lexi.« Dad hilft mir, mich hinzulegen. Er klingt nachsichtig, als ob er mit einem Kind redet. »Es ist jetzt nicht mehr wichtig, ob du … Wir konnten dich nicht mehr aus dem künstlichen Koma wecken. Dein Körper hätte das nicht mitgemacht.«
Der glühende Draht ist zurück. Ich will nicht, dass er weiterspricht. Weil ich die Wahrheit bereits kenne. »Mein Klon«, sage ich leise.
Dad nickt. »Wir mussten dir einen anderen Körper geben.«
Kapitel 2
Ich befinde mich in einem neuen Körper? Wie, will ich fragen, aber meine Augen beginnen zu flattern. Wenn dies der Körper eines meiner Klone war, warum sieht er dann so abgehärmt aus?
»Schlaf noch ein bisschen«, höre ich Dad sagen. Mit jedem Wort rückt seine Stimme mehr in die Ferne. »Wir können nachher weitersprechen.«
Ich will nicht schlafen. Doch noch während ich das denke, wird um mich herum erneut alles dunkel.
Über den Lärm der Musik hinweg kann ich Phaedre kaum verstehen. »Lasst uns noch mal rüber zur Bar gehen!«, brüllt sie, greift nach meiner Hand und zieht mich hinter sich her. Ich habe gerade noch Zeit, mich zu Hektor umzudrehen und ihm zu bedeuten, sich uns anzuschließen, ehe wir in einem Meer aus sich windenden Leibern versinken. Die Leute um uns herum tanzen exzessiv. Im psychedelischen Schlaglicht, das die Scheinwerfer und Laserbeamer auf die Tanzfläche abfeuern, wirken sie wie zuckende Menschenaale. Sie drehen sich wild um die eigene Achse, schmiegen sich aneinander, als wollten sie miteinander verschmelzen, oder verbiegen ihre Körper auf ganz bizarre Weise, während sie die Augen geschlossen halten und ihre Gesichter so ruhig wirken, als wären sie ganz allein auf der Welt.
Was sie nicht sind. Es ist unmöglich, sich zur Bar durchzukämpfen, ohne jeden zweiten Schritt jemanden zu streifen. Der Bass wummert so stark, dass ich ihn auf meiner Haut spüre. Der Boden vibriert unter unseren Füßen. Oh ja, genau das habe ich gebraucht!
»Was willst du trinken?«, fragt Phaedre, als wir uns zur Bar im Nebenraum durchgekämpft haben. Hier ist die Musik etwas leiser, aber die Scheinwerfer malen noch immer grüne, blaue und violette Lichtflecken auf die Umgebung und unsere Haut.
»Gin Tonic«, antworte ich, während Hektor sich neben uns stellt.
»Dieser Club ist so retro.« Er zwinkert der Blondine hinter dem Tresen zu.
»Ist das gut oder schlecht?«
»Das sag ich dir, wenn der Abend vorbei ist.«
Ich folge seinem Blick und mustere das Mädchen, das gerade unsere Getränke mixt.
»Hier.« Phaedre tippt mir auf die Schulter und reicht mir meinen Gin Tonic. Als ich das Glas hebe, färbt sich die klare Flüssigkeit vor meinen Augen blutrot. Geschockt lasse ich den Drink fallen. Noch ehe er auf dem Boden aufprallt, beugt sich Hektor dicht an mein Ohr und flüstert: »Ich muss dir etwas sagen.«
Aber als ich zu ihm herumfahre, ist er verschwunden. Und nicht nur er. Der ganze Club ist weg. Statt an einer Bar befinde ich mich in einem hell gestrichenen Flur, der sich endlos lang in beide Richtungen erstreckt. Keine Bilder hängen an den Wänden. Ich glaube, ich war hier schon mal. Nur wann?
»Hektor?«, rufe ich. »Phaedre?«
Wo sind sie hin? Einige Jugendliche laufen mir entgegen. Die rosafarbenen Nachthemden, die sie alle tragen, ähneln denen, die ich als kleines Mädchen so geliebt habe. Ich öffne den Mund, um sie nach dem Weg ins Euphoria zu fragen, doch dann bemerke ich, dass sie alle die gleichen Gesichter besitzen, Jungen wie Mädchen. What the fuck?!
Als ich mich umdrehe, läuft eines der Mädchen direkt in mich hinein.
»Pass doch auf!«, herrsche ich sie an, nachdem ich mein Gleichgewicht wiedergefunden habe. »Wieso …« Ich erstarre. Dort, wo sich ihre Augen befinden sollten, graben sich zwei vernarbte Krater in die Haut. »What. The. Fuck!«
Das Mädchen geht weiter. Es lässt mich stehen, als habe es mich gar nicht gehört. Ich will sie am Arm festhalten, aber da entdecke ich weiter hinten im Gang ein vertrautes Gesicht. Hektor!
Er blickt in meine Richtung, aber statt auf mich zuzukommen, öffnet er eine Tür und verschwindet.
Ich renne ihm hinterher. Das Zimmer hinter der Tür ist winzig. Zwei schmale Betten stehen darin, Hektor sitzt auf dem einen, ich auf dem anderen. Er lächelt mich an und wirkt dabei irgendwie verlegen?
Er weicht mir nicht mal aus, als ich ihm in die Haare greife und durch die dunkelbraunen Strähnen wuschle. »Krass«, kommentiere ich, denn ich habe ihn schon ewig nicht mehr mit einer halbwegs normalen Frisur gesehen. Ich hab schon fast vergessen, wie unschuldig er aussieht, wenn er seine Haare nicht platinblond bleicht. Ein Grinsen stiehlt sich auf meine Lippen.
»Endlich lächelst du«, sagt er.
Ich zucke mit den Schultern, beschließe, diesen seltsamen Kommentar zu ignorieren und schaue mich stattdessen im Zimmer um. Ganz schön armselig. »Was machen wir hier?«
Plötzlich spüre ich seine Berührung an meinem Kinn. Mit dem Zeigefinger dreht Hektor langsam meinen Kopf in seine Richtung.
»Ich …«, beginne ich, aber mein Bruder ist schneller. Er beugt sich zu mir herüber, schließt die Lider … und küsst mich. Schweißgebadet fahre ich aus dem Schlaf hoch. Mein Bruder hat mir seine Zunge in den Mund gesteckt! Die Erinnerung an meinen Traum ist so lebendig, dass ich mir mit dem Ärmelstoff hektisch über die Lippen reibe. Was sollte das denn bitteschön? Wie kommt mein Unterbewusstsein auf so einen kranken Scheiß?
Es ist dunkel um mich herum. Über den Schattenrissen der Baumkronen draußen hängt ein Halbmond. Mit einem Fingerschnippen aktiviere ich das Deckenlicht und bleibe einen Augenblick lang ratlos im Bett sitzen. Dann fasse ich den Mut, die Bettdecke zurückzuschlagen und mein Nachthemd wieder hochzukrempeln, um noch mal einen Blick auf die Narbe zu werfen. Vorsichtig betaste ich die wulstige Haut. Tut nicht weh, aber trotzdem verspüre ich ein Ziehen in meinem Bauch. Fasziniert, fast schon distanziert, beobachte ich, dass meine Finger leicht zittern. Das ist jetzt also mein Körper? Großartig. Die Stelle, an der bei mir damals die Nierentransplantation vorgenommen wurde, war makellos, dafür haben die Ärzte gesorgt. Es sollte also auch möglich sein, die Narbe auf meinem neuen Körper zu entfernen, oder? Und gegen dieses strähnige Haar und die eingerissenen Nagelbetten müssen wir auch etwas unternehmen. Von dem spindeldürren Körper ganz zu schweigen. Und zwar schnell. So kann ich mich keinesfalls auf meiner eigenen Verlobungsfeier blicken lassen. Das wär’s noch. Der Wievielte ist heute überhaupt?
Mein Elastoscreen bleibt weiterhin verschwunden. Also kämpfe ich mich auf die Beine und suche das Zimmer ab. Meine Knie sind etwas wackelig, aber wenn ich mich langsam bewege, geht’s schon.
Der Elastoscreen liegt weder auf dem schmalen Schreibtisch noch irgendwo auf dem Boden. Ich schaue sogar nach, ob er unter das Bett gefallen sein könnte. Nichts.
Keine Spur.
Kleider finde ich auch keine. Jedenfalls keine, die mir noch passen. Der Einbauschrank ist leer bis auf ein paar Sachen, aus denen ich längst herausgewachsen bin, wie meine Sandalen mit den pinken Glitzerverschlüssen, ohne die ich vor ein paar Jahren keinen Schritt vor die Tür gemacht habe.
Dad muss mich direkt aus dem Krankenhaus hierhergebracht haben. Doch weshalb nach Prometheus Lodge? Warum nicht nach Hause?
Die Antwort auf diese Frage muss wohl bis morgen warten. Keine Ahnung, wie spät es ist. Mitten in der Nacht?
Weil ich Durst habe, blicke ich hinüber zu dem Glas neben meinem Bett. Dann erinnere ich mich an den schalen Geschmack des Wassers. Besser, ich gehe nach unten und suche in der Küche nach etwas anderem.
Leise öffne ich meine Zimmertür und trete hinaus in den Flur. Dad schläft vermutlich schon. Also schalte ich kein Licht an. Als ich klein war, kamen wir ständig hierher. Meine Füße würden den Weg auch im Stockdunkeln finden. Aber das ist gar nicht notwendig, denn der Mond scheint durch die Glaswand ins Haus. Sein Licht lässt die zitronengelbe Farbe, in der Flur und Treppenhaus gestrichen sind, blass wirken. Ich bin kein Kind mehr, aber das kunterbunte Innere von Prometheus Lodge liebe ich noch immer. Es kontrastiert so stark die unterkühlte Fassade des Hauses, ganz aus Glas und weißen Kunststoffverkleidungen. Hier drinnen leuchtet jeder Raum in einer anderen kräftigen Farbe. Es stimmt einen sofort fröhlich. Meistens jedenfalls.
Jetzt presse ich die Lippen zusammen und laufe den Flur entlang. Die Haut meiner Fußsohlen klebt unangenehm auf dem glatten Boden. Die Kinder im Flur mit den gleichen Gesichtern. Das Mädchen ohne Augen. Ich zucke zusammen, als Bilder aus meinem Traum durch meinen Kopf schießen. Kurz muss ich mich an der Wand abstützen. Nicht gut. Ich fühle mich immer noch schwach. Ich schließe die Lider, atme tief ein. Und aus.
Als ich die Augen wieder öffne, knicken die Beine fast unter mir weg, weil in den Schatten am Ende des Flurs zwei winzige Lichtbälle in der Luft schweben.
Erst, als ein rot getigertes Fellbündel von einer der Treppenstufen nach unten springt und auf mich zueilt, beruhige ich mich.
»McGonagall«, flüstere ich und beuge mich nach unten, um die Katze aufzuheben. Schnurrend rollt sie sich in meinem Arm zusammen und lässt es zu, dass ich sie streichele. »Dich gibt es ja immer noch.« Mit dem Fingerknöchel kraule ich die empfindliche Stelle an ihrem Hals. McGonagall streckt genießerisch ihr Köpfchen nach hinten und kneift die Augen zusammen. Ihr Fell ist warm und weich und ich bilde mir ein, ihren Herzschlag an meiner Brust zu spüren. Tränen treten mir in die Augen.
McGonagall ist nicht unsere Katze. Ich weiß nicht, woher sie kommt und wohin sie geht, aber sie taucht immer auf, wenn ich in Prometheus Lodge bin. Ganz so, als wolle sie mir einen Besuch abstatten und sich davon überzeugen, dass es mir gut geht. Dabei war ich es doch, die ihr das Leben gerettet hat. Damals, als ich sie aus dem Fluss gefischt habe, war sie so klein, fast noch ein Katzenbaby. Wie lange ist das her? Sechs Jahre? Sieben?
Es war der Sommer vor meinem elften Geburtstag und ich habe mir von meinen Eltern gewünscht, McGonagall behalten und mit nach Hause nehmen zu dürfen. Dad hätte ich bestimmt überzeugt, aber natürlich war der Drache dagegen.
»Sie gehört sicher jemandem«, hat sie gesagt und mir übers Haar gestrichen, als wolle sie mich trösten. »Und der wäre traurig, wenn McGonagall nicht nach Hause käme.«
Na klar. Als ob das der wahre Grund gewesen wäre. Wobei. Damals hat der Drache gar nicht so oft Feuer gespien.
McGonagall an mich gedrückt, gehe ich zur Treppe und steige ins Erdgeschoss hinunter. Die Katze hat es sich in meinen Armen gemütlich gemacht und erlaubt es mir großzügig, sie weiterzustreicheln. Ihr leises Schnurren beruhigt meine aufgekratzten Nerven. Ich habe seit ewig nicht mehr an McGonagall gedacht. Plötzlich fühle ich mich wie der schlechteste Mensch der Welt.
Auf der vorletzten Treppenstufe verharre ich in der Bewegung. Stimmen. Jemand unterhält sich. Jemand ist noch wach.
»… sagen, wie beschissen ich das finde!«
Der Drache. Die Stimme erkenne ich sofort. Und sie ist richtig mies gelaunt.
Auch wenn ich mich nicht erinnern kann, wann sie das letzte Mal das Wort beschissen benutzt hat. Kaum, dass ich sie höre, habe ich das Bedürfnis, zu ihr zu rennen und mich in ihre Arme zu schmeißen. Auch wenn sie ein Drache ist.
»… nicht so auf«, höre ich da Dad. »… alles gut.« Er spricht deutlich leiser, klingt aber angespannt.
»Gut?!« Mom kann ich besser verstehen als ihn. »Und wie, bitte, hast du dir das vorgestellt? Es wird ihr Leben zerstören!«
»Tu nicht so dramatisch, Sabine«, Dad hat nun ebenfalls die Stimme erhoben. »Du bist nicht deine Schwester.«
»Und du wirst immer mehr zum Arschloch.«
McGonagall maunzt auf, weil ich sie zu fest an mich drücke. Erschrocken lockere ich meinen Griff, dann streichle ich ihr noch mal kurz über das Köpfchen und setze sie vorsichtig auf dem Boden ab. Ich bewege mich langsam und achte darauf, keine unnötigen Geräusche zu machen. Seit wann sprechen meine Eltern so miteinander?
Ich lege meinen Finger auf die Lippen, als könnte McGonagall begreifen, was ich ihr damit sagen will, und schleiche den Flur entlang zu den hinteren Zimmern. Dad und der Drache müssen sich in der Küche befinden. Oder im Wohnzimmer.
»Du musst jetzt die Nerven behalten«, höre ich ihn sagen. Ein schabendes Geräusch dringt in den Flur, vielleicht das Schnarren von Stuhlbeinen. »Du warst mit dem Plan einverstanden.«
»Da wusste ich auch nicht, dass unsere Tochter noch lebt.«
Es geht um mich!
Klar. Wenn sich meine Eltern in den vergangenen Monaten gestritten haben, ging es fast ausschließlich um mich. Aber was meint Mom mit »noch lebt«?
Bei ihren nächsten Worten gefriert mir das Blut in den Adern. »Monatelang, Priamos! Du hast mich monatelang belogen! Damit!«
Ich presse mir den Handrücken auf den Mund, aber ich bin nicht schnell genug. Ein Wimmern entsteigt meiner Kehle und ich muss mich mit der anderen Hand an der Flurwand abstützen. McGonagall miaut besorgt. Und meine Eltern verstummen.
Klappernde Schritte wie von Absatzschuhen hallen durch die Stille, dann wird die Tür zum Wohnzimmer aufgerissen – sie war nur angelehnt –, und meine Mutter stürzt in den Flur.
Der Drache.
Mom.
Ich weiß selbst nicht warum: Tränen steigen mir in die Augen und ich bin einfach nur froh, sie zu sehen.
Wir starren uns an. Hinter Mom erscheint Dad im Flur. »Lexi.«
Als er zu mir kommen will, hält sie ihn mit einer Geste zurück. Stattdessen kommt sie auf mich zu. Erst geht sie. Die letzten Schritte beginnt sie zu rennen und zieht mich in ihre Arme.
»Mein Schatz«, murmelt sie in mein Haar, wieder und wieder. »Mein armer Schatz.« Ihre Stimme klingt erstickt, sie weint.
Plötzlich klammere ich mich an sie, als hinge mein Leben davon ab. Sie duftet nach Midnightsong, ihrem Lieblingsparfum. Darunter liegt der leichte Geruch nach Heu und Pferden. Sie muss noch einmal in den Stallungen gewesen sein, ehe sie hierhergekommen ist.
»Konstantin …«, stammle ich verwirrt. »Dad sagt, ich bin gestürzt.«
Mom drückt mich noch fester an sich. »Jetzt ist alles gut. Ich bin bei dir, mein Liebling.«
Wann hat sie mich das letzte Mal Schatz oder Liebling genannt? Das ist vermutlich fast so lange her, wie ich sie »Mom« genannt habe.
»Worüber habt ihr euch gestritten?« Über Moms Schulter hinweg blicke ich Dad direkt an. Er steht noch immer vor der Tür zum Wohnzimmer und mustert uns, die Stirn in Falten gelegt, als würde unser Anblick ihm wehtun. Weder er noch Mom reagieren. »Bei eurer Unterhaltung gerade«, lege ich deshalb nach, »da ging es um mich.«
»Was machst du hier unten?«, weicht Dad mir aus. »Es ist spät und du bist noch so schwach. Du solltest im Bett liegen und schlafen.«
Monatelang. Das hat Mom zu ihm gesagt. Monatelang!
Obwohl ich es eigentlich nicht wirklich will, löse ich mich aus ihrem Griff. »Ich kann nicht schlafen.«
Dads Miene bleibt ausdruckslos. »Dann solltest du dich zumindest ausruhen.«
»Ich habe Durst.«
Mom streichelt meinen Arm. »Soll ich dir Milch warm machen?«
Das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, hätten wir uns wegen meines Verlobungskleides beinahe gegenseitig die Köpfe eingeschlagen. Warme Milch hat sie Hektor und mir früher immer gemacht, wenn wir hier in Prometheus Lodge waren. In der Villa kümmerte sich Margot um alles. Das tut sie bis heute. Hier in unserem Wochenendhaus gibt es keine Bediensteten. Es war unser kleines Zuhause. Nur für uns vier. Mom und Dad haben sich damals so gut wie nie gestritten. Im Gegenteil, sie haben sogar immer zusammen gekocht.
Warum haben wir aufgehört, hierher zu fahren? Weil wir Kinder das nicht mehr wollten? Oder weil Mom und Dad keinen Bock mehr darauf hatten, für uns heile Familie zu spielen?
»Ich bring dich nach oben.« Dad kommt zu uns herüber.
Mom funkelt ihn an, nickt jedoch. »Ich bin gleich wieder bei dir«, verspricht sie. Aber sie wendet sich nicht ab. Als sie mich anschaut, wird ihr Blick weich. Sie wartet, dass Dad seinen Arm um meine Schulter legt und mich langsam, aber bestimmt den Gang entlang und die Treppe nach oben dirigiert.
Mom blickt mir hinterher, bis ich den Treppenabsatz erreiche und um die Kurve verschwinde.
Kapitel 3
McGonagall folgt uns auf Schritt und Tritt. Sie rollt sich auf meinem Bett zusammen, nachdem ich wieder unter die Decke geschlüpft bin.
Dad setzt sich neben mich. Im gedämpften Licht der Nachttischlampe liegt sein halbes Gesicht im Schatten. »Du kannst nicht schlafen?«
Schlafen? Wenn das stimmt, was du sagst, habe ich für die nächsten Jahre wohl genug geschlafen. Monate! Koma?!
»Was ist denn genau passiert?«, frage ich.
Dad seufzt. »Das habe ich dir doch schon erzählt.«
»Nicht alles. Ich habe euch gehört gerade, dich und Mom.«
Er senkt seinen Blick auf meine Hand. Dann greift er nach ihr und nimmt sie in seine. »Dafür ist morgen noch Zeit.«
»Fuck! Dad!«
»Du sollst doch nicht so roh fluchen.«
»Scheiß drauf!« Mein Blut gerät in Wallung. Ich habe genug hiervon. Plötzlich fühle ich mich nicht mehr hilflos, sondern wütend. Das ist der gleiche Müll wie im ganzen letzten Jahr:
Denk an die Familie.
Wir wissen, was das Beste für dich ist.
Du bist eine Hamilton. Du kannst dich in der Öffentlichkeit nicht so aufführen.
Was für ein Rotz! Mein Vater ist Unternehmer und nicht der verdammte König von England.
»Lexi«, mahnt Dad, aber er lässt meine Hand nicht los.
Und dann dieser Schwachsinnsplan mit der Verlobung! Als wären wir im Mittelalter. Ich soll einen Typen heiraten, den ich im Grunde nicht kenne, weil dessen Vater vermutlich unser nächster Präsident wird. Die Familie sieht es als Investition in unsere Zukunft. Als ob Hamilton Corp. nicht ohnehin bereits Millionen scheffelt. Und was nutzt uns bitte all das Geld, wenn wir nicht wir selbst sein können? Mom, Dad, Onkel Kadmos …
Meine Großcousine Helena hat es schon richtig gemacht, als sie damals die Notbremse gezogen und sich aus dem Staub gemacht hat. Onkel Kadmos mag sie enterbt haben, aber unglücklich ist sie deshalb nicht. Sie hat wenigstens den Mann geheiratet, den sie liebt. Der Einzige in dieser beschissenen Familie, der halbwegs normal tickt, ist mein Bruder.
»Ich will Hektor sprechen.« Erst als ich es ausspreche, merke ich, wie sehr er mir fehlt.
»Es ist mitten in der Nacht.«
»Weiß er überhaupt, dass ich … aufgewacht bin?!«
Dad öffnet den Mund, sagt aber nichts. Muss er auch nicht. Wenn Hektor eine Ahnung hätte, dass ich aus dem Koma erwacht bin, könnte ihn nichts davon abhalten, an meiner Seite zu sein. Da bin ich mir sicher.
»Wo ist mein Elastoscreen?«
»Lexi …«
»Dad. Wo ist er? Wo sind meine ILs?«
»Die brauchst du jetzt nicht.«
Seine Worte, und die Art, wie er sie ausspricht … eine Erinnerung flammt in meinem Geist auf: Dad, der mir wütend meinen Elastoscreen aus der Hand schlägt. Der so viel Kraft in diese Bewegung legt, als sei ihm egal, ob er mir dabei wehtut.
Ich entziehe ihm die Hand.
»Lexi«, beginnt er wieder, viel sanfter.
Diese Erinnerung? War sie echt? Ist das wirklich passiert? Und warum? Als ich versuche, darüber nachzudenken, beginnt mein Kopf wieder zu pochen.
Dad steht auf. »Lass uns morgen früh alles in Ruhe besprechen. Deine Freunde schlafen doch ohnehin schon.«
»Ich kann nicht schlafen«, behaupte ich stur, obwohl ich sehr wohl bemerke, wie müde mein Körper ist.
»Vielleicht hilft dann die Milch.« Wie aufs Stichwort betritt Mom das Zimmer. In der Hand hält sie eine riesige Tasse. Sie ist aus glasiertem Ton. Wir haben sie in der kleinen Fischerhütte weiter unten am Fluss gekauft. Ich kann nicht glauben, dass der Drache mir tatsächlich eine warme Milch gekocht hat.
Dad macht Mom Platz, als sie ums Bett herumkommt und sich neben mich setzt. »Ich hab Honig hineingetan«, verrät sie, während sie mir die Tasse in die Hand drückt.
Sie liegt warm in meinen Händen und genüsslich schnuppere ich an dem Getränk. Sofort fühlt sich meine Brust nicht mehr so eng an.
»Ich lasse euch beiden mal allein«, sagt Dad, und ich halte ihn nicht auf.
Nachdem er das Zimmer verlassen hat, nippe ich an der Milch. Auf einmal bin ich wieder zehn Jahre alt.
Mom blickt mich an, während ich trinke. Sie schaut mich einfach nur an. Als könne sie nicht glauben, dass ich vor ihr sitze.
»Was ist passiert?«, frage ich, nachdem ich die Milch halb ausgetrunken habe.
»Lexi …«, beginnt auch sie vorsichtig, aber ich unterbreche sie: »Mom. Bitte. Ich hab euch gehört.«
Sie schließt die Lider und ich stelle die Tasse auf das kleine Beistelltischchen neben dem Bett. »Du hast zu Dad gesagt, du dachtest, ich sei tot.«
Als sie die Augen wieder öffnet, glitzern Tränen darin. »Was hat dir dein Vater bereits erzählt?«
»Nicht viel. Dass ich vom Pferd gefallen bin. Und …« Ich blicke an mir herunter. »Das.«
Mom nickt. Sie sucht nach Worten, das kann ich sehen. Doch sie findet keine.
»Ich sehe furchtbar aus«, sage ich.
»Nein.«
»Schau dir diesen Körper an, Mom. Das bin doch nicht ich! Kannst du mir sagen, wo der Sinn darin liegen soll, einen Klon zu besitzen, wenn der so erbärmlich aussieht?«
Mom streicht mir eine Locke dieses strähnigen Haares hinter das Ohr und kurz wird mir schwindelig, weil ich das Gefühl habe, in mein eigenes Gesicht zu blicken.
»Das hier war nie geplant«, murmelt sie. »Hierfür waren die Klone nie gedacht.«
Mit meiner Rechten taste ich unter der Decke nach der Narbe auf meinem Bauch. Mom hat recht. Organtransplantationen: Ja. Ein Körpertausch? Verrückt! Klingt wie etwas aus einem Science-Fiction-Roman.
»Geht es Konstantin gut?«, will ich wissen, um mich abzulenken. »Ist ihm etwas passiert?«
Mom wendet das Gesicht ab. »Wir haben ihn verkauft.«
»Was?!« Kann dieser Tag noch beschissener werden? »Wieso?«
Als sie mich jetzt anblickt, ist ihre Miene wie versteinert. Sie erinnert mich wieder an die Marmorstatue, die im Schatten der Eingangstreppe in der Villa steht. »Weil ich seinen Anblick nicht mehr ertragen konnte, nach dem, was passiert ist.«
Der Drache ist zurück. Ich rücke von ihr ab. »Er ist mein Pferd! Wie konntest du …«
»Ich dachte, du seist tot«, antwortet sie kalt. »Glaubst du allen Ernstes, ich wollte ihn da noch um mich haben?«
»Keine Ahnung, was passiert ist. Aber es war bestimmt nicht Konstantins Schuld. Er würde mich niemals abwerfen. Niemals.«
»Das weiß ich jetzt auch!«
»Was weißt du?« Meine Augen verengen sich, aber ihre Lippen pressen sich zu einem schmalen Strich zusammen. Vier, fünf Herzschläge lang mustern wir uns. Keine ist bereit nachzugeben. Schließlich bin ich es, die die Faust auf die Matratze neben sich haut. McGonagall zuckt zusammen und springt aus dem Bett. Toll. Hab ich ja super hinbekommen.
Aber ich werde mich jetzt nicht abspeisen lassen. »Warum stecke ich in diesem beschissenen Körper?«
»Weil du deinen eigenen Körper zugrunde gerichtet hast!« Mom tut es McGonagall gleich und steht auf. Aber sie verschwindet nicht. Sie ballt die Hände zu Fäusten und blickt auf mich herab. Mit einer Mischung aus Wut und Enttäuschung. Wie immer also.
Ich wusste, dass die Nummer mit der Milch und »mein Liebling« nicht lange halten würde. Wem hat sie da etwas vorgemacht, mir oder sich selbst?
Das Beschissene an der Situation ist, dass sie diesmal recht hat. Jedenfalls, wenn ich Dad Glauben schenke. Trotzdem ist das nicht die ganze Wahrheit: »Von mir existiert ein halbes Dutzend Klone«, presse ich hervor, mühsam beherrscht. »Dass ihr mich nicht in den Körper eines Kindes gesteckt habt, verstehe ich ja. Aber warum musste es der Klon sein, dem bereits eine Niere fehlt?«
Mom schluckt und wendet den Kopf ab. »Der andere stand gerade nicht zur Verfügung.«
»Was soll das heißen?« Ihre Behauptung ist lächerlich. Dad hat aus dem menschlichen Klonen überhaupt erst ein Geschäft gemacht. Uns gehören die Institute, in denen die Klone leben.
»Wir reden morgen weiter.«
»Nein.«
»Es ist spät, Elektra.«
Jetzt also auch noch sie. Fassungslos – und angepisst – beobachte ich, wie sie sich wie Dad zuvor der Tür zuwendet. Ich bin es so leid, dass sie mir nie sagen, was wirklich vor sich geht. Mich mit ihrem beschissenen Politiker-Söhnchen verloben, das darf ich aber.
»Ich kann ohnehin nicht schlafen!«, rufe ich ihr hinterher, als sie bereits die Türklinke in der Hand hat. Über ihre Schulter hinweg blickt sie mich an, und wieder glaube ich, Tränen in ihren Augen schwimmen zu sehen.
»Trink die Milch. Das wird helfen.«
»Wieso? Hast du ein Beruhigungsmittel reingekippt?«
Mom schnappt nach Luft. Einen Augenblick lang wirkt sie schwach und verletzt. Dann streckt sie den Rücken durch und hebt das Kinn. »Natürlich nicht. Ich bin nicht dein Vater.«
Darauf wiederum weiß ich nichts zu antworten. Der Drache gewinnt seine alte Selbstbeherrschung zurück. »Wir reden morgen früh.«
Es klingt wie eine Drohung. Als wäre es nicht genau das, zu dem ich sie ohnehin bewegen will.
Ich starre noch ewig auf die Zimmertür, selbst nachdem sie schon längst hinter Mom ins Schloss gefallen ist. Als ich nach der Tasse Milch greife, streift mein Blick das Glas auf dem Boden. Der leicht bittere Geschmack des Wassers. Moms Bemerkung gerade. Kann es sein, dass Dad …?
Ich trinke die warme Milch aus, lösche das Licht und schließe die Augen. Aber der Schlaf will nicht kommen. Mein Herz klopft wild in meiner Brust. Mom hat von Monaten gesprochen, in denen sie geglaubt hat, ich sei tot. Wie kann das sein?
Ich habe Angst. Vor den Antworten auf meine eigenen Fragen.
Und ein bisschen sogar vor meinen Eltern.
Kapitel 4
Keine Ahnung, wann ich endlich doch eingeschlafen bin, aber die Nacht vergeht immerhin traumlos. Als ich die Augen öffne, kitzeln Sonnenstrahlen mein Gesicht. Einen Moment lang fühle ich mich sogar ganz wohl. Dann fällt mir wieder ein, wo ich mich befinde und in welchem Körper ich stecke. Und ich spüre die Anwesenheit von jemand anderem im Raum.
Hektisch drehe ich mich zur Seite und sehe meinen Bruder neben dem Bett auf dem Boden sitzen. Er hat den Rücken an die Wand gelehnt und liest in einem Buch. Seine Haare leuchten türkisfarben.
»Guten Morgen.« Hektor legt das Buch beiseite und lächelt mich an. Seine Stimme klingt warm, fast streichelnd und ich bin unheimlich glücklich, sie zu hören.
»Schlafe ich noch?«, frage ich, als er zu mir ins Bett kriecht. Meine Ohren glühen, weil mir der Traum wieder einfällt, in dem er mich geküsst hat.
Hektor lehnt sich an mich. »Das sollte vermutlich eher ich fragen.«
Thank God! Jetzt ist er wieder einfach nur mein Bruder.
»Was ist mit deinen Haaren passiert?«
»Darüber willst du jetzt sprechen?«
»Die Farbe ist selbst für dich extrem.«
Hektor grinst. »Vor ein paar Wochen waren sie pink. Mom hat sich so herrlich darüber aufgeregt.«
Erst grinse ich, dann sickert die Bedeutung seiner Worte in mein Bewusstsein. Vor ein paar Wochen. Mom dachte monatelang, ich sei tot …
Hektor bemerkt meinen Stimmungswechsel gar nicht. »Diesmal hat es leider nicht geklappt. Sie hat mir einfach nur ins Haar gegriffen, an den Spitzen gezupft und gesagt, dass das Färben wohl richtig gut gelungen ist.«
»Klingt nicht nach ihr«, murmle ich.
Hektors Lächeln verschwindet und er zieht mich in seine Arme. »Sie hat sich verändert.« Einen Moment lang drücken wir uns.
»Wie geht es dir?«, fragt er, ohne mich loszulassen.
»Ich weiß es nicht.« Der Kloß in meinem Hals macht es unangenehm zu sprechen.
Hektor geht es offensichtlich ähnlich. »Ich bin so froh …«, flüstert er dann. »Ich bin so froh. Ich bin so froh.«
»Und ich bin froh, dass du da bist.« Mein Blick wandert durchs Zimmer. »Prometheus Lodge.« Es ist ewig her, dass wir zuletzt hier waren, will ich eigentlich sagen. Da fällt mein Blick auf meinen Schreibtischstuhl. Oder besser gesagt auf das, was davon übrig ist. Umgekippt liegt er auf dem Teppich vor der Fensterfront. Eine seiner pinkfarbenen Rollen ist abgebrochen. Ich entdecke sie auf meinem Schreibtisch. Und in der gläsernen Fassade – angespannt drücke ich den Rücken durch und richte mich auf – prangt ein hässlicher, weißer Kratzer.
»Was …«
Hektor legt mir die Hand auf die Schulter »Du erinnerst dich nicht?«
Entgeistert blicke ich ihn an. »An was?«
»Du warst ziemlich … panisch.«
»Das sieht so aus, als habe ich versucht, mit meinem Schreibtischstuhl auf die Außenwand einzuprügeln.« Was natürlich nichts bringt. Das Sicherheitsglas ist absolut bruchsicher. Ich weiß das. Warum sollte ich also …? Und warum kann ich mich nicht daran erinnern? Schon wieder nicht?
»Fuck!«
»Ich bin froh, dass du ausgerastet bist.« Hektor legt sein Kinn auf meine Schulter. Hitze steigt mir in die Wangen, zum einen, weil mich das an diesen schrecklichen Albtraum erinnert, zum anderen, weil das, was er da sagt, so absurd klingt.
»Wirklich«, sagt er und schmiegt sich an mich. Wie ein Freund, wie ein Bruder. Ich entspanne mich. »Sonst hätten sie mich vermutlich gar nicht hergeholt. Ich glaub’s nicht, dass sie so lange gewartet haben.«
Ich lehne mich an ihn und atme tief ein. Ich rieche seinen herben Zitrusduft. Diese Orangennote. Ich hingegen stinke vermutlich nach altem Schweiß und Dreck. Wann habe ich mich das letzte Mal gewaschen? Wann hat man mich das letzte Mal gewaschen? Schauderhafter Gedanke! Ich hoffe, das war nicht Dad! Ich muss an etwas anderes denken!! »Sie haben dich hergeholt?«
»Mom hat angerufen, aber Dad wollte es auch. Sie haben gehofft, das würde dich beruhigen.«
»Ich kann mich nicht erinnern«, murmle ich.
»Du hast die beiden erschreckt. In der Nacht haben sie einen dumpfen Schlag gehört und dich mit dem Stuhl in der Hand hier gefunden.«
Ich nicke, obwohl ich das nicht meine. Ich kann mich an nichts erinnern. An gar nichts! Wenn ich versuche, mich an diesen Ausritt mit Konstantin zu erinnern, daran, was geschehen ist, ist da nur ein schwarzer Fleck. Das Letzte, was ich noch weiß, sind Marcus und seine gelben Plättchen und ein heftiger Streit mit Mom und Dad. Es ging um das Kleid für meine Verlobungsfeier.
»Der Eheschließungsvertrag!«
Hektor räuspert sich, bleibt aber stumm.
»Was ist mit Phillip von Halmen? Glaubt der auch, ich sei tot?«
»Vielleicht solltest du darüber lieber mit …«
»Hektor!« Ich löse mich aus seinem Griff und verändere meine Position. Mit untergeschlagenen Beinen setze ich mich auf das Bett ihm gegenüber und greife nach seinen beiden Händen. »Wem kann ich denn vertrauen, wenn nicht dir?«
Röte überzieht sein Gesicht und seine Ohren. Es würde niedlich aussehen, wäre die Situation nicht so ernst.
»Phillip und du, ihr seid bereits miteinander verlobt. Gewissermaßen.«
»Was?! Wie …?«
»Dein Klon«, antwortet Hektor und mir wird schlecht. »Der andere. Isabel. Sie …« Er senkt den Kopf. »Sie hat …«
»Nun spuck es schon aus.«
Hektor blickt mich ernst an. »Sie hat deinen Platz eingenommen.«
Einen Augenblick lang fühle ich mich wie gelähmt. Ich habe gehört, was Hektor gesagt hat, aber ich bin weit davon entfernt, es zu verstehen. Kälte kriecht durch meinen Körper, während ich meinen Bruder mustere, die sanften Augen, die mich mitleidig ansehen, die türkisfarbenen Haare.
»Ela …«, sagt er, als ich zu zittern beginne, aber ich beiße die Zähne fest aufeinander und schüttle heftig den Kopf. Die Narbe an meiner Seite beginnt zu schmerzen. Es ist nicht meine. Ich will sie nicht!
»Was soll das heißen?«, herrsche ich ihn an, sobald ich meinen Körper wieder unter Kontrolle habe.
»Wir sollten auf Mom und Dad warten. Ich habe ihnen versprochen, dir nichts zu sagen.«
»Seit wann interessiert dich, was der Drache will?«
Hektor senkt seinen Kopf.
»Ich bin deine Schwester, verdammt! Was würdest du sagen, wenn sie dich ersetzt hätten?«
»Du hast recht.« Er wirft einen Blick zur Tür. »Aber leiser.«
Erleichtert hole ich tief Luft und nicke. Ich krieche unter der Bettdecke hervor – ich trage noch immer dieses unmögliche Kleinmädchen-Nachthemd –, lehne mich mit dem Rücken gegen das Kopfende des Bettrahmens und ziehe die Beine an. Dann umschlinge ich sie mit den Armen. Knochendünn sind sie, mit trockener Haut, aber in dieser Haltung hört die Narbe auf zu schmerzen. So kann ich mich ganz auf das konzentrieren, was Hektor mir jetzt erzählt.
»Nach deinem … Unfall.« Er zögert. »Konstantin kam ohne dich im Sattel zurück. Völlig aufgeschreckt. Wir haben dich gesucht. Du hast verkrümmt auf dem Boden gelegen, neben einem Stein. Du hattest …« Er schließt die Augen, jetzt zittern seine Lippen. Die Stimme klingt erstickt, als er weiterspricht. »Dein Kopf. Du hattest dir den Kopf verletzt. Da war so viel Blut.«
Mein Herz beginnt rasend schnell zu schlagen. »Nein.«
»Dad wollte nicht auf die Medics warten. Er hat dich selbst in die Stadt gefahren. Zu Dr. Schreiber. Nach ein paar Stunden kam er mit Onkel Kadmos im Schlepptau zurück. Er war am Boden zerstört. Er hat die Familie ins Arbeitszimmer beordert, alle, außer Nestor. Und da hat er es uns gesagt: dass du tot bist.«
»Warum hat er das getan?«
»Das musst du schon ihn fragen.« Hektor blickt mich direkt an. »Ich begreif es ja selbst nicht. Und ich wollte es zunächst auch nicht glauben.«
»Was ist dann passiert?«
»Er hat uns verboten, irgendjemandem zu verraten, was geschehen ist.«
»Warum?!« Kaum habe ich gefragt, dämmert es mir bereits. »Die Verbindung zu den von Halmens.«
Hektor nickt und auf einmal verachte ich meinen Vater. Natürlich hat er daran gedacht. An seine millionenschwere politische Allianz. »Ich habe selbst nicht begriffen, was da wirklich vor sich geht. Alles ging so schnell«, verteidigt sich Hektor. »Ich wollte nicht wahrhaben, dass du … Bis sie kam.«
»Sie?«
»Isabel. Dein Klon.«
»Du nennst sie Isabel?«
»Das ist nun einmal ihr Name.«
»Klone besitzen keine Namen.«
»Das haben wir gedacht, aber es stimmt nicht.« Er will nach meiner Hand greifen, doch ich weiche zurück.
»Du hast einfach so zugelassen, dass ein Klon meinen Platz einnimmt?« Ich kann es nicht glauben. »Und Mom auch?«
Hektor senkt geschlagen den Kopf. »Wir dachten, du seist tot!«
»Bullshit! Das ist …« Wut kocht in mir hoch, so stark, dass ich plötzlich verstehen kann, warum ich versucht habe, die Außenwand einzuschlagen. »Willst du mir erzählen, dass alle geschluckt haben, dass sie ich ist? Steckt ihr alle unter einer Decke? Hat niemand etwas gemerkt?!«
Hektor kann mich nicht anblicken. »Nein.«
Seine Antwort versetzt mir einen Stich. Niemand hat gemerkt, dass ich nicht ich bin? Nicht sein Ernst!
»Doch«, korrigiert er sich dann. »Nestor.«
Tränen treten mir in die Augen. Mein kleiner Bruder.
»Sonst niemand?« Julian. Beim Gedanken an meinen Freund klopft mein Herz schneller. Aber Julian kann ich Hektor gegenüber natürlich nicht erwähnen. Er ist unser Stallmeister. Und mein Bruder weiß nicht, dass er und ich zusammen sind.
»Phaedre?«, frage ich stattdessen. Meine beste Freundin muss doch gemerkt haben, dass eine Hochstaplerin meinen Platz eingenommen hat.
Hektor rutscht unruhig hin und her. »Phaedre war auf Kreta, als du deinen Unfall hattest, erinnerst du dich?«
Na großartig.
»Inzwischen müsste sie zurück sein, oder?« Ich versteife mich. »Welcher Tag ist heute?«
Wie lange war ich bewusstlos?
Hektor blickt zur Tür. »Wir sollten wirklich auf …«
»Gib mir deinen Elastoscreen.« Es wurmt mich immer noch, dass Dad mir meinen weggenommen hat. Forsch strecke ich ihm die Hand entgegen, aber Hektor zögert.
»Ela …«
»Mach schon!«
Er seufzt, schließt kurz die Augen, und als er sie wieder öffnet, blickt er mich direkt an. So fest, dass mir sofort ein Schauder das Rückgrat hinunterrieselt. Was jetzt kommt, wird mir nicht gefallen.
Und tatsächlich. »Morgen ist der dritte August. Du lagst fast drei Monate im Koma.«
Kapitel 5
Drei Monate meines Lebens habe ich verschlafen. Sie sind weg, einfach so, als wären sie nie da gewesen.
Das geht mir durch den Kopf, während ich an der Außenwand meines Zimmers stehe und durch die Glasfassade auf die Baumwipfel starre.
Ich kann es nicht glauben.
Nein, ich will es nicht glauben. Nicht, dass ich geschlafen habe, und erst recht nicht das, was mir Hektor über Phaedre erzählt hat. Und über Julian. Und Dad.
Im Geäst einer Kiefer sitzen zwei Raben. Einer davon scheint mich aus seinen schwarzfunkelnden Augen anzustarren. Dann dreht er den Kopf weg.
Mit den Fingern fahre ich über die raue Scharte im gehärteten Glas. Seltsam, dass ich mich nicht daran erinnern kann, mit dem Schreibtischstuhl auf die Außenwand eingedroschen zu haben. Ich meine, was sollte das? Ich war nie ein Mädchen, das Teller geworfen hat. Sich anbrüllen ja. Streiten? Hallo, darin bin ich so gut, dass man das fast als mein Hobby bezeichnen könnte.
Aber was sollte diese Aktion? Selbst wenn es mir gelungen wäre, die Scheibe zu zertrümmern, was dann? Von hier oben aus geht es gut zwanzig Meter nach unten. Was wollte ich tun? In den Fluss springen? Ertrinken?
»Wie geht es dir?«