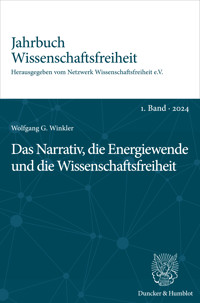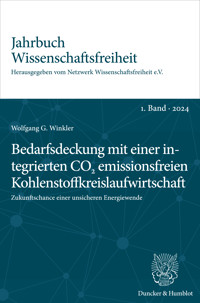
Bedarfsdeckung mit einer integrierten CO2 emissionsfreien Kohlenstoffkreislaufwirtschaft. E-Book
Wolfgang G. Winkler
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Duncker & Humblot
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Die Stromerzeugung allein aus Wind und Sonne mit dem „Speicher“ elektrisches Netz, hat sich als dysfunktional erwiesen, weil physikalisch unsinnig, Die Lücke mit Wasserstoffspeicherung schließen zu wollen, wird ebenfalls scheitern. Die vorhandenen Speicher können mit Wasserstoff weniger als nur ein Viertel der Energie speichern, die heute mit Erdgas gespeichert wird. Es ist an der Zeit dieses Programm neu aufzusetzen, indem eine solare Stromerzeugung, die zur Deckung des heutigen Primärenergiebedarfs etwa nur eine Drittel der versiegelten Fläche zur Aufstellung benötigt, mit einer Kohlenstoffkreislaufwirtschaft verbunden wird. Damit lassen sich in den vorhandenen Erdgasspeichern mehr als das Vierfache der heutigen Energiemenge speichern. Im Ergebnis sind so keine teuren Energiesparmaßnahmen, die nicht unmittelbar wirtschaftlich sind, erforderlich, weil keine CO2 Emissionen auftreten können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
[261]
Jahrbuch Wissenschaftsfreiheit, 1 (2024): 261 – 296https://doi.org/10.3790/jwf.2024.1432001
Bedarfsdeckung mit einer integrierten CO2 emissionsfreien Kohlenstoffkreislaufwirtschaft
Zukunftschance einer unsicheren Energiewende
Von Wolfgang G. Winkler*
I. Einführung
Die Konzeption der auf den Pariser Verträgen basierenden angestrebten Energiewende erfüllt kaum die Anforderungen einer möglichst ganzheitlichen Betrachtung, die eine nachhaltige Industriegesellschaft erfordert, sondern konzentrieren sich allein auf die Verminderung der CO2 Emissionen. Es erweckt den Eindruck, dass der Anstieg des Kurses der CO2 Zertifikate und nicht eine nachhaltige Gesellschaft die Zielfunktion des Handelns darstellt. Die eigentliche Aufgabe sollte aber sein, ein effizientes, umsetzbares, resilientes und nachhaltiges System der zukünftigen Energieversorgung vorzustellen, was bislang nicht erfolgt ist. Subsumiert unter dem zunächst vernünftigen scheinendem Begriff „Technologieoffenheit“ ist im Laufe der Zeit zwar ein Sammelsurium verschiedener, teilweise durchaus sinnvoller Einzellösungen entstanden, ohne dass klar wird, wie daraus ein funktionierendes Gesamtsystem entstehen soll. Dabei sind aber auch unterschiedliche wirtschaftliche Interessen von beteiligten Industriepartnern und Investoren entstanden, was in Verbindung mit politischen Partikularinteressen die notwendigen Entscheidungen nicht leichter macht. Wieweit die deutsche Energiewende weltweit von anderen Staaten als Vorbild gesehen wird, soll hier nicht weiter diskutiert werden. Im Hinblick auf dieses zu erreichende Ziel erscheint es notwendig, Lösungen für ein funktionsfähiges erneuerbares Energiesystem vorzustellen, die in einer Kreislaufwirtschaft mittels Closed Carbon Cycles (CCC) gleichzeitig eine nachhaltige Rohstoffversorgung ermöglichen.
Geschlossene Kreisläufe ermöglichen es dabei, die Vorteile von Kohlenwasserstoffen als Energieträger und als Industrierohstoff zu nutzen, ohne wie in der Natur CO2 an die Atmosphäre abzugeben. Die Ergebnisse der eigenen Studie zur Energiewende (1) und die bisherigen Aktionen der Politik fließen [262] dabei ein. Dazu müssen nachfolgende Aspekte betrachtet und dann zur notwendigen Systemlösung zusammengefasst werden:
–der Bewertung des gegenwärtigen Versorgungskonzepts,
–der Abschätzung des zukünftigen Primärenergiebedarfs einschließlich der Rohstoffversorgung,
–der Ermittlung der erforderlichen Leistungsgrößen von Solar und Windanlagen,
–des Grundflächenbedarfs dieser Anlagen,
–der Analyse der Versorgungssicherheit,
–der Ermittlung des Speicherbedarfs,
–der Ermittlung geeigneter Speichersubstanzen in einer Kreislaufwirtschaft, sowie
–der Vorstellung eines daraus resultierenden Konzepts, sowie
–eine Abschätzung der Wirtschaftlichkeit.
II. Erneuerbare Einspeisung und Netzbetrieb
Die grundsätzlichen Betrachtungen zu einer Wasserstoffwirtschaft (2) zur Lösung eines zukünftigen Energiemangels sind von einer solaren Primärenergie ausgegangen, womit zwangsläufig die Speicherung großer Energiemengen verbunden waren. Demgegenüber wurde in (3) davon ausgegangen, dass ein weiträumig ausgebautes elektrisches Netz mit entsprechend weiträumiger Verteilung von Windeinspeisung für eine sichere Versorgung ausreiche und nur geringe Backupleistung benötige. Aus letzterem entwickelte sich die These, dass sich die Einspeisung von Wind- und Solarenergie im Mittel gut ergänzen und allenfalls zweiwöchige Dunkelflauten zu erwarten seien und somit das Speicherproblem nachrangig sei. Das Bild 1 erläutert diese Philosophie. Auf dessen linker Seite ist der Verlauf der regenerativen Einspeisung (Solar und Windenergie) im Jahresverlauf und auf der rechten Seite der Strombedarf ebenfalls im Jahresverlauf eingetragen (1), (6).
Es bestätigt sich dabei auf der linken Seite des Bildes die These, dass die Mittelwerte der mit dem Jahresbedarf normierten Einspeisungen (basierend auf Werten von 2011 bis 2019) von Solar und Windenergie sich tatsächlich gut ergänzen. Die ebenfalls eingetragen Hüllkurven der maximalen und minimalen Werte zeigen aber erhebliche Abweichungen in den möglichen tatsächlichen Einspeisungen, insbesondere beim Wind. Damit scheinen die „grünen“ Narrative für die tatsächliche Praxis der Energieversorgung wenig relevant. Tatsächlich ist „Flatterstrom“ das Narrativ der Kritiker zweifelsfrei nicht für eine stabile Stromversorgung geeignet. Andererseits ist thermodynamisch [263] gesehen elektrische Energie gleichwertig einer reversiblen Arbeit also der hochwertigsten Energieform. Der einzig notwendige Schritt zur weiteren Nutzung ist daher deren Umwandlung in thermodynamisches Potential, hier in gasförmigen Kohlenwasserstoff. Erst wenn dieses thermodynamische Potential als Puffer in ausreichendem Umfang zur Stabilisierung des Netzes verfügbar ist, ist überhaupt eine Nutzung einer fluktuierenden regenerativen Einspeisung denkbar.
Bild 1: Das „grüne“ politische Narrativ und technologische Notwendigkeiten
Das entscheidende gegenwärtige Problem liegt nicht an der regenerativen oder erneuerbaren Energie oder an der vorhandenen Versorgungsinfrastruktur, sondern an der Emotionalisierung eines technischen Problems. Dies führt zu dem prinzipiellen ideologischen Denkfehler, eine „böse“ Energie (alles Vorhandene) abzureißen und durch eine neue „gute“ Energie (alles Ökologische) ersetzen zu müssen, ohne sich in notwendige Details zu vertiefen. Den politischen Persönlichkeiten der 1980er Jahre war die Bedeutung und Notwendigkeit der Beherrschung der thermodynamisch-naturwissenschaftlichen Grundlagen klar und die deutsche Politik, nahm diese in ihren Berichten wahr. Wie dies etwa die Bezugnahme auf den Zusammenhang zwischen Nachhaltigkeit und Entropie durchaus Beachtung fand (4), (5). Diese Erkenntnisse hätten der heutigen Politik vermutlich manche Irrwege erspart, die zwar dringend korrigiert werden müssen, aber kaum wahrgenommen werden (6), (7).
[264]
Bild 2: Vergleich der Potentialbereitstellung und der Sicherstellung des Leistungsbedarfs des elektrischen Netzes bei konventioneller und erneuerbarer Stromversorgung