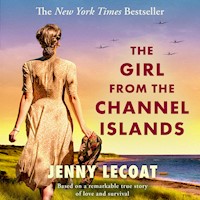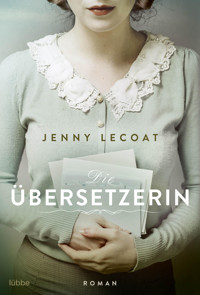19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Jersey 1945. Die junge Jean Parris lässt sich vom Freudentaumel mitreißen, der die Bewohner ihrer Insel nach dem Sieg der Alliierten ergriffen hat. Nun hofft sie endlich Nachricht von ihrem Vater zu erhalten, der während der Besatzungszeit von den Nazis verhaftet wurde. Doch die Botschaft seines Todes bringt traurige Gewissheit. Als kurz darauf Jeans Onkel aus dem englischen Exil zurückkehrt, verrennt sich dieser in einen Rachefeldzug gegen die vermeintliche Verräterin seines Bruders - die Lehrerin Hazel, deren politisches Engagement vielen ein Dorn im Auge ist. Ihre Schuld scheint festzustehen - nur: Ausgerechnet Hazel kennt ein Geheimnis, das Jean um jeden Preis schützen muss ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 427
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber dieses BuchÜber die AutorinTitelImpressumWidmungZuvor123456789101112SpäterAnmerkung der AutorinDanksagungÜber dieses Buch
Jersey 1945. Die junge Jean Parris lässt sich vom Freudentaumel mitreißen, der die Bewohner ihrer Insel nach dem Sieg der Alliierten ergriffen hat. Nun hofft sie endlich Nachricht von ihrem Vater zu erhalten, der während der Besatzungszeit von den Nazis verhaftet wurde. Doch die Botschaft seines Todes bringt traurige Gewissheit. Als kurz darauf Jeans Onkel aus dem englischen Exil zurückkehrt, verrennt sich dieser in einen Rachefeldzug gegen die vermeintliche Verräterin seines Bruders – die Lehrerin Hazel, deren politisches Engagement vielen ein Dorn im Auge ist. Ihre Schuld scheint festzustehen – nur: Ausgerechnet Hazel kennt ein Geheimnis, das Jean um jeden Preis schützen muss …
Über die Autorin
Jenny Lecoat kam in Jersey zur Welt, nur fünfzehn Jahre nach der Besatzung der Channel Islands durch die Nazis. Im Anschluss an ihr Schauspielstudium an der Universität von Birmingham zog sie nach London und arbeitete als Stand-up-Comedian, Moderatorin und Zeitschriften-Kolumnistin, bevor sie 1994 vollberuflich Fernsehautorin wurde. Ihre Tätigkeit erstreckte sich auf eine große Bandbreite an Serien, einschließlich Sitcoms, Kinderprogrammen und Dramen, bis sie ihr wachsendes Interesse an dokumentarischem und biografischem Material dazu inspirierten, zu ihren insularen Wurzeln zurückzukehren. Ihr Spielfilm Another Mother’s Son, der vom Engagement ihrer Familie im Widerstand in den Kriegsjahren erzählt, kam 2017 in die Kinos.
Hedy’s War ist ihr erster Roman.
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Titel der englischen Originalausgabe:
»Beyond Summerland«
Für die Originalausgabe:Copyright © 2024 by Jenny Lecoat
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2024 byBastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6–20, 51063 Köln
Vervielfältigungen dieses Werkes für dasText- und Data-Mining bleiben vorbehalten.
Textredaktion: Evi Draxl
Umschlaggestaltung: Kirstin Osenau
Einband-/Umschlagmotiv: © Shelley Richmond/Trevillion Images
eBook-Produktion: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7517-5595-5
luebbe.de
lesejury.de
Für Val Lecoat, 1937–2014,der die Besatzung die Kindheit genommen hat.
Für alles, was sie verpasst hat.
Zuvor
Die Erschütterung, nicht das Geräusch weckte sie auf – das heftige Rütteln der Haustür unter wiederholten Schlägen mit der Faust, die das Balkenwerk des Hauses bis in die Beine ihres Bettgestells hinein erbeben ließen. Dann erst hörte sie die lauten Rufe von draußen.
»Öffnen Sie die Tür! Sofort!«
Für eine Sekunde glaubte sie, das alles sei ein böser Traum, der sie unsanft dem Schlaf entrissen hatte. Dann hörte sie, wie ihre Mutter die Treppe hinunterhastete, gefolgt vom Ratschen des Metallriegels, der sich ihren verzweifelten, zitternden Fingern widersetzte.
Allein saß sie in ihrem Zimmer im Bett. Vor Entsetzen, so schutzlos ausgeliefert zu sein, pochte ihr das Herz bis zum Hals, und sie wagte sich nicht unter der trügerischen Sicherheit ihrer Bettdecke hervor. Kaum knallte die Haustür gegen die Dielenwand, brach ein Höllenlärm aus: die Schreie der Soldaten, die in den Flur stürmten, ihre Stiefelabsätze auf dem Dielenboden, der erst am Vortag so liebevoll gewischt worden war, der gequälte Schrei ihrer Mutter, als sie zur Seite gestoßen wurde. Dann kamen sie die Treppe heraufgestürmt, einer nach dem anderen, eine Befehlskette in Bewegung, lautes Gebell, wie bei einer Kesseljagd.
Als sie den Mut und die Kraft fand, das Zimmer zu durchqueren und die Tür zu öffnen, hatten sie ihre Beute bereits. Sein Pyjama war vom Schlafen zerknittert, sie sah seinen morgendlichen Bartschatten an Wangen und Kinn, und nur sein leichtes Stolpern auf dem Treppenabsatz lenkte ihren Blick auf die Handschellen in seinem Rücken. Sie hörte ihren eigenen schrillen Schrei: »Dad! Dad!«
Er leistete keinen Widerstand, als sie ihn die Treppe hinunterstießen, er fragte nur einmal, warum er verhaftet werde, während die ganze Zeit ein tiefer, kehliger Schmerzenslaut ihrer Mutter durch die Räume hallte wie der eines verwundeten Tiers.
Starr vor Entsetzen beobachtete sie durch das Treppengeländer, wie sie ihm unten die Handschellen abnahmen, gerade lange genug, damit er sich Schuhe und Mantel überziehen konnte, bevor sie ihn aus dem Haus und in die schwarze Maria bugsierten. Sie sah, wie ihre Mutter auf die Fersen niedersank, sodass sich das Nachthemd seltsam um ihre Knie spannte, wie sie das Gesicht in die Hände legte und schluchzte. Und dann brach noch jemand anders in Heulen und Wehklagen aus, und sie brauchte einen Moment, bis sie begriff, dass sie selbst es war.
1
Jersey, Kanalinseln
Juni 1945
Die Freude wogte durch die Straße von einem Ende bis zum anderen. Sie strömte aus jedem Haus und knisterte in der Luft, kribbelte unter der Haut und lockte jeden vor die Tür an diesem aufregenden, historischen Morgen. Und was für ein prächtiger Morgen das war! Der gestrige Sturm hatte sich über dem Ärmelkanal nach Norden verzogen und nichts als strahlenden Sonnenschein an einem hellblauen Himmel zurückgelassen. Nun hielt ganz St. Helier in ungeduldiger Erwartung den Atem an. Ein steifer Südwestwind trug das ferne Gemurmel einer schnatternden Menschenmenge durch die Straßen, und als Jean auf ihrem Kiesweg stand, um alles in sich aufzusaugen, spürte sie einen Anflug aufrichtiger Zuversicht. Sie strich sich das hellbraune Haar zurecht, zupfte an ihrer Jacke, um sicherzugehen, dass sie das Mottenloch in der Bluse verdeckte, und rief über die Schulter ins Haus:
»Mum! Beeil dich, sonst landen wir ganz hinten.«
Mit der alten Lederhandtasche über dem Arm trat Violet Parris aus dem Haus. Gewohnheitsgemäß drehte sie sich noch einmal um und verriegelte die Tür. Da Diebstähle immer noch an der Tagesordnung waren, hatte sie die Vorsichtsmaßnahme beibehalten, auch wenn alle die Zeit der offenen Haustüren vermissten. »Bis Weihnachten renkt sich das alles wieder ein«, redeten sich die Leute gut zu. Und vielleicht würden sie ja recht behalten. Jean betrachtete das bleiche Gesicht ihrer Mutter unter dem abgenutzten Filzhut. Draußen, bei Tageslicht, sah sie noch zarter und hinfälliger aus, mit ihrem ängstlichen nervösen Blick und dem von der schweren Bürde ein wenig gekrümmten Rücken. Die meisten hätten sie wohl auf Mitte bis Ende vierzig geschätzt, aber schließlich waren alle hier auf der Insel in den letzten fünf Jahren um eine ganze Lebenszeit gealtert. Sie verspürte den spontanen Drang, ihre Mutter fest zu umarmen, doch da sie genau wusste, dass die sich dagegen sträuben würde, bot sie ihr stattdessen den Arm an.
Sie gingen in einem Tempo los, das ihre Mutter die halbe Meile wohl durchhalten würde. Überall knarzten Gartentörchen, scheuchten Frauen ihre Männer und Kinder auf den Bürgersteig, wurden Krawattenknoten zurechtgerückt und lose Haarsträhnen festgesteckt, bevor alle in Richtung Stadtzentrum strömten. Einige hatten aufgerollte Union Jacks dabei, um sie im entscheidenden Moment zu entrollen, und Jean verspürte einen Anflug von Neid; ihre eigene Fahne hatte im Winter zum Feueranzünden herhalten müssen, und jetzt gab es keinen Ersatz zu kaufen. Abgesehen davon war es nicht ratsam, sich dem Vorwurf der Verschwendungssucht auszusetzen. Jersey war eine kleine Insel. Die Leute redeten schnell.
Am Ende der Bath Street drängten sich bereits die Menschen auf dem Weg zum Royal Square. An der Ecke der Markthalle am Halkett Place vereinten sich zwei Menschenströme zu einem breiten, der sie beide wie Papierbötchen mit sich riss, und Jean wünschte sich wieder, sie wären früher losgegangen. Als eine Frau hinter ihr ins Stolpern geriet und sie beide nach vorne stieß, spürte sie, wie sich die Finger ihrer Mutter an ihrem Arm festkrallten; schnell zerrte Jean sie aus dem Gewühl heraus in eine ruhigere Seitenstraße, wo sich ihre Mutter an eine Hauswand lehnte und sich mit Jeans Taschentuch den Schweiß von der Stirn wischte.
»Alles in Ordnung?«
Violet schüttelte den Kopf. »So viele Leute. Wieso sind wir nicht zum Albert Pier gegangen, um die SS Jamaica einlaufen zu sehen, oder haben uns einen Platz an der Esplanade gesucht?«
Jean, die gestern Abend genau diese Möglichkeiten vorgeschlagen hatte, nahm nur das feuchte Taschentuch zurück und steckte es sich in den Ärmel. Dabei fiel ihr Blick auf die nächste Ladenfront, eine kleine Bäckerei auf halber Strecke der Abzweigung. Das Schaufenster war als Ersatz für die zerbrochene Scheibe mit Brettern vernagelt, aber offensichtlich waren die Vandalen ein zweites Mal gekommen, denn jetzt prangte ein riesiges Hakenkreuz in schwarzer Farbe auf dem Sperrholz. Auch ihre Mutter, stellte Jean fest, starrte wie gebannt darauf.
Violet hob das Kinn. »Kollaborateure.« Jean nickte. Was mochten die Besitzer getan haben, um sich einen solchen Ruf zu verdienen? Hatten sie deutsche Soldaten mit Brot versorgt? Sich mit ihnen verbrüdert? Sie stellte sich die wütenden Gesichter der Männer vor, die mitten in der Nacht mit Ziegel- und Pflastersteinen in der Hand den Laden stürmten. Was war in so wenigen Wochen nur aus dieser Insel geworden?
Der Tag der Befreiung vor weniger als einem Monat war das bedeutendste und emotionalste Ereignis gewesen, das die Inselbewohner, ob jung oder alt, je erlebt hatten. Der heiß ersehnte Tag war endlich gekommen, und mit der Ankunft eines britischen Einsatzkommandos im Hafen und der offiziellen Kapitulation des deutschen Militärs hatten fünf brutale Jahre der Nazi-Besatzung geendet. Die Besatzungszeit war so lang und beschwerlich gewesen – zu Beginn war Jean gerade einmal vierzehn Jahre alt –, dass sie in den ersten ein oder zwei Wochen nach der Befreiung ihr Glück kaum fassen konnten. Einfach so das Haus ohne Ausgangssperre zu verlassen, auf der Straße offen zu sprechen, ohne Angst vor Spionen die BBC-Nachrichten im Radio des Nachbarn zu hören! Aber das Beste von allem war die überwältigende Freude, endlich wieder eine richtige Mahlzeit essen zu können, nachdem die britische Armee damit begonnen hatte, kistenweise Nahrungsmittel an Land zu schaffen, und die Vega, ein Schiff des Roten Kreuzes, weitere Hilfspakete brachte. Nachdem sie im letzten Jahr kurz vor dem Verhungern gewesen waren, rührten Köstlichkeiten wie Konservenfleisch, Schmalz, Zucker und Tee Jean und Violet zu Tränen. Der fruchtige Geschmack der Himbeermarmelade, die sie in einem Moment des Hochgefühls direkt aus dem Glas löffelte, sollte Jean für immer in Erinnerung bleiben.
Doch diese ersten Tage hatten auch für jede Menge Unruhe gesorgt. Nach Jahren der Lähmung, in denen ganze Monate von nichts anderem als dem mühsamen Kampf um Lebensmittel und Treibstoff geprägt waren, brachte die Befreiung einen Wirbel an willkommenen, aber anstrengenden Entwicklungen mit sich. Die beiden Frauen hatten pflichtbewusst ihre Reichsmark bei der örtlichen Bank in Pfund Sterling umgetauscht, sie hatten mit Befriedigung zugesehen, wie die Minen an den Stränden geräumt wurden, sie hatten aus den öffentlichen Bekanntmachungen erfahren, dass die von den Deutschen im Herbst 1942 deportierten Inselbewohner nach England zurückgeflogen worden waren und dass ihre Rückkehr nun unmittelbar bevorstand. Endlich hatten sie einen Brief von Jeans älterem Bruder Harry erhalten, der aus dem Militärdienst entlassen worden war und nun mit seiner eigenen Familie in Chelmsford lebte. Über die um Jahre verspätete Nachricht von der Verhaftung seines Vaters entsetzt, schrieb Harry von seiner Verbitterung darüber, so lange von jeglicher Information über die Insel abgeschnitten gewesen zu sein, versprach jedoch zu Jeans großer Freude, sie zu besuchen, sobald die regulären Transportmittel ihren Dienst wieder aufgenommen hätten.
Von dem Gefühl ermutigt, endlich zur Normalität zurückzukehren, saßen sie und ihre Mutter eines Abends am Küchentisch, schnitten sämtliche wichtigen Artikel aus der Evening Post aus und klebten sie in ein Sammelalbum für die Nachwelt. Dabei wagte Jean im Flüsterton, damit eine launische Schicksalsmacht es nicht hören konnte, sich die kommenden Wochen auszumalen und auf Nachrichten vom Kontinent zu hoffen, die vielleicht bereits in diesem Moment auf dem Weg zu ihnen waren. Violet nickte und lächelte, antwortete aber selten. Hoffnung, vermutete Jean, war eine zu schwere Last für die erschöpfte Frau am Ende einer entsetzlichen Reise; Jean tat klug daran, die Lippen zu verschließen und ihre eigenen Wunschträume in die rhythmischen Bewegungen ihres Kleisterpinsels einfließen zu lassen.
Nicht alle Nachrichten waren gut. Zwischen den Schlagzeilen zur Feier des Tages und den behördlichen Ankündigungen gab es auch andere, beunruhigende Meldungen. Schreckliche Fotos von mörderischen Nazilagern, in denen unzählige Menschen umgekommen waren. Berichte über einheimische »Jerrybags« – Inselbewohnerinnen, die mit deutschen Soldaten geschlafen hatten. Immer wieder hetzten marodierende Banden die Frauen durch die Straßen, rasierten ihnen die Köpfe und rissen ihnen die Kleidung runter. Dazu kamen Artikel über die hoffnungslose Verschuldung der Insel. Und ein erschreckender Bericht auf der Titelseite über einen Vater und dessen Sohn, die anderthalb Jahre zuvor deportiert worden und in Gefangenschaft ums Leben gekommen waren. Nach dieser Lektüre zog sich Jean ins Bett zurück und lag stundenlang in düsterer Panik wach, bevor sie gegen Morgen in einen unruhigen Schlaf fiel. Sie erzählte niemandem davon, schon gar nicht ihrer Mutter.
Jean konnte nicht mehr genau sagen, wann sie die mütterliche Rolle in ihrer Beziehung übernommen hatte – vermutlich über Monate hinweg in einem schleichenden Prozess. Doch inzwischen wusste sie genau, wann die zitternden Finger ihrer Mutter anzeigten, dass Jean das Gemüse für das Abendessen schälen musste, oder dass Violets stille Tränen auf der aufgeschlagenen Seite eines Buchs in der Abendstille ein wärmendes Getränk und frühe Nachtruhe erforderlich machten. Für ihre eigenen Gefühle würde immer noch Zeit sein, wenn dieser Albtraum zu Ende wäre, sagte Jean sich immer wieder.
So zwang sich Jean auch an diesem Freudentag zu einem tröstenden Lächeln, trotz der beklemmenden Gefühle, die der Anblick der verrammelten Bäckerei in ihr heraufbeschwor. Jean legte ihrer Mutter eine Hand auf den Arm.
»Wir können auch wieder heimgehen, wenn du willst.« Bei dem Gedanken an die stille graue Küche im hinteren Teil des stillen grauen Hauses fürchtete sich Jean davor, dass ihre Mutter nicken könnte. Doch Violet runzelte nur ein wenig die Stirn.
»Nein, wir sind bis hierher gekommen, da schaffen wir auch den Rest.«
Auf dem Royal Square wimmelte es erwartungsgemäß von Menschen. Die Mitte des Platzes war abgesperrt. Jean zerrte ihre Mutter durch das Gewühl und wies Violet an, sich hinten an ihrer Jacke festzuhalten und nicht loszulassen, während sie sich einen Weg bahnte und jede noch so kleine Lücke ausnutzte. Jeden Mann, der sich ihr in den Weg stellte, lächelte sie so lange hilflos an, bis er beiseite ging, immer wieder warf sie entschuldigende Blicke zurück, wenn sie Leuten auf die Füße trat. Die beiden Frauen waren nur noch wenige Schritte von der Absperrung entfernt, als der Wagenkonvoi einfuhr. Ein Jubelschrei ging durch die Menge, und Jean stellte sich auf die Zehenspitzen und reckte den Kopf, sodass sie einen Blick auf das Geschehen bekam.
Die Karossen reihten sich vor der Bibliothek auf. Ein junger, uniformierter Tommy öffnete den Schlag eines glänzenden schwarzen Ford. Und plötzlich waren sie da. Direkt auf dem Bürgersteig vor den Regierungsgebäuden der States of Jersey, keine dreißig Meter von ihr entfernt, stiegen der König und die Königin aus, nachdem sie den weiten Weg vom Buckingham-Palast hierhergekommen waren. Jean betrachtete König George, der bei der ehrerbietigen Begrüßung durch Staatsbeamte in seiner Uniform einfach prächtig aussah. Die Königin, mit wunderschönem Federhut und in einen eleganten Fuchspelz gehüllt, nahm einen großen Strauß Nelken entgegen. Der Jubel auf dem Platz war groß, und hier und da erklangen patriotische Lieder. Jean schaute ihre Mutter an und sah in deren Miene die eigene Begeisterung gespiegelt. In diesem Moment wischte sich eine Frau neben ihnen offenbar überwältigt mit dem Handrücken über die Augen und strahlte Violet an.
»Ist das nicht wunderbar? Ich kann es immer noch nicht fassen!«
Jean spürte, wie sich der Körper ihrer Mutter versteifte, während sie sich eine passende Floskel zurechtlegte. »Ja, wirklich wunderbar.«
»Es ist vorbei, endlich vorbei! Wir können wieder anfangen zu leben!«
Jean registrierte, wie sich Kummer und Sorge in Violets Gesichtszügen abzeichneten. Als ihre Lippen zu zittern begannen, wusste Jean, dass es nun Zeit wurde – Tränen in aller Öffentlichkeit, eine solche Demütigung würde Violet nicht geschehen lassen. Mit einem letzten widerstrebenden Blick auf das freundlich winkende Königspaar legte Jean ihrer Mutter den Arm um die Taille und drängte sich durch die Menge, bis sie beide atemlos wieder auf der Hauptstraße angelangt waren. In einem Ladeneingang, der sie vor den Passanten schützte, bot Jean Violet ihr Taschentuch an, und Violet begann laut zu schluchzen. Schließlich ließ das Zittern nach, und sie holte tief Luft.
»Entschuldige bitte. Es war nur das, was diese Frau gesagt hat.«
Jean fuhr sich durch die Haare. »Ich weiß. Aber es kann nicht mehr lange dauern. Nach allem, was wir wissen, könnte Dad jetzt schon auf dem Heimweg sein.«
Violet nickte und brachte ein kleines Lächeln zustande. Jean bemühte sich tapfer, ihre Enttäuschung darüber zu verbergen, dass sie nun das einmalige Spektakel verpassen würde, aber sie bot Violet ihren Arm an, und die beiden Frauen machten sich auf den Heimweg. Jean schwirrte der Kopf. War es gerechtfertigt, so optimistisch zu sein? Niemand konnte sagen, ob sich ihr Vater tatsächlich auf dem Heimweg befand. Immerhin war es jetzt fünfzehn Monate her, dass er auf das deutsche Gefangenenschiff gekommen war, Gott weiß wohin. Sein letzter Brief war vor einem Jahr gekommen. Und kein Wort von den Behörden. Sie sagte sich, dass ihnen gar nichts anderes übrigblieb, als zu hoffen, nur eins stand fest – für Jean und ihre Mutter waren die Nachwehen der Besatzung noch nicht vorbei.
G
»Philip Arthur Parris, richtig? Geboren am siebten März 1898, wohnhaft in der St. Mark’s Road zum Zeitpunkt seiner Verhaftung?«
Jean stupste ihre Mutter an, damit sie antwortete. »Das ist richtig.«
»Und sein Geschäft?«
»Parris’ Eisenwarenhandlung, in der New Street. Es ist seither geschlossen.«
»Nun, Mrs. Parris, ich fürchte, das sind alle verfügbaren Unterlagen …« Der Constable kratzte sich am Kopf. Jean sah ihm zu, wie er gleichgültig in seinem dünnen Stoß Papiere blätterte. Schließlich rückte er seine Brille zurecht, räusperte sich und sah ihrer Mutter in die Augen. »In der Tat scheint es keine Dokumente über Mr. Parris zu geben, seit er im Juli 1944 aus dem Gefängnis in Preungesheim verlegt wurde.«
»Das muss kurz nach dem letzten Brief gewesen sein, den wir erhalten haben.«
Jean bemerkte, dass ihre Mutter sich bemühte, die breiteren Vokale ihres Jersey-Akzents zu überspielen. Im Büro des Constables mit seinen auf Hochglanz polierten, holzgetäfelten Wänden und den alten, handgezeichneten Karten von Jersey in schweren Rahmen und unter Glas fühlten sie beide sich fremd. Erst recht vor diesem Respekt einflößenden Amtsträger, der in seinem Terminkalender extra Platz geschaffen hatte, um persönlich mit ihnen zu sprechen.
Violet fuhr fort: »Er sollte nur fünfzehn Monate absitzen, müsste demnach inzwischen frei sein. Wir hatten überlegt, dass er vielleicht schon entlassen worden ist, aber nicht über die nötigen Reisedokumente verfügt. Könnte das sein?«
Doch der Constable blickte aus dem Fenster. Von draußen waren laute Rufe und Gesänge zu hören. Mit einem Seufzer stand er auf und schloss das Fenster.
»Entschuldigen Sie … die Demonstration …«
Jean nickte. »Ich weiß, wir sind auf dem Weg hierher an ihnen vorbeigekommen.« Der Anblick so vieler Menschen, die sich nach fünf Jahren strikten Gehorsams zu einer Demonstration versammelt hatten, hatte sie regelrecht schockiert. Es mussten mehrere Hundert Leute sein, die einem Redner auf einem behelfsmäßigen Podium zuhörten, hinter dem ein mit der Aufschrift »Demokratische Bewegung Jersey« versehenes Banner hing. Der Mann sprach durch ein Megaphon über die Notwendigkeit sozialer Absicherung und eines sogenannten abgestuften Steuersystems. Jean erinnerte sich daran, wie ihr Vater ein paar Jahre zuvor über diese Bewegung gesprochen und sie wütend als einen Haufen Kommunisten beschimpft hatte, die nur Ärger machen wollten. Aus Loyalität zu ihm hatte Jean mit den Augen gerollt, als sie an den Demonstranten vorbeigegangen waren. Hatten nach dem Krieg nicht alle erst einmal genug von der Politik?
Der Constable kehrte an seinen Platz zurück und nahm einen Stift zur Hand.
»Ihr Mann wurde wegen verbotenen Besitzes eines Radios angeklagt?«
»Ja.«
»Und das wurde in seinem Geschäft gefunden?«
»Das ist richtig. Er dachte, es wäre dort sicherer als zu Hause. Er ließ die Leute im Hinterzimmer die Nachrichten hören – seine Kundschaft, manchmal auch Nachbarn.«
»Und der Prozess fand am 8. Februar letzten Jahres statt?«
Violet schnaubte verächtlich. »Wenn man das einen Prozess nennen kann! Es gab nicht einmal einen richtigen Übersetzer, wir wurden völlig im Dunkeln gelassen. Es war von vornherein klar, dass er ins Gefängnis kommen würde. Nicht wahr, Jean?« Violets Stimme zitterte vor Schmerz und Entrüstung.
Jean griff nach der Hand ihrer Mutter, während sie sich mit der Linken unbewusst an den Hals fasste und nach dem kleinen goldenen Medaillon tastete, das ihr Vater ihr zum zwölften Geburtstag geschenkt hatte. Bei der Berührung erinnerte sie sich an die Freude in seinen Augen, als er ihr beim Öffnen des Kästchens zusah, und an das strahlende Lächeln ihrer Mutter, als er Jean das Medaillon um den Hals hängte und ungeschickt versuchte, den Verschluss zuzubekommen. Dieser Moment hatte sich ihr ins Gedächtnis eingegraben als Inbegriff einer glücklichen, liebevoll umhegten Kindheit, und in den letzten Monaten war ihr das Medaillon zu einem Talisman geworden, der sie mit ihrem Vater verband. Sie spürte das winzige Metallherz unter ihren Fingern und holte tief Luft.
»Was wir damit sagen wollen: Mein Vater ist kein Krimineller, er hat nichts Unrechtes getan.« Sie blickte dem Constable fest in die Augen. »Er ist ein guter Mensch, er hätte nie ins Gefängnis kommen dürfen, geschweige denn, in ein ausländisches Gefängnis. Wir wollen doch nur, dass er endlich zurückkommt …«
Der Constable faltete die Hände vor sich auf dem Tisch und sah die beiden Frauen mit ernster Miene an.
»Nach Besatzungsrecht hat Mr. Parris etwas Verbotenes getan. Unsere Regierung hat die Einwohner davor gewarnt, gegen die Gesetze zu verstoßen, ganz gleich, wie ungerecht einige davon gewesen sind.« Als er ihre erschrockenen Gesichter sah, räusperte er sich und fuhr dann fort. »Aber natürlich haben Sie unser größtes Mitgefühl, und seien Sie versichert, dass wir alles in unserer Macht Stehende tun werden, um Mr. Parris zu finden. Ich muss Sie jedoch vorwarnen, das kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Der D-Day hat die deutsche Verwaltung auf dem Kontinent ins Chaos gestürzt, viele Dokumente sind verlorengegangen.« Er blickte auf die Papiere auf seinem Schreibtisch und dachte einen Moment nach. »Das Rote Kreuz könnte sehr hilfreich bei unserer Suche sein, soll ich mich für Sie verwenden?«
Violet nickte energisch. Jean drückte ihre Hand noch fester.
»Wir wären Ihnen sehr dankbar.«
»Dann kümmere ich mich darum. Ich sehe mal, ob die derzeitige Abordnung des Innenministeriums jemanden dafür abstellen kann. In der Abteilung für innere Angelegenheiten arbeiten zurzeit einige Ermittlungsbeamte der Londoner Polizei, soviel ich weiß.« Er schenkte ihnen ein aufmunterndes Lächeln. Jean tat ihr Bestes, um es zu erwidern.
»Vielen Dank!«
»Seien Sie guter Hoffnung!« Der Constable war jetzt aufgestanden, das Zeichen, dass das Gespräch beendet war. »Wir bringen Ihnen Mr. Parris bald nach Hause.«
Wenige Augenblicke später standen Jean und ihre Mutter draußen auf dem Bürgersteig und blinzelten in das grelle Nachmittagslicht. Violet kramte in ihrer Handtasche und tat so, als ob sie etwas suchte.
»Glaubst du wirklich, er kann etwas für uns tun?«
»Aber natürlich!« Jean gab sich optimistisch. »Überleg doch mal, was das Rote Kreuz während des Krieges alles erreicht hat!«
Mit halbem Ohr hörte Jean auf die lärmende Menge. Von dort, wo sie standen, konnte sie nicht viel sehen, doch die Rufe des Mannes auf dem Podium wurden immer lauter, und sie war erleichtert, als ihre Mutter sich entschlossen in die andere Richtung wendete. Bald befanden sie sich in dem Straßenlabyrinth mit den kleinen Cottages aus dem neunzehnten Jahrhundert, das sie durch die Innenstadt zur St. Mark’s Road führte.
Als sie ihre Haustür erreicht hatten, drehte sich Violet zu ihrer Tochter um. »Glaubst du, er ist noch derselbe Mann?«
»Dad?« Jeans Herz schien einen Schlag auszusetzen. »Inwiefern?«
»Wir wissen nicht, was er durchgemacht hat. Denk an die Berichte über diesen armen Vater und seinen Sohn, an das, was sie den beiden angetan haben.«
Jeans dachte an ihren Vater – seine schlaksige Gestalt im Schneidersitz auf einem Gartenlehnstuhl, wie er mit lachendem Gesicht in die Sonne blinzelte. Sie dachte an sein Schmunzeln und an die Art, wie er sich an warmen Tagen eine Strähne aus der Stirn strich. Der Gedanke, er könnte sich verändert haben, war unerträglich. Sie wusste, dass es ihrer Mutter genauso erging.
»Dad ist in ein normales Gefängnis gekommen. Bestimmt geht es ihm gut.« Violet nickte, schloss auf und trat ins Haus.
Dann zauberte sie ihr erstes echtes Lächeln an diesem Tag hervor. »Wie auch immer, Anfang nächster Woche ist Eddie zurück. Der hat bestimmt ein paar Ideen, was wir noch tun können.«
Jean befiel eine düstere Ahnung. Onkel Eddie war der jüngere Bruder ihres Vaters. Eddie mit dem dicken Bauch, dem drahtigen Schnauzbart und seinem schallenden Gelächter. Eddie, wie sein Bruder schnell zum Streiten aufgelegt, ohne zu merken, wann es besser wäre, klein beizugeben. Onkel Eddie, der sie als Kind einmal angebrüllt hatte, weil sie versehentlich eine hässliche Porzellanvase in seinem Haus umgeworfen hatte. Seitdem er sich kurz vor der Ankunft der Deutschen abgesetzt hatte, hatte sie ihn nicht mehr gesehen, und bis zu dem Telegramm letzte Woche war sie sich ziemlich sicher gewesen, ihn nie wiederzusehen. Als sie den Hut ihrer Mutter an den Ständer in der Diele hängte, erinnerte sie sich, wie ihr Vater wutentbrannt die Haustür zugeschlagen hatte, als er die Entscheidung seines Bruders verkündete, die Insel zu verlassen. Es fielen verächtliche Worte wie »Schande« und »kein Rückgrat«, doch jetzt bekam Violet vor lauter Vorfreude feuchte Augen.
»Eddie kennt die ganze Geschichte, ich meine, was mit Dad passiert ist, oder?«
»Ich habe ihm alles geschrieben. Wenn einer weiß, was wir unternehmen können, dann er.«
Jean wandte sich ab, bevor Violet ihre Zweifel bemerkte. »Ganz bestimmt, Mum. Komm, ich mache jetzt Abendessen.«
G
»… und woher kommen all unsere Stadträte und Constables, die Männer, die in unseren Inselgemeinden so viel Macht haben? Aus reichen Familien, die keine Ahnung haben, wie der Rest von uns lebt! Was wir brauchen, sind ordentlich bezahlte Volksvertreter, die von uns gewählt werden.«
»Hört, hört!«, rief Hazel Le Tourneur mit lauter Stimme durch die Parade Gardens in Richtung Podium. Mehrere Männerköpfe drehten sich zu ihr um und sahen sie spöttisch an. Aber Hazel war das egal. Sollten sie doch glotzen! Sollten sie doch tuscheln und ihre Witze reißen. In ihrem Klassenzimmer war es noch schlimmer, und derlei Benehmen machte ihr nur zu bewusst, was für einen langen Weg die Insel noch vor sich hatte, um ihren Platz im neuen Nachkriegsjahrhundert einzunehmen. Sie beugte sich vor, um die nächsten Worte des Redners zu hören, die knisternd und verzerrt aus dem alten Megaphon drangen.
»Und warum«, rief der junge Mann jetzt, »stellen wir nicht unsere Alltagskämpfe – die Pflege gebrechlicher Eltern, die ärztliche Versorgung unserer Kinder, bezahlbare Mieten – ins Zentrum unserer Politik? Warum muss der ältere Arbeiter Angst vor dem Ruhestand haben, der jüngere vor Krankheit oder Verletzung? Diese Sorgen müssen wir den Menschen nehmen und eine Gesellschaft gestalten, in der alle, nicht nur die Reichen, vor den Härten des Lebens geschützt werden.« In der Hoffnung auf Beifall ließ der Redner sein Megaphon sinken und Hazel sich nicht zweimal bitten, kräftig zu applaudieren. Endlich! Nach Jahren, in denen sie selbst gegenüber Nachbarn jedes Wort auf die Waagschale gelegt hatte, weil sie befürchtete, von einem feindlichen Spitzel verpfiffen zu werden, fühlte sich diese öffentliche Zusammenkunft für Hazel nach so viel mehr an als nur einem Austausch von Ideen. Endlich gab es wieder Hoffnung. So klein und unbedeutend diese Veranstaltung auch sein mochte – Hazel hatte keinen ihrer Lehrerkollegen dazu überreden können mitzukommen und die Tür des Lehrerzimmers krachend hinter sich zugeschlagen, um ihrem Herzen Luft zu machen –, es fühlte sich dennoch an wie ein gewaltiger Sprung in den Fortschritt, von dem sie während der Besatzungsjahre nur hatte träumen können. Nach all den langen, kalten Nächten, zusammengekauert in ihrem behelfsmäßigen Bett neben dem ihres Vaters, ohne auch nur eine Kerze, hielt sie an diesem Tag das Gesicht in die Sonne, um die Wärme auf der Haut zu genießen. Die ihr von klein auf eingetrichterte Mahnung, dass Mädchen ihren Teint niemals der Junisonne aussetzen sollten, ignorierte sie bewusst. Doch die Ankündigung des nächsten Redners holte sie zurück in die Realität. Sie sah auf die Uhr. Halb fünf – Zeit, nach Hause zu gehen.
Als Hazel in der New Street ankam, schnitt ihr der Riemen der Büchertasche in die Schulter, und die Holzpantinen drückten auf die Blasen an ihren Füßen, die sie auf jeder der acht Steinstufen zum Wohnungseingang spürte. Von ihrem neuen Gehalt würde sie sich jetzt, wo die ersten Lieferungen eintrafen, ein Paar neue Schuhe kaufen. Während Hazel in ihrer Tasche nach dem Schlüssel kramte – ausnahmsweise hatte sich einmal einer der anderen Mieter die Mühe gemacht, die Gemeinschaftstür richtig abzuschließen –, blickte sie auf den geschlossenen Laden im Erdgeschoss, über dem der Schriftzug allmählich abblätterte und verblasste.
P. Parris, Eisenwarenhandlung. Sie dachte an den großen, schlanken Besitzer mit seiner schlecht kaschierten Glatze und fragte sich, wo er jetzt wohl war. Seit dem Befreiungstag waren mehrere schockierende Berichte über das Schicksal der Kriegsgefangenen erschienen, aber über Parris hatte sie nichts gelesen. Höchstwahrscheinlich hatte er für den Rest des Krieges in einer feuchten Gefängniszelle ausgeharrt und Bettlaken genäht, und hätte man sie nach ihrer ehrlichen Meinung gefragt, hätte sie gesagt, das geschah ihm recht.
Hazel erinnerte sich an den Tag, an dem die Soldaten in den Laden gestürmt waren und kurz darauf mit dem beschlagnahmten Radio rauskamen. Und an ihren zweiten Besuch nur wenige Tage später, als sie die kläglichen Lagerbestände plünderten und Schrauben, Stahlkübel und Mausefallen mitnahmen, während die Anwohner mit stummer, ohnmächtiger Wut diesen schamlosen Diebstahl mit ansehen mussten. Sie erinnerte sich, wie sie an ihrem Küchenfenster stand, von dem aus man den winzigen Hinterhof überblicken konnte, und hinter der Gardine hervor beobachtete, wie der jüngere Offizier, der das Kommando hatte, heimlich eine Zigarette rauchte und einen kleinen Meißel untersuchte, den er offensichtlich für seinen eigenen Gebrauch an sich genommen hatte. Hazel hatte sich schon damals gefragt, was ein Besatzungssoldat damit anfangen mochte. Aber so war das mit dem Faschismus – nimm, nimm, nimm, dann kannst du dir immer noch überlegen, wofür du es gebrauchen kannst. Philip Parris selbst hatte jedenfalls keine Verwendung dafür, zumindest nicht in absehbarer Zeit.
Erschöpft schleppte Hazel sich die knarzende Treppe hinauf und betrat die Wohnung. Ihr Vater saß vorgebeugt in seinem Stuhl am Kamin, versuchte, mit gekrümmten Fingern in seinem Tagebuch zu schreiben, und rief wie immer über die Schulter, als Hazel eintrat.
»Bist du das, Haze?«
»Ja, ich bin’s.« Wer sonst, dachte Hazel. Sie konnte sich nicht daran erinnern, wann das letzte Mal jemand anders über die Schwelle getreten war. Jedenfalls nicht mehr, seit diese seltsamen Cousins aus Trinity in der Woche von Dotties Beerdigung zu Besuch gekommen waren. Keiner der Nachbarn klopfte jemals an die Tür oder kam auf einen Plausch herein, obwohl in den Gemeinschaftsräumen alle immer sehr höflich waren. Nicht einmal der gutaussehende, ehrgeizige Gewerkschafter, mit dem Hazel im letzten Sommer für ein paar Wochen ausgegangen war, hatte diese ärmliche Wohnung betreten, andererseits hatte Hazel ihn auch davon abgehalten, so sehr schämte sie sich für den Geruch aus den Abflussrohren.
»Warst du bei dieser Kundgebung?«
»Ja, nur kurz. Gar nicht mal schlecht besucht.«
»Nimm dich in Acht. Das wird einige Leute hier verärgern.«
Hazel tätschelte ihrem Vater die kalte Hand. »Na ja, wenn sie keinen Ärger machen, dann tun sie auch nichts Gutes, oder?«
Ihre Bemerkung amüsierte ihn. »Wo du recht hast, da hast du recht, Liebes.«
Hazel stapelte einige Gedichtbände auf dem kleinen Tisch und zog die alten geblümten Vorhänge zurück, um Licht hereinzulassen. Ohne zu fragen, kurbelte sie das Grammophon an, ihren wertvollsten Besitz, und legte die Plattennadel auf. Die sanften Stimmen der Ink Spots schwebten durch den Raum. Hazel wartete, bis die Melodie ihren Vater sanft an die Rückenlehne seines Stuhls sinken ließ und er mit einem zufriedenen Gesicht die Augen schloss. Dann nahm sie die rotbraune Flasche aus dem Regal.
Zeit für seine Medizin.
Er schnaubte verächtlich. »Das Zeug nützt nichts.«
»Der Arzt hat mir gesagt, dass sie in Schweden ein neues Mittel gegen Arthritis entdeckt haben. Vielleicht können wir dir das jetzt, wo der Krieg vorbei ist, besorgen?« Auch wenn sie ihm den Löffel mit gutem Zureden anbot, sagte ihr seine Miene, dass es wieder ein Kampf sein würde, bis er die Flüssigkeit schluckte. Nur eine Nacht, dachte sie, nur eine Nacht, in der alles mal einfach wäre … und dann fiel ihr ein, dass sie längst vergessen hatte, was sie in einer solchen Nacht überhaupt machen würde. Mit einem Seufzer zog sie den Stöpsel aus der Flasche, während die Ink Spots weiter säuselten.
G
Als das Schiff in den Hafen einlief, drängten sich die Menschen voller Vorfreude am Albert Pier. Jean beobachtete, wie dicke Taue hinübergeworfen wurden, und lauschte den Rufen der Seeleute, die das Brummen der Motoren und das Klirren der Eisenkrähne übertönten. Der hoch aufragende rote Schornstein des Schiffs hob sich leuchtend vor dem blassblauen Himmel ab, und die Möwen kreischten vor Lust nach Fisch. Jean zurrte ihre Jacke fester um den Leib und schloss die Augen, um das Salz in der Luft zu riechen und dabei die düstere, tief eingebrannte Erinnerung an diesen Kai zu verdrängen: das auf der Flut schaukelnde Gefangenenboot, die deutschen Soldaten, ihr Vater, der aus dem Gefangenentransporter geholt wurde. Seitdem war sie natürlich schon öfter wieder hier gewesen, um das Schiff des Roten Kreuzes zu Weihnachten zu begrüßen und die Tommies an Land kommen zu sehen; davon hielt sie auch die schlechte Erinnerung nicht ab. Dieses Dock war ein zentraler Teil des Insellebens. Sie sah sich um. Überall hingen die Menschen an irgendeiner Reling oder kletterten auf Autodächer für eine bessere Sicht, kramten in ihren Taschen nach Brillen und beäugten die fernen Gestalten an Deck. Die Aufregung war mit Händen zu greifen, denn dies war kein gewöhnliches Schiff.
Ihr Blick ruhte auf einem Paar, vielleicht Mitte dreißig, das sich gegen die Brise aneinanderschmiegte. Der Mann umklammerte die Taille seiner Frau, als fürchte er, sie könne plötzlich ins Hafenbecken springen, während die Frau selbst in banger Hoffnung das Mosaik der Gesichter an Deck studierte. Sie warteten, da war sich Jean sicher, auf ihr Kind – oder besser, auf den jetzt sicher entfremdeten jungen Menschen, der an einem verzweifelten Morgen im Jahr 1940 ihr Kind gewesen war, das sie trotz seiner verängstigten Schreie auf ein Evakuierungsboot gestoßen hatten. Eine Familie von Hunderten, die in jenen verzweifelten Hungerjahren zu dem Schluss gekommen war, dass eine gefährliche Reise über den Ärmelkanal und ein ungewisses Leben allein in England besser war als die Besetzung durch die Nazis und dass, wenn schon nicht sie selbst, wenigstens ihre Kinder eine Chance bekommen sollten. Was würde ein solcher Riss bei einer Familie anrichten?, fragte sich Jean. Fünf Jahre Trennung, Kinder, die bei entfernten Verwandten oder Pflegeeltern aufwuchsen, mit fremden Sitten und neuen Wörtern, ohne Anrufe oder Briefe ihrer Eltern, um die Erinnerungen wachzuhalten. Würden sie ihre Eltern überhaupt noch wiedererkennen? Und würden die Eltern den windgepeitschten Heranwachsenden wiedererkennen, der das Schiff verließ und sich unter den anderen Evakuierten wahrscheinlich mehr zu Hause fühlte als bei ihnen? Jean stellte sich vor, schon in einem so zarten Alter von ihrem Vater getrennt worden zu sein, und zitterte dabei.
Die Landungsbrücke wurde in Position gebracht und die ersten Passagiere strömten von Bord. Sofort bildete sich eine Menschentraube um sie, ein brodelndes Gedränge, Umarmungen, Lachen und Weinen. Jean und ihre Mutter hielten sich zurück. Violet umklammerte ihre Handtasche, Jean hatte ihre Hände gefaltet. Und plötzlich stapfte da inmitten der Neuankömmlinge eine massige Gestalt mit einem großen Koffer in der Hand schwerfällig den Steg hinunter, und ohne sein Gesicht genau zu sehen, wusste Jean, dass es Eddie war. Er hatte abgenommen, und in seinem lockigen hellbraunen Haar zeichneten sich graue Strähnen ab, gleichwohl erkannte sie ihren Onkel sofort. In den vorangegangenen Tagen hatte sie sich eingeredet, dass Eddies Erscheinung ihr auch ein bisschen von ihrem Vater zurückgeben könnte. Doch als sie Eddie in seinem offenen Trenchcoat, der im Wind flatterte, jetzt auf sich zukommen sah, wurde ihr klar, wie töricht die Hoffnung gewesen war. Er zog sie an sich und erzählte das Übliche, wie erwachsen sie geworden sei, und sein Körpergeruch – eine Mischung aus Schweiß, Tabak und etwas eklig Süßem – wirkte fremd und falsch. Er war in jeder Hinsicht das Gegenteil von ihrem Vater.
»Hol mich der Teufel! Ihr braucht dringend was zu futtern, damit ihr wieder Fleisch auf die Rippen kriegt!«, polterte Eddie und musterte die beiden Frauen von oben bis unten. Dann sah er sich um. »Trotzdem – allem Anschein nach hat sich hier nicht viel verändert.«
Violet schnaubte. »Wart’s nur ab. Wenn du erst die Küste siehst … St. Ouen haben die Mistkerle ruiniert.«
»Ja, hab gehört, dass der alte Adolf es mit den Festungsanlagen ein bisschen übertrieben hat. Was Neues von Phil?«
»Nein, bis jetzt nicht. Sie sagen, sie tun, was sie können.«
»Das wird schon.« Eddie nickte einem fernen, imaginären Publikum zu. »Wenn einer versteht, auf sich aufzupassen, dann Phil. Gut, wie kommen wir hier weg?« Er ging weiter, wobei ihm der schwere Koffer gegen die Beine schlug. Jean und Violet mussten einen Schritt zulegen, um ihn einzuholen.
»Unser Nachbar Bill Syvret holt uns oben mit dem Auto ab. Aber … warten wir nicht auf die anderen?«, fragte Violet. »Wo sind Maureen und die Kinder?«
»In Exmouth. Ich habe in dem Telegramm doch geschrieben, dass ich allein komme.« Er starrte in die Luft.
»Nein, hast du nicht. Warum sind sie nicht mitgekommen?«
»Jersey will nicht, dass allzu viele Frauen und Kinder zurückkommen, bis hier wieder Normalität einkehrt. Nur Männer in bestimmten Berufsgruppen. Zum Beispiel Bauarbeiter.« Er klopfte sich mit der freien Hand auf die Brust, als ob Jean und Violet nicht wüssten, was er arbeitete. Jean dachte an seine Frau, die ständig erschöpft aussah, und an die Cousins und Cousinen, mit denen sie als Kind gespielt hatte, und ihr entging nicht, wie ihr Onkel den Blick umherschweifen ließ, nur um sie nicht ansehen zu müssen.
»Meinst du, sie kommen da drüben gut zurecht ohne dich?«, fragte Violet.
Eddie stieß ein etwas spöttisches Lachen aus. »Um die mach dir mal keine Sorgen! Maureen? Die ist mit der halben Stadt befreundet. Was für ein Auto hat denn dieser Bill?« Jean sah, dass ihre Mutter Mühe hatte, mit Eddie Schritt zu halten, und zog ihn am Arm, um ihn zu bremsen, doch er nahm keine Notiz davon. »Ich möchte nur zum Haus. Ich will sehen, in welchem Zustand es ist, mir ein Bild davon machen, was zu tun ist.«
»Euer altes Haus? Da willst du als Erstes hin?« Erst Violets besorgter Ton brachte Eddie dazu stehen zu bleiben.
Er blickte zwischen ihnen hin und her, und Jean sah, dass in diesem Moment etwas zwischen ihnen passierte. »Wieso, warum fragst du?«
G
Im Wohnzimmer in der St. Mark’s Road herrschte Stille, die einzigen Geräusche kamen vom knisternden Kaminfeuer und von der Standuhr in der Diele. Jean, an kühle Abende gewöhnt, hatte den Luxus von Brennholz an einem Juniabend, selbst an einem kühlen, infrage gestellt und argumentiert, sich lieber einen weiteren Pullover überzuziehen. Doch ihre Mutter bestand auf ein Feuer im Kamin, weil es die Wohnung ein wenig behaglicher machte, und so hatte Jean nach dem Tee pflichtbewusst die Holzscheite aus dem Schuppen geholt.
Es war gerade acht Uhr – zu früh, um sich zu entschuldigen und schlafen zu gehen. Nach sechs Seiten Lektüre wurde ihr klar, dass sie dieselbe rührselige Romanze vor nicht einmal einem Jahr in der Bibliothek gelesen hatte, und abgelenkt, wie sie war, konnte sie ihren Blick nicht von Eddies Zigarette auf dem Rand des Aschenbechers wenden. In seine Zeitung vertieft, hatte Eddie sie dort herunterbrennen lassen, und Jean sah zu, wie die winzige Aschesäule an der Spitze immer länger wurde, bevor sie jeden Moment herunterfallen musste, während der graue Rauch zur Decke aufstieg. Vor langer Zeit, vor dem Krieg, als Tabak noch billig zu haben war, hatte auch ihr Vater öfter eine Rothman auf demselben Aschenbecher bis zur Hälfte abbrennen lassen. Er war so selten zu Hause gewesen, dass solche Gelegenheiten kostbar waren, und Jean rollte sich dann zu seinen Füßen ein, zupfte an den losen Fäden seiner Pantoffeln und hielt sich an die Regel, dass die Kinder nicht sprechen durften, bis der Vater mit der Zeitung fertig war – Harry, das Plappermaul, bekam deswegen immer Ärger. Aber das Schweigen mit ihrem Vater war nie angespannt, bei Eddie hingegen spürte Jean, wie von ferne eine Sturmböe heraufzog.
Seit ihrem Ausflug zu seinem Haus vor drei Tagen köchelte die Wut ihres Onkels wie in einem Schmortopf.
Die fünfzehnminütige Fahrt nach St. Saviour’s, bei der sie auf dem harten Rücksitz von Bills Auto hin und her geschleudert wurden, war ihnen endlos erschienen. Eddie hatte ungeduldig mit den Fingern gegen die Beifahrertür getrommelt, während Jean und ihre Mutter nervöse Blicke tauschten. Schließlich beugte sich Violet nach vorn und holte tief Luft.
»Du musst verstehen, Eddie, wie es hier in den ersten Monaten zuging. Die Deutschen sind wie Heuschrecken über die Geschäfte hergefallen. Nicht nur Lebensmittel. Kleidung, Geschirr – egal was, sie haben es genommen und nach Deutschland geschickt.« Eddie starrte weiter auf die Straße. Sein Hinterkopf glänzte von Schweiß. »Dann ist uns das Essen ausgegangen«, fuhr Violet fort. »Man brauchte Dinge, mit denen man tauschen konnte. Die Leute waren verzweifelt.«
»Also fanden sie es in Ordnung, die Evakuierten auszuplündern?« Seine Stimme klang jetzt anders, gefährlich leise.
»Es wusste ja keiner, ob ihr jemals zurückkommen würdet. Man kann es den Leuten nicht verübeln, dass sie sich in ihrer Not genommen haben, was sie brauchten.«
»Es ist aber nicht nur das«, murmelte Jean, die ihren Onkel auf weitere schlechte Nachrichten vorbereiten wollte. Doch ihre Mutter stupste sie in die Rippen, und Jean sagte nichts weiter.
Als das Auto von Bill Syvret in die Einfahrt einbog, sagte Jean der Gesichtsausdruck ihres Onkels alles. Sie bereute, dass sie ihn sich immer in einem gemütlichen englischen Dorf vorgestellt hatte, bei einem Pint im Pub oder beim Radiohören vor einem lodernden Kaminfeuer. Während sie und ihre Mutter die letzten fünf Jahre lang um Erlösung gebetet hatten, sah sie jetzt, dass Eddie all die Jahre lang von diesem Moment geträumt hatte – von einer triumphalen Rückkehr in das Shangri-La, das er sich fünfzehn Jahre zuvor mit eigenen Händen gebaut hatte. Er hatte sich wohl ausgemalt, wie er freudig den Schlüssel im Schloss umdrehte und in der Speisekammer eine Kiste Kohle und eine mit Brot und Käse fand. Jetzt stieg er langsam aus Bills Austin und schritt in der Dämmerung auf die Ruine seines Hauses zu, trat vorsichtig in den Raum, vor dem die Haustür hätte sein sollen, bis er in der Mitte dessen stand, was einmal sein Wohnzimmer gewesen war. Jean spürte, dass ihn weniger der Verlust seines persönlichen Eigentums schockierte – die verschwundenen Stühle, Teppiche und Gardinen –, sondern das Ausmaß mutwilliger Zerstörung: zerbrochene Scheiben, aus den Rahmen gerissene Türen, die klaffenden Löcher im Dielenboden. Wegen der eingeschlagenen Fenster im Obergeschoss hatte der monatelange Regen die obere Etage durchnässt, sodass ein Teil des Bodens eingestürzt war. Überall wucherte schwarzer Schimmel, und irgendwo in den Dachsparren flatterte eine Taube aus dem Nest. Jean und Violet beobachteten, wie Eddie zögernd in Richtung Küche weiterging, wo er den aus der Wand gerissenen Spülstein auf dem Boden sehen würde. Es würde ihm nichts anderes übrigbleiben, als das Haus zu entkernen und noch einmal von vorn anzufangen.
Als er zum Auto zurückgekommen war, saßen sie mehrere Minuten lang schweigend da. Schließlich versicherte Violet Eddie, er könne so lange bei ihnen bleiben, wie er wolle – eine Einladung, mit der Jean zwar gerechnet hatte, vor der ihr aber dennoch grauste –, und er nickte zustimmend. Der arme, verlegene Bill ließ den Motor an und sie fuhren zurück in die Stadt. Lange Zeit sagte Eddie nichts. Schließlich fragte er: »Wie lange ist das schon so?«
»Das ist nach und nach passiert«, murmelte Violet. »Letzten Winter war es wirklich schlimm – die Leute haben alles verbrannt, was sie finden konnten, um ein bisschen weniger zu frieren. Auch die Deutschen.«
»Das war mein Zuhause«, war die einzige Antwort von Eddie. Den Rest des Abends und die folgenden Tage verbrachte er in der Kneipe und im alten Sessel ihres Vaters, nahm die Mahlzeiten und den Tee an, die Schwägerin und Nichte ihm brachten, und las nachts jeden Artikel der Evening Post, als ob darin die Erklärung für diese neue, fremde Welt zu finden sei. Jean beobachtete ihn, und mit jedem Tag mischten sich mehr Vorbehalte in ihr Mitgefühl.
Während sie ihren Gedanken nachhing, beschloss Jean, sich zu verabschieden und den Rest des Abends in ihrem Zimmer zu verbringen. Sie war gerade dabei, das Lesezeichen in ihr Buch zu legen, als es an der Tür klingelte, so unerwartet, dass beide Frauen aufsprangen. Sie eilte zum Fenster – vor der Tür stand ein uniformierter Polizist aus dem Ort. Da sich sonst niemand rührte, eilte sie in den Flur, um aufzumachen. Als sie den Riegel zurückschob, merkte sie, dass ihr die Finger zitterten.
Der Beamte lächelte freundlich, aber ein wenig enttäuscht – offensichtlich hatte er gehofft, mit jemand Älterem sprechen zu können.
»Bin ich hier richtig bei Familie Parris?«, fragte er. Jean nickte. Ihr wurden die Beine weich. »Ich bringe hier einen Herrn mit, der mit Ihnen sprechen möchte.« Der Polizist trat zur Seite. Hinter ihm stand ein kleiner, gebeugter Mann von unbestimmtem Alter, der Jean unter buschigen Brauen hervor mit traurigen Augen ansah. Sein schütteres Haar stand ihm wirr vom Kopf ab, und seine Haut war von einem seltsamen Violettgrau. Er erinnerte an einen Kobold aus einem Kinderbuch.
»Madame Parris?«, flüsterte der Mann mit starkem französischen Akzent.
»Mademoiselle Parris«, stellte Jean klar und erkannte dabei ihre eigene Stimme kaum wieder. »Meine Mutter …«
»Ich bin Mrs. Parris.« Violet war neben sie getreten, und Jean spürte, dass auch Eddie im Hintergrund stand. »Kann ich Ihnen helfen?«
Der Mann musterte Violet eindringlich. »Sie sind … Violet?«
Jean krampfte sich der Magen zusammen. Woher kannte dieser seltsame kleine Mann den Vornamen ihrer Mutter? Aus den Augenwinkeln heraus sah Jean, wie ihre Mutter nickte.
»Mein Name ist Charles Clement.« Der Mann hielt inne, als hätte er diese Rede schon oft geprobt, sei nun aber mit seiner Darbietung nicht zufrieden. Er wischte sich übers Gesicht und setzte noch einmal an. »Mein Name ist Charles Clement, ich war zusammen mit Ihrem Mann Philip in Deutschland in Gefangenschaft.«
Er sprach den Namen ihres Vaters auf Französisch aus, mit der Betonung auf der zweiten Silbe. Jean suchte am Türrahmen Halt und sah, dass es ihrer Mutter ähnlich erging. Sie warteten, aber es kam nichts weiter. Schließlich fand Violet ihre Stimme wieder.
»Sie kennen meinen Mann? Wo ist er?«
Clement zögerte, und in diesem Moment hatte Jean Gewissheit. In Gedanken flehte sie ihn an, nichts mehr zu sagen, sich umzudrehen und wegzugehen, damit sie es nicht hören musste. Aber es war zu spät.
»Es tut mir so leid, Madame. Ich bin hier, um Ihnen mitzuteilen, dass Philip tot ist.«
2
1
Sie fixierte seine Hände, die zarten, knochigen Finger wie von einer älteren Frau, weiß wie Gips auf seiner zerlumpten dunklen Hose. Charles Clement saß still und starr da und lehnte jedes Angebot von Gastfreundschaft ab, während er, wie Jean vermutete, die Geschichte, zu der er sich jetzt aufraffte, geistig immer wieder verwarf und neu zusammenstellte. Draußen spielten einige Kinder in der letzten Stunde vor der Abenddämmerung Murmeln und lachten dabei, während es in der Stube unter dem Knistern des verlöschenden Feuers immer stiller wurde. Der Polizist hielt sich im Hintergrund, Jean und ihre Mutter hatten sich auf der äußersten Kante ihrer Stühle niedergelassen und warteten ängstlich. Ein oder zwei Mal warf Clement einen nervösen Blick auf Eddie, der am Kamin stand und finster dreinblickte. Allein an seinem Gesichtsausdruck konnte Jean ablesen, was er dachte – dass dieser Fremde sich das alles nur ausgedacht haben musste, vielleicht, um eine Belohnung einzustreichen oder sie alle aus unlauteren Motiven hinters Licht zu führen. Doch als der Franzose in gebrochenem Englisch zu sprechen begann, erkannte Jean an der Schlichtheit seiner Worte, dass er die Wahrheit sagte.
Clement war inhaftiert worden, weil er einem Widerstandskämpfer in Rennes Unterschlupf gewährt hatte. Im Gefängnis von Preungesheim in Frankfurt hatten er und Philip in einer Zelle gesessen. Clement war einst als Kind in Jersey gewesen, und so waren sie schnell ins Gespräch gekommen. Die beiden schlossen Freundschaft und versprachen einander, sich gegenseitig zu unterstützen, was in dem deutschen Gefängnis überlebenswichtig war. Preungesheim, so erklärte er, sei ein Höllenloch gewesen, in dem die Häftlinge bei Hungerrationen zehn oder elf Stunden am Tag hätten schuften müssen, sei es in der Fabrik oder bei der Trümmerräumung auf Frankfurts Straßen. Das alles, so erzählte er weiter, war jedoch nichts im Vergleich zu dem Ort, an den sie in den Wochen nach Invasion der Alliierten verlegt wurden – Naumburg. Dort wurden die Gefangenen in winzige, überfüllte Zellen gepfercht, durften nicht sprechen, rauchen oder auch nur lächeln und mussten täglich mit sechs Unzen Brot und einer Schüssel Suppe auskommen. Krankheiten grassierten, und als im letzten Winter die Ruhr das Gefängnis heimsuchte, erlag Parris, inzwischen gefährlich untergewichtig, schnell diesem Leiden.
Hier zögerte Clement und warf einen besorgten Blick auf die Familie, doch Eddie bestand trotz der aschfahlen Gesichter der Frauen darauf, kein Detail auszulassen. Mit leiser, schwächer werdender Stimme erzählte Clement, wie sich der Zustand von Parris rapide verschlechtert habe, dass jedoch die flehentlichen Bitten von Clement und anderen Gefangenen die dringend benötigte ärztliche Behandlung erwirken konnten. In den frühen Morgenstunden des 17. Januar starb Philip in seiner Zelle. Clement, der Violet die hagere Hand reichte, versicherte ihr, ein Gebet über Philips Leichnam gesprochen und dann dessen wertvollsten Besitz gesichert zu haben – ein Foto von Violet mit den Kindern Harry und Jean, das ein Jahrzehnt zuvor am Strand von St. Brelade aufgenommen worden war. Dieses Foto holte er jetzt aus seiner Brieftasche und reichte es Jeans Mutter.
»Es tut mir so leid«, murmelte Clement. »Aber ich habe Philip versprochen, dass ich, wenn ich überlebe, hierherkommen werde, um es Ihnen persönlich zu sagen. Vielleicht ist es besser, es zu wissen, als es nicht zu wissen.«
Jean und ihre Mutter starrten mit leeren Blicken auf das Foto, ein kleines Schwarzweißbild von drei unbeschwerten Menschen, die so nicht mehr existierten. Jean spürte, wie in diesem Moment ihre Welt in Stücke ging. Das Gesicht ihrer Mutter war aschfahl, als sie versuchte, etwas über die Lippen zu bringen.
»Was ist mit seinem Leichnam geschehen?«
»Die Wärter haben ihn geholt. Je suis désolé – mehr weiß ich nicht.«