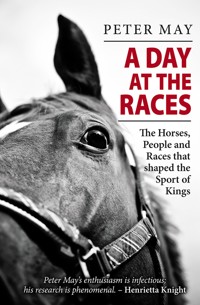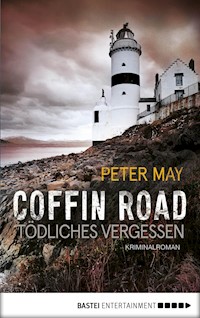Zsolnay E-Book
Peter May
Beim Leben deines Bruders
Roman
Aus dem Englischen von Silvia Morawetz
Paul Zsolnay Verlag
Der Originaltitel lautet The Lewis Man, zuerst veröffentlicht unter dem Titel L’homme de Lewis bei Editions du Rouergue.
ISBN 978-3-552-05682-4
© Editions du Rouergue, 2011
Alle Rechte der deutschsprachigen Ausgabe
© Paul Zsolnay Verlag Wien 2014
Schutzumschlaggestaltung: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich, Dominic Wilhelm, unter Verwendung eines Fotos von © Roy Bishop / Arcangel Images
Satz: Eva Kaltenbrunner-Dorfinger, Wien
E-Book-Konvertierung: Beltz Bad Langensalza GmbH
Unser gesamtes lieferbares Programm und viele andere Informationen finden Sie unter www.hanser-literaturverlage.de
Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/ZsolnayDeuticke
Zum Andenken an meinen Vater
Dort leben sie, nicht hier und jetzt, nein, wo es alles einst geschah.
aus »Die alten Narren« von Philip Larkin1
1 Philip Larkin: Gedichte. Englisch und Deutsch. Ausgewählt und übertragen von Waltraud Anna Mitgutsch © 1964, 1966, 1974 by Philip Larkin. Klett-Cotta, Stuttgart 1988; Extract from »The Old Fools« taken from Collected Poems by Philip Larkin. Reprinted by permission of Faber & Faber Ltd.
PROLOG
Auf dieser sturmgepeitschten Insel drei Stunden vor der Nordwestküste Schottlands ist es allein der karge Boden, von dem die Menschen ihre Nahrung und ihre Wärme beziehen. Er nimmt auch ihre Toten auf. Und nur selten gibt er, wie heute, einen wieder her.
Es wird gemeinschaftlich getan, das Torfstechen. Familie, Nachbarn, Kinder, alle sind auf dem Hochmoor versammelt. Ein milder Südwest weht, der das Gras trocknet und die Mücken fernhält. Annag ist erst fünf Jahre alt. Es ist ihr erstes Torfstechen, und sie wird es ihr Leben lang nicht vergessen.
Den ganzen Morgen war sie bei ihrer Großmutter in der Küche des Bauernhauses und hat aufgepasst, als auf dem alten Enchantress-Herd, mit dem Torf vom Vorjahr beheizt, die Eier gekocht wurden. Jetzt ziehen die Frauen mit Tragekörben aufs Moor hinaus, Annag barfuß, das braune sumpfige Wasser gluckst zwischen ihren Zehen, als sie vorneweg rennt über die stachlige Heide, weil heute doch so ein aufregender Tag ist.
Ihre Augen sehen nichts als Himmel. Einen Himmel, vom Wind in Fetzen gerissen. Einen Himmel, an dem für Momente die Sonne aufblitzt und sich über dürre Weiden ergießt, auf denen weißes Wollgras im böigen Wind wogt. In ein paar Tagen werden die braunen Winterbrachen gelb und lila gefärbt sein von den Wildblumen des Frühjahrs und des Sommers, die vorläufig aber noch schlummern, wie abgestorben.
In der Ferne zeichnen sich die Silhouetten eines halben Dutzends Männer in Overalls und Stoffmützen im Gegenlicht der grellen Sonne ab, die über einem Ozean aufblitzt, der an Klippen aus schwarzem Gneis schlägt. Man erkennt fast nichts in dem Licht, und Annag muss die Hand über die Augen heben, damit sie sehen kann, wie die Männer gekrümmt und gebückt neben dem tarasgeir hergehen, der durch den weichen schwarzen Torf gleitet und ihn in durchnässten dicken Stücken nach oben wirft. Generationen von Torfstechern haben das Land mit Narben überzogen. Gräben, zwölf oder achtzehn Zoll tief, und oben an ihren Rändern die frisch geschnittenen Soden, die hier zum Vortrocknen ausgelegt werden, erst von der einen und dann von der anderen Seite. In ein paar Tagen ist cruinneachadh, dann kommen die Torfstecher wieder, schichten die Soden zu rùdhain auf, zu dreiseitigen Haufen, durch die der Wind bläst, bis sie ganz ausgetrocknet sind.
Zu gegebener Zeit werden sie auf einen Torfkarren geladen und zum Croft gefahren, trockene, bröselige Torfsoden in Ziegelsteinform, im Fischgrätenmuster zu dem hohen Stapel aufgeschichtet, von dem die Familie den ganzen nächsten Winter Wärme zum Heizen und für das Zubereiten des Essens bezieht.
Auf Lewis, dieser nördlichsten Insel der Gruppe der schottischen Hebriden, leben die Menschen seit Jahrhunderten so. Und in der heutigen Zeit finanzieller Ungewissheit, in der die Benzinkosten in die Höhe schnellen, besinnt sich alles, was noch offene Herde und Feuerstellen hat, auf die Traditionen der Vorfahren. Denn dadurch kostet das Beheizen des eigenen Hauses nur eigene Arbeitskraft und Gottvertrauen.
Doch für Annag ist es nur ein Abenteuer, hier draußen, wo der Wind übers Moor fegt und die linde Luft ihr in den Mund fährt, als sie lacht und nach Vater und Großvater ruft, irgendwo hinter sich die Stimmen ihrer Mutter und ihrer Großmutter, die sich schreiend verständigen müssen. Annag spürt nichts von der Nervosität, die die Schar der Torfstecher vor ihr erfasst hat. Mit ihrer begrenzten Erfahrung kann sie die Körpersprache der Männer nicht lesen, die sich um das Stück Grabenwand kauern, das ihnen vor die Füße gefallen ist.
Zu spät sieht der Vater die Kleine kommen und ruft, sie soll wegbleiben. Zu spät für Annag, noch anzuhalten oder auf die Panik in seinem Ton zu reagieren. Mit einem Mal stehen die Männer, wenden sich ihr zu, und das Gesicht ihres Bruders ist weiß wie die Laken, die zum Bleichen in der Sonne ausgebreitet werden.
Und so folgt Annag seinem Blick auf die abgerutschte Torfwand und auf den Arm, der sich ihr entgegenreckt, die Finger wie um einen unsichtbaren Ball gekrümmt. Ein Bein liegt abgeknickt auf dem anderen, ein Kopf ist in die Furche gesackt wie auf der Suche nach einem verlorenen Leben, schwarze Höhlen, wo Augen sein sollten.
Für einen Moment treibt sie auf einem Meer von Unbegreiflichkeit, doch dann schlägt das Verstehen über ihr zusammen, und der Wind reißt ihr den Schrei von den Lippen.
Eins
Gunn sah die am Straßenrand parkenden Fahrzeuge schon von weitem. Der Himmel war schwarz und blau, rollte als schwere, dunkle Wolkenwand über den Ozean heran. Schon zogen die Wischer erste Regenspritzer über die Windschutzscheibe. Das Zinngrau des Ozeans war durchsetzt vom Weiß drei, vier Meter hoher sich brechender Wellen, und das einsame Blaulicht des Polizeiautos neben dem Krankenwagen ging unter in der Weite der Landschaft.
Hinter den Fahrzeugen duckten sich die verputzten Häuser von Siader in das übliche Wetter, herausfordernd und müde, aber an seine unbarmherzigen Attacken gewöhnt. So weit das Auge reichte, nicht ein Baum, nur Reihen verfaulender Zaunpfähle am Straßenrand und rostige Traktoren- und Autowracks in aufgegebenen Höfen. Zerzauste Sträucher mit tapferen grünen Spitzen klammerten sich mit störrischen Wurzeln in Erwartung besserer Tage an den kargen Boden, und ein Meer aus Wollgras wogte und kräuselte sich wie Wasser im Wind.
Gunn parkte neben dem Polizeiauto und trat in den Wind hinaus, der ihm unter das volle schwarze, am Ansatz spitz zulaufende Haar fuhr und es anhob. Gunn zog seinen schwarzen Steppanorak enger um sich. Verflucht!, er hatte nicht daran gedacht, Stiefel mitzunehmen. Vorsichtig schritt er über den weichen Boden, aber schon bald schwappte das sumpfige Wasser ihm in die Schuhe und durchnässte die Socken.
An der ersten Torfreihe angekommen, folgte er einem oben entlangführenden Pfad und schritt um die zum Trocknen ausgebreiteten Soden herum. Die Techniker hatten Eisenstangen in die Erde getrieben und den Fundort mit blau-weißem Band abgesperrt, das im Wind knatterte und flatterte. Aus den nächstgelegenen Bauernhäusern, ungefähr eine halbe Meile in Richtung der Klippen, stieg Gunn der Geruch von Torfrauch in die Nase.
Um den Leichnam herum stand eine Gruppe von Männern, die sich fast in den Wind lehnen mussten: in fluoreszierendem Gelb die Sanitäter vom Krankenwagen, die darauf warteten, den Toten fortzubringen, und Polizisten in schwarzen Regenmänteln und karierten Hüten, die bis eben geglaubt hatten, sie hätten schon alles gesehen.
Sie traten wortlos auseinander und ließen Gunn durch. Der Polizeiarzt hockte auf dem Boden, über die Leiche gebeugt, und schob, die Hände in Latexhandschuhen, mit sachten Bewegungen bröselnden Torf beiseite. Er sah nach oben, als Gunn über ihm auftauchte, und Gunn erhaschte einen ersten Blick auf die braune, verwitterte Haut des Toten. Er runzelte die Stirn: »Ein … Farbiger?«
»Nur gefärbt. Vom Torf. Ein Weißer, würde ich sagen. Ziemlich jung. Keine zwanzig oder nur knapp darüber. Eine klassische Moorleiche, fast vollständig erhalten.«
»Sie haben schon mal eine gesehen?«
»Noch nie. Aber darüber gelesen. Das Torfmoos gedeiht hier ja nur so prächtig, weil der Wind Salz vom Ozean heranträgt. Und wenn die Wurzeln verrotten, bildet sich Säure. Diese Säure konserviert den Leib, legt ihn sozusagen ein. Die inneren Organe dürften praktisch intakt sein.«
Gunn blickte mit ungebremster Neugier auf die mumifizierten sterblichen Überreste. »Wie ist er gestorben, Murdo?«
»Durch Gewalteinwirkung, wie es aussieht. Das da in der Brust sind mehrere Einstiche, und die Kehle man hat ihm auch durchgeschnitten. Aber für die endgültige Bestimmung der Todesursache brauchen Sie den Pathologen, George.« Murdo erhob sich und streifte die Handschuhe ab. »Wir bringen ihn lieber weg, bevor es zu regnen anfängt.«
Gunn nickte, konnte aber die Augen nicht von dem Mann abwenden, der da im Torf eingeschlossen war. Seine Züge wirkten zwar etwas geschrumpft, aber jeder, der ihn kannte, würde ihn wiedererkennen. Nur das exponierte weiche Gewebe rund um die Augen hatte sich zersetzt. »Wie lange liegt er schon hier?«
Murdos Lachen verflog im Wind. »Keine Ahnung. Hunderte von Jahren, vielleicht sogar Tausende. Das kann Ihnen nur ein Fachmann sagen.«
Zwei
Ich brauch nicht auf die Uhr zu sehen, wenn ich wissen will, wie spät es ist.
Ist doch komisch, dass der braune Fleck an der Decke morgens heller aussieht. Die Schimmelspuren an dem langen Riss kommen mir irgendwie weißer vor. Merkwürdig ist ja auch, dass ich immer zur gleichen Zeit aufwache. An dem Licht, das um die Vorhangränder kriecht, kann es nicht liegen, um die Jahreszeit ist es nur wenige Stunden dunkel. Es wird eine innere Uhr sein. Die vielen Jahre, die ich im Morgengrauen aufgestanden bin fürs Melken und die anderen Arbeiten, mit denen die hellen Tagesstunden ausgefüllt waren. Alles vorbei jetzt.
Den Fleck an der Decke ansehen, das macht eigentlich Spaß. Keine Ahnung, warum, aber morgens ähnelt er einem edlen Pferd, das schon gesattelt bereitsteht, um mich in eine strahlendere Zukunft zu tragen. Abends freilich, wenn es finster wird, wirkt es ganz anders. Dann sieht es aus wie ein gehörntes Vieh, sprungbereit, mich in die Dunkelheit zu tragen.
Die Tür geht auf, und als ich hinsehe, steht da eine Frau. Sie kommt mir bekannt vor, aber ich weiß nicht genau, wo ich sie hintun soll. Dann sagt sie etwas.
»Oh, Tormod …«
Natürlich. Es ist Mary. Ihre Stimme würde ich überall heraushören. Warum sieht sie so traurig aus? Und da ist noch etwas. Irgendetwas zieht ihre Mundwinkel nach unten. Ekel, so etwas. Sie hat mich einmal geliebt, obwohl ich nicht sicher bin, dass ich sie je geliebt habe.
»Was ist denn, Mary?«
»Du hast wieder ins Bett gemacht.«
Und da rieche ich es auch. Ganz plötzlich. Fast überwältigend. Warum hab ich das vorhin nicht bemerkt?
»Du hättest wohl nicht aufstehen können? Nein?«
Ich verstehe nicht, warum sie schimpft. Es war doch keine Absicht. Ich mache es nie mit Absicht. Der Geruch ist noch schlimmer, als sie die Decke zurückzieht, und sie schlägt die Hand vor den Mund.
»Steh auf«, sagt sie. »Ich muss das Bett abziehen. Geh und leg deinen Schlafanzug ins Bad und stell dich unter die Dusche.«
Ich schwinge die Beine über die Bettkante und warte darauf, dass sie mir aufstehen hilft. Früher war das anders. Da war immer ich der Starke. Das eine Mal, das weiß ich noch, als sie sich den Knöchel verstaucht hatte, an der alten Schafhürde, als wir die Biester zum Scheren zusammengetrieben haben. Sie konnte nicht mehr auftreten, und ich musste sie nach Hause tragen. Fast zwei Meilen, mit schmerzenden Armen, aber ohne ein Wort der Klage. Warum denkt sie nie daran?
Weiß sie nicht, wie demütigend das ist? Ich drehe den Kopf zur Seite, damit sie die Tränen nicht sieht, die sich in meinen Augen sammeln. Blinzle schnell, damit sie weggehen. Hole tief Luft. »Donald Duck.«
»Donald Duck?«
Ich sehe kurz zu ihr hinüber und schrumpfe fast unter dem Zorn in ihrem Blick. Hab ich das gesagt? Donald Duck? Das kann ich nicht gemeint haben. Aber was wollte ich dann sagen? Es fällt mir nicht ein. Deshalb wiederhole ich mit fester Stimme: »Ja, Donald Duck.«
Sie zerrt mich auf die Füße, fast grob, und schubst mich in Richtung Tür. »Geh mir aus den Augen!«
Warum ist sie so zornig?
Ich tapse ins Bad und steige aus dem Schlafanzug. Wo sollte ich den noch mal hinlegen? Ich lasse ihn zu Boden fallen und schaue in den Spiegel. Ein alter Mann mit spärlichen Resten weißen Haars und blassblauen Augen starrt mich an. Ich überlege kurz, wer das ist, und drehe mich zum Fenster und schaue über den Machair zur Küste. Der Wind stellt das dicke Winterfell der Schafe auf, die auf dem frischen salzigen Gras weiden, aber ich höre ihn nicht. Ich höre auch den Ozean nicht, der sich an der Küste bricht. Herrliches, weiß schäumendes Meerwasser, sandig und ungestüm.
Das muss die Doppelverglasung sein. Auf der Farm hatten wir so was nicht. Da hat der Wind durch die Fensterrahmen gepfiffen und den Torfrauch durch den Schornstein nach unten gedrückt, und du hast gewusst, dass du lebst. Damals war noch Platz zum Luftholen, Platz zum Leben. Hier sind die Zimmer so klein, abgeschottet gegen die Welt. Als lebte man in einer Blase.
Der Alte sieht mich wieder aus dem Spiegel an. Ich lächle, und er lächelt zurück. Natürlich wusste ich von Anfang an, dass ich das bin. Was Peter jetzt wohl macht?
Drei
Es war dunkel, als Fin schließlich das Licht löschte. Aber die Wörter waren noch da, hatten sich auf seine Netzhaut eingebrannt. Es gab kein Entrinnen ins Dunkel.
Außer Monas Zeugenaussage gab es noch zwei andere. Nur waren diese beiden Zeugen nicht so geistesgegenwärtig gewesen, auf das Kennzeichen des Wagens zu achten. Dass Mona es nicht gesehen hatte, war keine Überraschung. Das Auto hatte sie ja in die Luft geworfen und nach harter Zwischenlandung auf der Motorhaube und den Scheinwerfern auf die Straße geschleudert, wo sie sich auf dem harten Schotter mehrfach überschlug. Eigentlich ein Wunder, dass sie nicht noch schwerer verletzt worden war.
Robbie, dessen Körperschwerpunkt tiefer lag, war umgerissen und überrollt worden.
Jedes Mal, wenn Fin die Worte las, stellte er sich vor, er wäre dabei gewesen, hätte es mit eigenen Augen gesehen, und jedes Mal wurde ihm speiübel. Es stand ihm so lebhaft vor Augen wie eine echte Erinnerung. Ebenso wie die Beschreibung des Gesichts, das Mona hinter dem Lenkrad gesehen und das sich ihrem Gedächtnis eingeprägt hatte, obwohl sie es nur flüchtig gesehen haben konnte: ein Mann mittleren Alters mit längerem, graubraunem Haar. Und mit Dreitagebart. Wie hatte sie das sehen können? Und doch war sie sich in dem Punkt ganz sicher. Fin hatte sogar einen Zeichner kommen lassen, der nach ihrer Beschreibung ein Phantombild anfertigte. Ein Gesicht, das in der Akte blieb, ein Gesicht, das ihn bis in seine Träume verfolgte, auch noch neun Monate später.
Er drehte sich auf die andere Seite und schloss die Augen, konnte aber nicht wieder einschlafen. Die Fenster seines Hotelzimmers standen hinter dem Vorhang offen, damit Luft hereinkam, aber es drang auch der Lärm des Verkehrs auf der Princes Street herauf. Die Beine angezogen, die Ellbogen seitlich an den Körper gepresst, die Hände vor dem Brustbein verschränkt, lag Fin da wie ein betender Fötus.
Morgen war der Tag, an dem alles endete, was er fast sein ganzes Leben als Erwachsener gekannt hatte. Alles, was er gewesen und geworden war und was ihn ausmachte. Wie an dem Tag vor vielen Jahren, als seine Tante ihm gesagt hatte, dass seine Eltern tot waren und er sich zum ersten Mal in seinem kurzen Leben von Gott und aller Welt verlassen fühlte.
Das Tageslicht brachte keine Erleichterung, nur die ruhige Entschlossenheit, diesen Tag durchzustehen. Eine warme Brise wehte über The Bridges, die Sonne warf wechselnde Muster über die Gärten unterhalb des Schlosses. Resolut bahnte sich Fin den Weg durch die plappernde Menschenmenge, die schon in leichter Frühjahrsgarderobe unterwegs war. Eine Generation, die die mahnenden Worte ihrer Vorfahren – Pankraz, Servaz, Bonifaz machen erst dem Sommer Platz – vergessen hatte. Für andere ging das Leben weiter wie zuvor; gerecht hatte Fin das noch nie gefunden. Aber wer sollte denn ahnen können, welchen Schmerz er hinter seiner zur Schau gestellten Normalität verbarg? Und wer wusste schon, welcher Aufruhr hinter der Fassade anderer tobte?
Fin machte in dem Copyshop in der Nicolson Street Station, steckte die kopierten Blätter in seine Ledertasche, bog nach Osten in die St. Leonard’s Street ein und ging zum Gebäude A der Polizeidirektion, in dem er den größten Teil der letzten zehn Jahre verbracht hatte. Seinen Ausstand hatte er mit einer Handvoll Kollegen schon vor zwei Tagen in einem Pub in der Lothian Road gefeiert. Ein melancholischer Abend, an dem Wehmut und Bedauern den Ton angaben, aber auch echte Sympathie.
Ein paar Kollegen nickten ihm wortlos im Korridor zu. Andere reichten ihm die Hand. Es dauerte nur Minuten, die persönlichen Sachen aus seinem Schreibtisch in einen Karton zu packen: der traurige Rest eines rastlosen Arbeitslebens.
»Ihren Dienstausweis können Sie gleich mir geben, Fin.«
Fin fuhr herum. Detective Chief Inspector Black hatte etwas von einem Geier. Stets hungrig und wachsam. Fin nickte und reichte ihm den Ausweis.
»Ich sehe Sie ungern gehen«, sagte Black. Er sah aber nicht betrübt aus. An Fins Fähigkeiten hatte er auch nie gezweifelt, nur an seinem Einsatzwillen. Und erst jetzt, nach so vielen Jahren, konnte Fin sich schließlich eingestehen, dass Black recht hatte. Dass er ein guter Polizist war, wussten sie beide, allerdings hatte Fin länger gebraucht, bis er einsah, dass es nicht sein Metier war. Nach Robbies Tod war er so weit.
»Die vom Archiv haben mir gesagt, Sie hätten sich die Akte zu dem Unfall mit Fahrerflucht geholt, bei dem Ihr Sohn umgekommen ist«, sagte Black und hielt inne, vielleicht, weil er auf eine Bestätigung wartete. Als sie nicht kam, sagte er: »Die Kollegen hätten sie gern wieder.«
»Natürlich.« Fin ließ die Akte aus seiner Tasche gleiten und legte sie auf den Schreibtisch. »Reinsehen wird da wohl trotzdem keiner mehr.«
Black nickte. »Wohl nicht.« Und nach kurzem Zögern: »Es wird Zeit, dass Sie sie auch schließen, Fin. Sonst frisst es Sie innerlich auf, und Sie kommen Ihr ganzes Leben nicht davon los. Lassen Sie los, mein Sohn.«
Fin konnte dem Mann nicht in die Augen sehen. Er hob den Karton mit seinen Siebensachen hoch. »Das kann ich nicht.«
Draußen ging er um das Gebäude herum zur Rückseite und hob den Deckel einer großen grünen Mülltonne, in die er erst den Inhalt seines Kartons leerte und dann den Karton selbst warf. Er hatte keine Verwendung mehr dafür.
Einen Moment blieb er noch stehen und sah zu dem Fenster hinauf, hinter dem er so oft Sonne, Regen und Schnee über die im Schatten liegenden Hänge von Salisbury Craggs hatte hinwegstreichen sehen. All die Sommer und Winter all der vergeudeten Jahre. Dann schlüpfte er auf die St. Leonard’s Street hinaus und winkte sich ein Taxi herbei.
Das Taxi setzte ihn auf der Royal Mile ab, auf dem steilen Stück direkt unter der St. Giles’ Cathedral. Mona wartete am Parliament Square schon auf ihn. Sie trug noch ihre tristen grauen Wintersachen, ging fast unter in der klassischen Architektur dieses Athens des Nordens, den von Zeit und Rauch geschwärzten Sandsteinbauten. Ihre Farben zeigten wohl, wie ihr zumute war. Aber sie war mehr als bloß deprimiert. Fin sah ihr die Verärgerung an.
»Du kommst zu spät.«
»Entschuldige.« Er nahm ihren Arm, und sie eilten über den menschenleeren Platz und durch die Arkaden mit den hoch aufragenden Säulen darüber. Hatte er es unbewusst darauf angelegt, zu spät zu kommen? Nicht weil er die Vergangenheit nicht loslassen wollte, sondern eher aus Angst vor dem Unbekannten? Vor der ungewissen Zukunft, die er gegen die Sicherheit einer bequemen Beziehung eintauschte und der er sich allein stellen musste?
Er beobachtete Mona aus dem Augenwinkel, als sie durch das Portal dessen schritten, was einmal der Sitz des schottischen Parlaments gewesen war, bevor Landeigner und Kaufleute, dreihundert Jahre war das her, sich von den Engländern bestechen ließen und das Volk, das sie vertreten sollten, an eine Union verkauften, die es nicht wollte. Auch Fins und Monas Verbindung war ein Zweckbündnis gewesen, eine Freundschaft ohne Liebe, ihr Motor gelegentlicher Sex und ihr einziger Kitt die Liebe zu ihrem Sohn. Und jetzt, ohne Robbie, endete sie hier, vor dem schottischen Zivilgericht. Mit einem rechtskräftigen Scheidungsurteil. Einem Stück Papier, mit dem ein Kapitel ihres Lebens abgeschlossen war, an dem sie sechzehn Jahre lang geschrieben hatten.
Fin sah Mona an, wie schmerzlich es für sie war, und alles das, was er sein Leben lang bereut hatte, überfiel ihn mit großer Macht wieder.
Es dauerte am Ende nur wenige Minuten, die vielen Jahre in den Mülleimer der Geschichte zu befördern. Die guten und die schlechten. Die Kämpfe, das Lachen, den Streit. Sie traten hinaus in den strahlenden Sonnenschein, der auf das Kopfsteinpflaster und den Verkehrslärm in der Royal Mile fiel. Das Leben anderer Menschen zog an ihnen vorbei, während ihres nach einer Unterbrechung jetzt endgültig anhielt. Reglos standen sie wie zwei Gestalten im Zentrum eines Zeitraffer-Films, und der Rest der Welt wirbelte in schnellem Tempo um sie herum.
Sechzehn Jahre, und sie waren füreinander wieder Fremde, unsicher, was sie außer auf Wiedersehen sagen sollten, und fast zu scheu, es auszusprechen trotz der Schriftstücke, die sie in Händen hielten. Denn was gab es schon außer diesem Abschied? Fin öffnete seine Tasche und wollte die Urkunde hineinstecken, und seine fotokopierten Blätter rutschten aus der beigen Aktenmappe und verteilten sich um seine Füße. Er bückte sich schnell und sammelte sie auf, und Mona hockte sich neben ihn und half ihm.
Ihr Kopf drehte sich in seine Richtung, als sie ein paar Blätter in der Hand hielt. Sie sah wohl auf einen Blick, was für Papiere das waren. Ihre eigene Aussage befand sich darunter. Ein paar hundert Wörter, die schilderten, wie ein Leben genommen wurde und eine Beziehung darüber zerbrach. Die Skizze eines Gesichts, nach ihrer Beschreibung angefertigt. Für Fin zur Zwangsvorstellung geworden. Aber Mona blieb stumm. Sie erhob sich, reichte ihm die Blätter und sah zu, wie er sie wieder in die Tasche stopfte.
Als sie an der Straße ankamen und der Abschied nicht mehr zu umgehen war, sagte sie: »Bleiben wir in Kontakt?«
»Hätte das einen Sinn?
»Wohl nicht.«
Und mit diesen dürren Worten war alles, was sie im Laufe dieser vielen Jahre in ihre Beziehung investiert hatten, die gemeinsamen Erlebnisse, Freude und Schmerz, für immer verschwunden wie Schneeflocken auf einem Fluss.
Er warf ihr einen Blick zu. »Was willst du machen, wenn das Haus verkauft ist?«
»Ich gehe nach Glasgow zurück. Bleibe eine Weile bei meinem Vater.« Sie erwiderte seinen Blick. »Und du?«
Er zuckte mit den Achseln. »Ich weiß noch nicht.«
»O doch!« Es war fast eine Anschuldigung. »Du gehst auf die Insel.«
»Mona, genau das hab ich fast mein ganzes Erwachsenenleben vermieden.«
Sie schüttelte den Kopf. »Du tust es. Und das weißt du auch. Du kommst von der Insel nicht los. Sie hat die ganzen Jahre wie ein unsichtbarer Schatten zwischen uns gestanden. Und uns getrennt. Das hatten wir eben nicht gemeinsam.«
Fin holte tief Luft und spürte die Wärme der Sonne auf seinem Gesicht, als er für einen Moment den Kopf in den Nacken legte. Dann sah er sie wieder an. »Einen Schatten gab es, ja. Aber es war nicht die Insel.«
Natürlich hatte sie recht. Er konnte nirgendwo anders hin als zurück in den Mutterschoß. Zurück an den Ort, der ihn hervorgebracht, ihn sich entfremdet und schließlich vertrieben hatte. Es war der einzige Ort, an dem er eine Chance hatte, sich wiederzufinden. Bei seinen Leuten, die seine Sprache sprachen.
Er stand auf dem Vorderdeck der Isle of Lewis und verfolgte das sachte Auf und Ab, mit dem ihr Bug das Wasser des Minch durchpflügte, das heute ungewöhnlich ruhig war. Die Berge des Festlands waren schon lange verschwunden, und das Schiffshorn tutete einsam, als sie nun in den dichten Seenebel glitten, der die Ostküste der Insel im Frühjahr umhüllte.
Fin spähte angespannt in wirbelndes Grau, die Feuchte auf seinem Gesicht, und dann trat schließlich ein blasser Umriss aus dem Dunkel hervor. Ein bloßer Fleck an einem noch unkenntlichen Horizont, unheimlich und ewig während, als sei das Gespenst seiner Vergangenheit zurückgekehrt und suche ihn heim.
Seine Nackenhaare sträubten sich, als die Insel in dem Dunst allmählich Gestalt annahm. Das Gefühl, nach Hause zu kommen, war fast überwältigend.
Vier
Gunn saß am Schreibtisch und sah mit zusammengekniffenen Augen auf den Computerbildschirm. Mit halbem Ohr hörte er das Tuten eines Nebelhorns nicht weit draußen im Minch und wusste, die Fähre würde bald anlegen.
Gunn teilte sich das Büro mit zwei anderen Detectives. Von seinem Fenster im ersten Stock hatte er volle Sicht auf die andere Seite der Church Street, wo Blythswood Care einen Secondhandladen betrieb. Leib und Seele in christlicher Obhut. Wenn er den Hals reckte, konnte er sogar das indische Restaurant weiter oben in der Straße sehen, das Bangla Spice mit den Saucen, bei deren Farben einem das Wasser im Mund zusammenlief, und dem gebratenen Reis mit Knoblauch – unwiderstehlich. Bei dem Thema auf seinem Bildschirm kam ihm kein Gedanke an Essen.
Moorleichen, so las er bei Wikipedia, wurden bereits in Nordeuropa, Großbritannien und Irland gefunden. Es handelt sich dabei um menschliche Überreste oder vollständige Leichen, die im sauren Milieu von Hochmooren sowie durch die niedrigen Temperaturen und durch Sauerstoffabschluss erhalten blieben. Haut und Organe waren in Einzelfällen noch so intakt, dass man sogar Fingerabdrücke abnehmen konnte.
Ob das auch für die Leiche galt, die jetzt in dem Kühlfach im Autopsieraum des Krankenhauses lagerte? Wie schnell mochte die sich jetzt, da sie aus dem Moor geborgen war, zersetzen? Er scrollte weiter nach unten und betrachtete die Aufnahme des Kopfes, die von einem vor sechzig Jahren aus einem Moor in Dänemark ausgegrabenen Mann gemacht worden war: schokoladenbraunes Gesicht mit bemerkenswert feinen Zügen, eine Wange an die Nase gequetscht, weil der Mann auf der Seite gelegen hatte, orange, an Oberlippe und Kinn noch deutlich erkennbare Bartstoppeln.
»Ah, ja. Der Tollund-Mann.«
Als er aufblickte, sah Gunn einen großgewachsenen, drahtigen Mann mit schmalem Gesicht und einem Kranz dunklen, sich lichtenden Haars, der sich zum Bildschirm beugte, um besser sehen zu können.
»Bei der Karbondatierung seines Haars ergab sich ein Todeszeitpunkt um circa 400 vor Christus. Die Idioten, die damals die Autopsie gemacht haben, haben ihm den Kopf abgeschnitten und den Rest des Körpers weggeworfen. Die haben sonst bloß noch die Füße und einen Finger, in Formalin eingelegt.« Er griente und streckte die Hand aus. »Professor Colin Mulgrew.«
Gunn war von der Festigkeit des Händedrucks überrascht. Der Mann wirkte so schmächtig.
Fast so, als ob er die Gedanken des anderen erraten oder sein Zusammenzucken bemerkt hätte, lächelte Professor Mulgrew und sagte: »Pathologen brauchen eine kräftige Hand, Detective Sergeant. Sie müssen Knochen durchtrennen und Teile des Skeletts notfalls aufbiegen können. Sie wären erstaunt, wie viel Kraft man dafür benötigt.« In der Stimme des Mannes hörte Gunn einen Hauch von gepflegtem Irisch. Mulgrew wandte sich wieder dem Tollund-Mann zu. »Erstaunlich, nicht? Man konnte noch nach 2400 Jahren feststellen, dass er erhängt worden und dass seine letzte Mahlzeit eine Grütze aus Getreide- und Pflanzensamen gewesen war.«
»Waren Sie hier auch an der Leichenschau beteiligt?«
»Bewahre, nein. Das war lange vor meiner Zeit. Ich habe den Old-Croghan-Mann untersucht, den sie 2003 aus einem Moor in Irland gezogen haben. Der war aber fast genauso alt. Mit Sicherheit über zweitausend Jahre. Und für seine Zeit verdammt groß. Eins achtzig, stellen Sie sich das vor. Ein richtiger Riese.« Mulgrew kratzte sich am Kopf und griente. »Wie wollen wir Ihren Mann nennen? Lewis-Mann?«
Gunn fuhr auf seinem Stuhl herum und bedeutete Mulgrew, er möge sich setzen. Doch der Pathologe schüttelte den Kopf.
»Hab ich gerade stundenlang. Und auf den Flügen hier herauf hat man nicht viel Beinfreiheit.«
Gunn nickte. Da er selbst etwas kleiner war als der Durchschnitt, hatte ihm das nie Probleme bereitet. »Wie ist Ihr Old-Croghan-Mann gestorben?«
»Ermordet. Vorher aber gefoltert. Wir haben tiefe Einschnitte unter seinen Brustwarzen gefunden. Dann hat man ihm eine Stichverletzung in der Brust beigebracht, ihn enthauptet und seinen Körper halbiert.« Der Professor schlenderte zum Fenster und schaute beim Weitersprechen die Straße hinauf und hinab. »Eigentlich ein Rätsel, weil er sehr gepflegte Fingernägel hatte. Demnach kein Arbeiter. Ohne Zweifel war er Fleischesser, aber seine letzte Mahlzeit war eine Mischung aus Weizen und Buttermilch. Mein alter Freund Ned Kelly vom Irischen Nationalmuseum glaubt, er war eine Opfergabe, mit der man sich eine gute Ernte auf den königlichen Ländereien der Gegend und einen guten Milchertrag erbitten wollte.« Er drehte sich zu Gunn herum. »Das indische Restaurant da oben, taugt das was?«
Gunn zuckte mit den Achseln. »Es ist ganz gut.«
»Schön. Ich hab schon seit Ewigkeiten nicht mehr anständig indisch gegessen. Wo befindet sich Ihr Mann jetzt?«
»In einem Kühlfach in der Leichenhalle des Krankenhauses.«
Professor Mulgrew rieb sich die Hände. »Dann sollten wir hingehen und ihn uns anschauen, bevor er uns zerfällt. Und dann essen wir einen Happen, ja? Ich bin am Verhungern.«
Der Tote, der jetzt auf dem Obduktionstisch lag, wirkte seltsamerweise wie geschrumpft, wie weniger geworden, obwohl er kräftig gebaut war. Er hatte die Farbe von Schwarztee und sah aus wie eine Skulptur aus Harz.
Professor Mulgrew trug einen dunkelblauen Overall unter dem OP-Kittel, eine leuchtend gelbe OP-Maske bedeckte Mund und Nase. Darüber saß eine lächerlich große Schutzbrille mit perlmuttfarbenem Rand, die seinen Kopf kleiner erscheinen ließ, als er war, und den Mann in eine Karikatur seiner selbst verwandelte. Anscheinend ohne zu merken, wie kurios er aussah, ging er flink um den Tisch herum und nahm Maß. Die weißen Tennisschuhe des Professors steckten in grünen Plastiküberziehern.
Er trat an die Weißwandtafel und notierte die ersten Messergebnisse, ohne sich vom Quietschen seines Filzstifts beim Reden stören zu lassen. »Der arme Kerl wiegt läppische einundvierzig Kilo. Nicht gerade viel für einen Mann von eins dreiundsiebzig.« Über die Brille hinweg sah er zu Gunn hinüber. »Macht fünf Fuß acht nach Ihrer Zählung.«
»Sie meinen, er war krank?«
»Nein, nicht unbedingt. Er ist zwar gut erhalten, dürfte über die Jahre aber viel flüssiges Gewicht verloren haben. Nach meinem Eindruck ist das ein ziemlich gesundes Exemplar.«
»Wie alt?«
»Keine zwanzig oder nur knapp darüber, würde ich sagen.«
»Nein, ich meine, wie lange hat er im Torf gelegen?«
Professor Mulgrew zog eine Augenbraue hoch und neigte tadelnd den Kopf in Gunns Richtung. »Geduld, bitte. Ich bin kein Karbondatierungsautomat, verdammt noch mal, Detective Sergeant.«
Er kehrte zu der Leiche zurück und drehte sie auf die Vorderseite, beugte sich tief darüber und wischte braune und gelbgrüne Mooskrümel herunter.
»Wurden Kleidungsstücke bei dem Toten gefunden?«
»Nein, nichts.« Gunn trat näher an den Tisch heran, weil er hoffte, zu erkennen, was Mulgrews Aufmerksamkeit gefesselt hatte. »Wir haben das ganze Gebiet umgegraben. Keine Kleidung, keine Artefakte irgendwelcher Art.«
»Hm. In dem Fall würde ich sagen, dass er erst in eine Decke gewickelt und dann vergraben wurde. Und in der Decke dürfte er etliche Stunden gelegen haben.«
Gunns Augenbrauen schossen erstaunt in die Höhe. »Woraus schließen Sie das?«
»In den Stunden nach Eintritt des Todes, Mr Gunn, sammelt sich das Blut in den unteren Körperregionen und führt zu einer rötlich-violetten Verfärbung der Haut. Wir nennen das Post-mortem-Lividität. Wenn Sie sich seinen Rücken, das Gesäß und die Oberschenkel genau anschauen, werden Sie sehen, dass die Haut hier dunkler ist, die Lividität aber ein helleres blasses Muster aufweist.«
»Und das bedeutet?«
»Das bedeutet, dass er nach seinem Tod mindestens acht bis zehn Stunden auf dem Rücken lag, in eine grobe Decke eingewickelt, deren Gewebe ihr Muster in der dunkleren Verfärbung hinterlassen hat. Wir können ihn säubern und es fotografieren und, wenn Sie wollen, einen Künstler das Muster abzeichnen lassen.«
Mit einer Pinzette löste er mehrere Fasern, die noch an der Haut hafteten.
»Könnte Wolle sein«, sagte er. »Dürfte nicht schwer sein, das zu bestätigen.«
Gunn nickte zwar, beschloss aber, nicht zu fragen, welchen Sinn es haben sollte, Muster und Gewebe einer Decke zu identifizieren, die vor Hunderten, wenn nicht Tausenden von Jahren gewebt worden war. Der Pathologe widmete sich wieder der Untersuchung des Kopfes.
»Die Augen sind schon zu stark zersetzt, als dass sich die Farbe der Iris noch bestimmen ließe, und dieses rotbraune Haar erlaubt keinerlei Rückschlüsse darauf, welche Farbe es ursprünglich gehabt haben könnte. Das hat der Torf gefärbt, genauso wie die Haut.« Er bohrte ein wenig in den Nasenlöchern herum. »Aber das ist interessant«, sagte er und betrachtete seine Fingerspitzen in den Latexhandschuhen. »Er hat feinkörnigen silbrigen Sand in der Nase, und nicht gerade wenig. Und der sieht genau so aus wie der Sand in den Abschürfungen auf seinen Knien und auf dem Spann der Füße.« Mulgrew fuhr mit den Fingern zur Stirn und wischte mit sachten Bewegungen Schmutz von der linken Schläfe und aus dem Haaransatz. »Großer Gott!«
»Was ist?«
»Er hat eine gerundete Narbe an der linken Schädelvorderseite. Etwa zehn Zentimeter lang.«
»Eine Wunde?«
Der Professor schüttelte sinnend den Kopf. »Nein, das sieht aus wie eine Operationsnarbe. Wenn ich raten sollte, würde ich sagen, der junge Mann ist irgendwann einmal nach einer Kopfverletzung operiert worden.«
Gunn war verdutzt. »Aber das bedeutet, dass der Leichnam viel jüngeren Datums ist, als wir dachten, richtig?«
In Mulgrews Lächeln lag ein Ausdruck von Überlegenheit und Erheiterung. »Hängt davon ab, was Sie mit jung meinen, Detective Sergeant. Die Hirnchirurgie ist wahrscheinlich eine der ältesten praktizierten medizinischen Künste. Dafür gibt es umfangreiche archäologische Belege, die bis ins Neolithikum zurückreichen.« Nach kurzem Innehalten fügte er Gunn zuliebe hinzu: »Bis in die Steinzeit.«
Nun nahm er den Hals und die breite, tiefe Schnittwunde, die sich darauf befand, in Augenschein. Seine Messung ergab eine Länge von 18,4 Zentimetern.
»Ist er daran gestorben?«, fragte Gunn.
Nun seufzte Mulgrew. »Ich schätze, Detective Sergeant, Sie haben noch nicht an vielen Leichenschauen teilgenommen.«
Gunn errötete. »Vielen nicht, nein, Sir.« Er wollte nicht zugeben, dass es nur eine einzige gewesen war.
»Bevor ich ihn nicht aufgemacht habe, kann ich die Todesursache unmöglich bestimmen. Und sogar danach kann ich es nicht garantieren. Man hat ihm die Kehle durchgeschnitten, ja. Aber er hat auch mehrere Einstiche in der Brust und einen weiteren hinten an der Schulter. Er hat Abrasionen am Hals, die darauf schließen lassen, dass er ein Seil drum hatte, und ähnliche Abrasionen an den Hand- und Fußgelenken.«
»Als hätte man ihn an Händen und Füßen gefesselt?«
»Genau. Vielleicht hat man ihn gehängt, und die Abrasionen am Hals kommen daher, oder aber man hat ihn an dem Seil über einen Strand geschleift, was den Sand in der aufgeschürften Haut an seinen Knien und Füßen erklären würde. Jedenfalls ist es für Theorien über die Todesursache noch viel zu früh. Da kommt vieles in Betracht.«
Jetzt weckte eine dunklere Hautstelle am rechten Unterarm seine Aufmerksamkeit. Er strich mit seinem Tupfer darüber hinweg, drehte sich dann nach hinten, entnahm der Edelstahl-Spüle einen Scheuerschwamm und rubbelte die oberste Hautschicht ab. »Großer Gott!«
Gunn hielt den Kopf schief, um die Stelle besser sehen zu können. »Was ist?«
Professor Mulgrew schwieg noch eine ganze Weile, bevor er den Blick zu Gunn hob. »Warum waren Sie so scharf darauf, zu wissen, wie lange der Tote im Moor gelegen hat?«
»Damit ich den Fall vom Schreibtisch kriege und an die Archäologen weiterreichen kann.«
»Ich fürchte, daraus wird nichts, Detective Sergeant.«
»Und wieso nicht?«
»Weil dieser Tote nicht länger als sechsundfünfzig Jahre im Moor gelegen hat – äußerstenfalls.«
Gunn spürte, wie ihm die Zornesröte aufstieg. »Vor nicht mal zehn Minuten haben Sie noch gesagt, Sie wären kein Karbondatierungsautomat, verdammt noch mal.« Voller Genugtuung betonte er das verdammt noch mal. »Woher wollen Sie das wissen?«
Mulgrew lächelte. »Schauen Sie sich den Unterarm einmal genau an, Detective Sergeant. Wir haben hier, wie Sie bestimmt sehen werden, ein eher kunstlos tätowiertes Porträt von Elvis Presley über dem Schriftzug Heartbreak Hotel. Und dass Elvis vor Christus noch nicht gelebt hat, das weiß ich ziemlich genau. Als eingefleischter Fan kann ich Ihnen, ohne Widerspruch gewärtigen zu müssen, versichern, dass Heartbreak Hotel im Jahre 1956 Nummer eins der Hitparade war.«
Fünf
Nach der Mittagspause, in der er ein Zwiebel-Bhaji, ein scharfes Lammcurry mit gebratenem Knoblauchreis und zum Nachtisch eine Kulfi-Eiscreme verspeist hatte, benötigte Professor Mulgrew noch fast zwei Stunden, um die Autopsie zu Ende zu bringen. George Gunn aß derweil ein Käsesandwich in seinem Büro und hatte Mühe, es bei sich zu behalten.
Aufgrund der lederartigen Beschaffenheit der Haut hatte sich der Brustkorb mit einem einfachen Skalpell nicht öffnen lassen, sodass der Pathologe schließlich auf eine starke Schere zurückgreifen musste, um ihn aufzuschneiden. Danach wechselte er wieder zu seinem gewohnten Skalpell und hob die verbliebene Haut und die Muskeln vom Brustkorb ab.
Die Leiche lag nun geöffnet da wie etwas, was man sonst an Fleischerhaken hängen sieht, die inneren Organe entfernt und in Scheiben geschnitten. Hier handelte es sich jedoch um einen ehemals kräftigen und gesunden jungen Mann, und auch die Funde im Innern seines Leibs ließen keinen anderen Schluss zu als den, dass er durch einen brutalen Mord zu Tode gekommen war. Durch einen Mord, begangen von jemandem, der – denkbar war es – womöglich noch lebte.
»Ganz interessante Leiche, Detective Sergeant.« Schweißperlen hatten sich in seinen Stirnfalten gesammelt, aber Professor Mulgrew war mit Freude bei der Sache. »Seine letzte Mahlzeit war allerdings nicht so interessant wie meine. Bröckchen eines weichen Fleischs und feinste Partikel einer durchscheinenden faserigen Substanz, die an Fischgräten erinnert. Fisch und Kartoffeln vermutlich.« Er schmunzelte. »Jedenfalls freut es mich, dass ich Ihnen nun eine Hypothese dazu anbieten kann, wie er zu Tode kam.«
Gunn war, gelinde gesagt, überrascht. Nach allem, was ihm bisher zu Ohren gekommen war, legten Pathologen sich höchst ungern auf irgendetwas fest. Mulgrew jedoch machte den Eindruck eines Mannes, der von seinen Fähigkeiten überzeugt war. Er schloss den Brustkorb, klappte Haut und Gewebe über der Brust zur Schnittstelle zurück und wies mit dem Skalpell auf die Wunden.
»Er wurde viermal in die Brust gestochen. In Anbetracht der abwärts verlaufenden Stichkanäle würde ich meinen, dass sein Angreifer entweder deutlich größer war als er oder dass das Opfer kniete. Letzteres erscheint mir schlüssiger, aber dazu kommen wir noch. Die Verletzungen wurden ihm mit einem langen schmalen, zweiseitig geschliffenen Messer beigebracht. Mit einem Fairbairn-Sykes vielleicht oder einem anderen Stilett. Dieser Stich hier zum Beispiel« – er zeigte auf die oberste Stichwunde – »ist ungefähr fünf Achtel Zoll breit und läuft an beiden Enden spitz zu, was mit ziemlicher Sicherheit auf eine schmale, zweiseitig geschliffene Waffe hinweist. Er geht fünf Zoll tief und verläuft durch die linke Lungenspitze und den rechten Vorhof des Herzens bis zur Herzscheidewand. Ziemlich lang also, und dasselbe trifft auch für die anderen drei zu.«
»Und daran ist er gestorben?«
»Nun, tödlich wäre jeder der vier gewesen, nach ein paar Minuten, aber ich vermute, dass er an dem tiefen Halsschnitt gestorben ist, den man ihm beibrachte.« Mulgrew richtete den Blick darauf. »Er ist über sieben Zoll lang und verläuft vom linken Schläfenbein direkt unterhalb des Ohrs bis zum rechten großen Kopfwender.« Er blickte auf. »Wie Sie sehen.« Lächelnd wandte er sich wieder der Wunde zu. »Er durchtrennt die linke Drosselvene, verletzt die linke Halsschlagader und kerbt die rechte Drosselvene ein. An der tiefsten Stelle misst er gut drei Zoll und dringt sogar ins Rückgrat ein.«
»Ist das wichtig?«
»Meiner Ansicht nach deuten Winkel und Tiefe darauf hin, dass der Schnitt von hinten ausgeführt wurde und fast sicher mit einer anderen Waffe. Dafür spricht auch der Einstich am Rücken. Diese Wunde ist anderthalb Zoll breit, hat gerade Austrittslinien und läuft innen spitz zu. Was auf ein langes, nur einseitig geschliffenes Messer schließen lässt, mit dem sich so tiefe Schnitte besser ausführen lassen.«
Gunn legte die Stirn in Falten. »Wie darf ich das verstehen, Professor? Sie sagen, der Mörder hat zwei Waffen verwendet, ihm mit der einen in die Brust gestochen und ihn anschließend von hinten gepackt und mit der anderen die Kehle durchgeschnitten?«
Ein nachsichtiges Lächeln zog unter der Maske über das Gesicht des Pathologen, für Gunn nur sichtbar an den Augen, die hinter der riesigen Brille blitzten. »Nein, Detective Sergeant. Ich sage, dass es zwei Angreifer waren. Einer hält ihn von hinten fest und zwingt ihn auf die Knie, während der andere von vorn auf die Brust einsticht. Der Stich in den Rücken war vermutlich ein Versehen, als der erste Angreifer Anstalten machte, dem Opfer die Kehle durchzuschneiden.«
Er ging um den Tisch herum zum Kopf des Toten und klappte Haut und Fleisch wieder zum ersten Schnitt über Gesicht und Schädel zurück.
»Ich fasse für Sie noch einmal zusammen, welches Bild sich insgesamt ergibt: Dieser Mann war an Handgelenken und Knöcheln gefesselt. Er hatte ein Seil um den Hals. Hätte man ihn daran aufgehängt, würden die Abrasionen schräg nach oben zum Aufhängepunkt zulaufen. Aber das ist nicht der Fall. Ich vermute deshalb, dass man ihn an dem Seil über einen Strand geschleift hat. Er hat feinen silbrigen Sand in Nase und Mund und in der offenen Haut an den Knien und den Oberseiten der Füße. Irgendwann hat man ihn gezwungen, sich niederzuknien, und mehrmals auf ihn eingestochen und ihm zuletzt die Kehle durchgeschnitten.«
Das Bild, das der Pathologe mit seinen Worten zeichnete, stand Gunn plötzlich lebhaft vor Augen. Er wusste nicht, wie er darauf kam, sah aber eine nächtliche Szene: Das phosphoreszierende Meer schwappt über den verdichteten Sand, der im Mondschein silbrig leuchtet. Und dann wird Blut zu weiß schäumendem Karmesin. Fast mehr als alles andere aber entsetzte ihn der Gedanke, dass dieser brutale Mord hier stattgefunden hatte, auf der Insel Lewis, wo es in den letzten hundert Jahren bisher nur zwei Morde gegeben hatte.
Er sagte: »Ist es möglich, ihm Fingerabdrücke abzunehmen? Wir werden den Mann identifizieren müssen.«
Professor Mulgrew antwortete darauf nicht gleich. Er war damit beschäftigt, die Haut vom Schädel abzuheben, ohne sie zu zerreißen. »Die ist so unfassbar trocken«, sagte er. »Bröcklig wie sonst was.« Er blickte kurz auf. »Die Fingerspitzen sind durch den Flüssigkeitsverlust ein bisschen verschrumpelt, aber ich kann etwas Formalin injizieren und sie rehydrieren, damit sollten Sie passable Abdrücke bekommen. Bei der Gelegenheit könnten Sie auch gleich eine DNA-Probe nehmen.«
»Der Polizeiarzt hat schon Proben zur Analyse geschickt.«
»Oh, tatsächlich?« Erfreut sah Professor Mulgrew nicht aus. »Unwahrscheinlich natürlich, dass die bei der Aufklärung helfen, aber man weiß ja nie. Ah …« Seine Aufmerksamkeit wurde plötzlich vom Schädel beansprucht, der unter der abgelösten Kopfhaut nun frei lag. »Interessant.«
»Was ist?« Widerstrebend trat Gunn näher.
»Unterhalb der Operationsnarbe, die unser Freund hier hat … ist eine kleine Metallplatte zum Schutz des Gehirns eingesetzt.«
Gunn sah eine rechteckige, mattgraue Platte von etwa zwei Zoll Länge, die an beiden Enden ein Loch hatte und mit Metallfäden in den Schädel eingenäht war. Stellenweise hatte sich eine Schicht Narbengewebe darüber gebildet.
»Eine Verletzung. Und höchstwahrscheinlich ein leichter Gehirnschaden.«
Auf Mulgrews Wunsch hin ging Gunn hinaus und verfolgte durch ein Fenster zum Autopsieraum, wie der Professor eine oszillierende Säge um die Schädeldecke herumführte und das Gehirn heraushob. Als Gunn wieder hineinging, untersuchte der Professor es in der Edelstahl-Schale, in der er es deponiert hatte.
»Ja … dachte ich mir’s doch. Hier …« Er wies mit dem Finger auf die Stelle. »Eine zystische Enzephalomalazie des linken Frontallappens.«
»Und das bedeutet?«
»Das bedeutet, mein Freund, dass dieser arme Kerl nicht viel Glück hatte. Er hatte eine Kopfverletzung, die den linken Frontallappen beschädigt hat und nach der er wohl … wie soll ich sagen … nicht mehr der Hellste war.«
Er blickte wieder auf das Gehirn und schälte mit feinen Bewegungen des Skalpells das Gewebe ab, das sich wie ein Film über die Metallplatte gelegt hatte.
»Wenn mich nicht alles täuscht, ist das Tantal.«
»Was ist das?«
»Ein sehr korrosionsbeständiges Metall, das in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in der Kranioplastie Einzug hielt. Wurde im Zweiten Weltkrieg ziemlich häufig zur Reparatur von Schrapnellwunden verwendet.« Er beugte sich weiter nach unten und schabte noch tiefer in das Metall hinein. »Gut gewebeverträglich, hat aber häufig zu starken Kopfschmerzen geführt. Das hat mit der elektrischen Leitfähigkeit zu tun. Wurde in den sechziger Jahren durch die dann entwickelten Kunststoffe abgelöst. Heute wird es hauptsächlich in der Elektronik verwendet. Aha!«
»Was ist?« Gunn überwand seine natürliche Zurückhaltung und trat noch näher heran.
Doch Professor Mulgrew wandte sich ab und kramte in seinem Pathologenwerkzeug, das auf der Arbeitsfläche neben dem Spülbecken lag. Er kam mit einem drei Quadratzoll großen Vergrößerungsglas wieder, das er mit Daumen und Zeigefinger hielt und über die implantierte Platte senkte.
»Dachte ich mir’s doch.« Ein Hauch von Triumph lag in seinen Worten.
»Was denn?« Gunns Frustration war unüberhörbar.
»Die Hersteller dieser Platten haben oft Seriennummern eingraviert. Und in diesem Fall sogar ein Datum.« Er trat zur Seite, forderte Gunn auf, selbst hinzusehen.
Gunn nahm das Vergrößerungsglas, hielt es behutsam über das Gehirn und beugte sich mit zusammengekniffenen Augen tief darüber. Unter einer zehnstelligen Seriennummer standen die römischen Ziffern MCMLIV.
Der Pathologe strahlte. »1954, falls Sie es noch nicht heraushatten. Ungefähr zwei Jahre, bevor er sein Elvis-Tattoo bekam. Und dem Gewebewachstum nach zu urteilen drei, vielleicht vier Jahre, bevor er am Strand ermordet wurde.«
Sechs
Zuerst war Fin vollkommen desorientiert. In die Geräusche von Wind und Wasser, die er in den Ohren hatte, mischte sich ein stoßweises Hämmern. Ihm war heiß, er schwitzte unter der Decke, aber sein Gesicht und seine Hände waren kalt. Ein seltsames blaues Licht durchdrang die Helle, die ihn regelrecht blendete, als er die Augen aufschlug. Es dauerte eine geschlagene halbe Minute, bis er wieder wusste, wo er war. Das weiße Innenzelt, sah er, atmete stoßweise ein und aus wie ein Läufer, der keuchend das Ziel erreicht hat. Um ihn herum das reinste Schlachtfeld: Kleidung, eine nur halb ausgepackte Reisetasche aus Leinwand, sein Laptop und verstreute Papiere.
In dem schon schwindenden Licht hatte er eine Stelle am Boden gefunden, die ihm eben genug schien, um darauf sein Zweimannzelt aufzuschlagen. Jetzt aber merkte er, dass sie wie das ganze Stück Land doch stark in Richtung Klippen und Meer abfiel. Er setzte sich auf, horchte einen Moment auf die Zeltleinen, die ächzend an ihren Heringen zerrten, schlüpfte aus seinem Schlafsack und streifte sich frische Sachen über.
Das Tageslicht blendete ihn, als er den Reißverschluss des Außenzelts aufzog und auf den Hügel hinauskroch. In der Nacht war Regen gefallen, doch der Wind hatte das Gras schon wieder getrocknet. Er setzte sich barfuß hinein, zog Socken an und verdrehte die Augen zum Schutz vor der grellen Sonne auf dem Ozean, einem ausgebrannten leuchtenden Ring, der noch einmal kurz aufflackerte, bevor die Wolkenlücke sich darüber schloss, als hätte man einen Lichtschalter ausgeknipst. Fin saß da, die Knie angezogen, die Arme darauf abgelegt, und atmete die Salzluft ein, die nach Torfrauch und feuchter Erde roch. Der an seinen kurzen blonden Locken zerrende Wind brannte in seinem Gesicht und sandte einen wunderbaren Schauder durch seinen Leib: am Leben sein!
Hinter seiner linken Schulter sah Fin die Ruine dessen, was einmal das Gehöft seiner Eltern gewesen war: ein altes Whitehouse, dahinter die Überreste des Blackhouse, in dem seine Vorfahren über Jahrhunderte gelebt hatten. Dort hatte er als Kind gespielt, fröhlich und behütet, ohne einen Gedanken daran, was das Leben für ihn bereithalten mochte.
Noch weiter hinten wand sich die Straße hügelabwärts zwischen der Ansammlung verschiedenster Häuser hindurch, die das Dorf Crobost bildete. Rote Blechdächer auf alten Webschuppen, Häuser, mit weißem Mörtel gemauert oder mit rosa Kalkputz versehen, in unregelmäßigen Abständen stehende Zaunpfähle, Wollbüschel, die an Stacheldraht festhingen und im Wind flatterten. Die schmalen Streifen Land, die zum Gehöft eines Crofters gehörten, verliefen ebenfalls hügelabwärts zu den Klippen, manche für den Anbau von einfachen Feldfrüchten oder von Getreide kultiviert, wieder andere reine Weideflächen. Die entsorgte Technik vergangener Jahrzehnte, verrostete Traktoren und kaputte Erntemaschinen, stand auf überwachsenen Grundstücken herum, zerfallende Symbole einstiger Hoffnung auf Wohlstand.
Hinter der Biegung sah Fin das dunkle Dach der Croboster Kirche, hoch überragte sie die Silhouette der Häuser und das Leben der Menschen, auf die ihr Schatten fiel. Jemand hatte Wäsche am Pfarrhaus aufgehängt, weiße Laken flatterten im Wind wie Signalflaggen, die zu gleichen Teilen Gottes Lob und Furcht erheischten.
Fin verachtete die Kirche und alles, wofür sie stand. Die Vertrautheit des Gebäudes hatte aber auch etwas Tröstliches. Dies war schließlich sein Zuhause. Und er spürte, wie seine Stimmung sich hob.
Der Wind trug seinen Namen heran, als Fin seine Stiefel anzog, und als er sich umwandte und aufrappelte, sah er einen jungen Mann an dem Tor des Bauernhauses stehen, an dem er am Abend zuvor sein Auto abgestellt hatte. Er setzte sich in Bewegung, watete durch das Gras und erkannte im Näherkommen den Zwiespalt im Lächeln seines Besuchers.
Der junge Mann war ungefähr achtzehn, knapp halb so alt wie Fin. Er hatte sich das blonde Haar mit Gel zu Stacheln geformt, und seine kornblumenblau leuchtenden Augen glichen so sehr denen seiner Mutter, dass Fin Gänsehaut auf den Armen bekam. Für einen Moment schwiegen sie verlegen und taxierten einander, dann streckte Fin die Hand aus, und der Junge schüttelte sie mit kurzem, festem Druck.
»Hallo, Fionnlagh.«
Der Junge wies mit einer knappen Kopfbewegung auf das hellblaue Zelt. »Auf der Durchreise?«
»Provisorische Unterkunft.«
»Ist eine Weile her.«
»Ja.«
Fionnlagh hielt kurz inne, um seinen Worten Nachdruck zu verleihen. »Neun Monate.« Der vorwurfsvolle Beiklang war nicht zu überhören.
»Ich musste ein ganzes Leben zusammenpacken.«
Fionnlagh neigte den Kopf ein wenig zur Seite. »Heißt das, du bleibst für immer hier?«
»Vielleicht.« Fin ließ den Blick über das Croft schweifen. »Es ist mein Zuhause. Dahin kommt man, wenn man nirgendwohin sonst gehen kann. Ob ich bleibe oder nicht … wird sich noch zeigen.« Er heftete seine grünen Augen wieder auf den Jungen. »Wissen es die Leute schon?«
Sie blickten einander sekundenlang in einem Schweigen an, befrachtet mit Geschichte. »Die wissen nur eines: dass mein Vater vorigen August beim Guga-Fang draußen auf An Sgeir umgekommen ist.«
Fin nickte. »Verstehe.« Er trat zur Seite, öffnete das Tor und ging auf dem zugewachsenen Weg dorthin, wo einmal der Eingang zum alten Whitehouse gewesen war. Die eigentliche Tür war längst nicht mehr vorhanden, am Stein hafteten nur noch ein paar verfaulte Reste des Unterbalkens. Hier und da kündeten abgeplatzte Reste von der violetten Farbe, mit der sein Vater einmal alle Holzoberflächen gestrichen hatte, sogar die Böden. Das Dach war im Wesentlichen noch intakt, die Balken aber waren morsch, und Regenwasser hatte Streifen an sämtlichen Wänden hinterlassen. Die Dielenbretter waren bis auf ein paar störrische Schwellen verschwunden. Es war nur noch die Hülle eines Hauses, in dem nichts mehr an die Liebe erinnerte, die es einst gewärmt hatte. Fin hörte Fionnlagh hinter sich lachen und wandte sich um. »Ich werde das Haus entkernen. Und es von innen heraus wieder aufbauen. Vielleicht möchtest du mir in den Sommerferien ja ein bisschen zur Hand gehen.«
Fionnlagh zuckte gleichgültig mit den Achseln. »Mal sehen.«
»Gehst du im Herbst an die Universität?«
»Nein.«
»Warum nicht?«
»Ich muss mir einen Job suchen. Ich bin jetzt Vater. Ich trage Verantwortung für ein Kind.«
Fin nickte. »Wie geht es der Kleinen?«
»Gut. Danke der Nachfrage.«
Fin überging den Sarkasmus. »Und Donna?«
»Sie wohnt mit ihr zu Hause bei ihren Eltern.«
Fin runzelte die Stirn. »Und du?«
»Mum und ich wohnen weiter in dem Bungalow unten am Hügel.« Er wies mit dem Kinn zu dem Haus hinüber, das Marsaili von Artair geerbt hatte. »Reverend Murray erlaubt mir nicht, dass ich die beiden im Pfarrhaus besuche.«
Fin konnte gar nicht glauben, was er da hörte. »Wieso nicht? Du bist schließlich der Vater des Kindes.«
»Der aber weder seine Tochter noch deren Mutter ernähren kann. Ab und zu kann Donna sich mit ihr rausschleichen und mich im Bungalow besuchen, aber meistens müssen wir uns in der Stadt treffen.«
Fin schluckte seinen Zorn hinunter. Es hatte keinen Sinn, ihn Fionnlagh jetzt spüren zu lassen. Das konnte warten. »Ist deine Mutter zu Hause?« Die Frage war unverfänglich, und doch wussten beide, was darin alles mitschwang.
»Sie war in Glasgow, hat die Aufnahmeprüfung für die Universität gemacht.« Fionnlagh entging nicht, wie überrascht Fin war. »Hat sie dir das nicht erzählt?«
»Wir hatten keinen Kontakt.«
»Oh.« Sein Blick wanderte wieder über den Hügel zum Bungalow der Macinnes. »Ich dachte immer, dass ihr, du und Mum, vielleicht wieder zusammenkommt.«
Fins Lächeln hatte einen Zug von Traurigkeit und vielleicht von Bedauern. »Mit Marsaili und mir hat es schon damals nicht geklappt, Fionnlagh. Warum sollte es heute anders sein?« Er zögerte. »Ist sie noch in Glasgow?«
»Nein. Sie ist zeitiger zurückgekommen. Heute Vormittag mit dem Flugzeug. Ein familiärer Notfall.«
Sieben
Die reden im Flur, als ob ich taub wäre. Oder gar nicht da. Oder tot. Manchmal wünschte ich, ich wär’s.
Und warum ich den Mantel anziehen sollte, weiß ich auch nicht. Es ist doch warm im Haus. Da braucht man keinen Mantel. Und keine Mütze. Meine schöne weiche alte Mütze. Die hat mir jahrelang den Kopf gewärmt.
Neuerdings bin ich, wenn ich aus dem Schlafzimmer komme, nie sicher, welche Mary ich vorfinde. Manchmal ist es die gute Mary. Manchmal ist es die böse Mary. Sie sehen gleich aus, sind aber zwei verschiedene Menschen. Heute früh war es die böse Mary. Die redet immer so laut, sagt mir, was ich machen soll, verlangt, dass ich den Mantel anziehe. Hier sitze. Und warte. Worauf?
Und was ist in dem Koffer? Meine Sachen, hat sie gesagt. Aber was hat sie damit gemeint? Wenn sie meine Anziehsachen meint, davon habe ich einen ganzen Schrank voll, und die würden da auch niemals reinpassen. Genauso wie meine vielen Papiere. Die Aufzeichnungen, zum Teil Jahre alt. Die Fotografien. Alles. Das würde doch niemals in so einen Koffer passen. Vielleicht fahren wir in Urlaub.
Jetzt höre ich Marsailis Stimme. »Mum, das ist einfach nicht fair!«
Mum. Natürlich. Ich vergesse immer wieder, dass Mary ihre Mutter ist.
Und Mary sagt, natürlich auf Englisch, denn Gälisch hat sie nie gelernt: »Fair? Glaubst du, mir gegenüber ist es fair, Marsaili? Ich bin siebzig Jahre alt. Ich halte das nicht mehr aus. Zweimal die Woche macht er das Bett schmutzig, mindestens. Wenn er allein rausgeht, verläuft er sich. Wie ein blöder Hund. Man kann sich einfach nicht auf ihn verlassen. Die Nachbarn bringen ihn wieder heim. Sag ich weiß, sagt er schwarz. Sag ich schwarz, sagt er weiß.«
Ich sage nie schwarz oder weiß. Wovon spricht sie? Es ist die böse Mary, die so redet.
»Mum, du bist achtundvierzig Jahre verheiratet.« Marsailis Stimme wieder.
Und Mary sagt: »Er ist nicht der Mann, den ich geheiratet habe, Marsaili. Ich lebe mit einem Fremden. Wegen allem gibt es Streit. Er will einfach nicht einsehen, dass er Demenz hat, dass er sich nichts mehr merken kann. Immer ist es meine Schuld. Er macht irgendwas und leugnet es dann. Vorgestern hat er das Küchenfester eingeschlagen. Ich weiß nicht, warum. Hat einfach mit dem Hammer draufgehauen. Und gesagt, er muss den Hund reinlassen. Marsaili, wir haben keinen Hund mehr gehabt, seit wir von der Farm weggezogen sind. Fünf Minuten später fragt er dann, wer das Fenster eingeschlagen hat, und wenn ich ihm sage, er selber, sagt er, nein, das war er nicht. Das muss ich gewesen sein. Ich! Marsaili, ich hab’s satt.«
»Wie wäre es mit Tagespflege? Er geht doch schon dreimal die Woche dorthin, oder? Vielleicht können wir sie dazu bewegen, ihn für fünf zu nehmen oder sogar für sechs.«
»Nein!« Mary schreit es jetzt. »Ihn in die Tagespflege geben, macht es bloß noch schlimmer. Alle Tage für ein paar Stunden Normalität, ich hab das Haus für mich, denke aber an nichts anderes, als dass er in ein paar Stunden heimkommt und mir das Leben wieder zur Hölle macht.«
Ich höre ihr Schluchzen. Schreckliche stoßweise Schluchzer. Jetzt bin ich nicht sicher, ob das die böse Mary ist oder nicht. Es ist nicht schön, dass sie weint. Das bringt mich ganz durcheinander. Ich beuge mich vor, will in den Flur linsen, aber sie stehen nicht in meiner Blickrichtung. Ich sollte wahrscheinlich hingehen und fragen, ob ich helfen kann. Aber die böse Mary hat gesagt, ich soll hier sitzen bleiben. Marsaili wird sie schon trösten. Was kann sie nur so aufgebracht haben? Ich erinnere mich noch an den Tag, an dem wir geheiratet haben. Ich war gerade mal fünfundzwanzig. Und sie ein schmales Ding von zweiundzwanzig. Geweint hat sie damals auch. Ein hübsches Mädchen war sie, doch, ja. Engländerin. Aber dafür konnte sie nichts.
Das Weinen hat endlich aufgehört. Und ich muss die Ohren spitzen, um Marys Stimme zu hören. »Ich will ihn hier raus haben, Marsaili.«
»Mum, wie soll das gehen? Wo soll er denn hin? Ich bin nicht darauf eingerichtet, ihn zu betreuen, und ein privates Pflegeheim können wir uns nicht leisten.«
»Das ist mir egal.« Ihre Stimme klingt jetzt richtig hart. Egoistisch. Voller Selbstmitleid. »Du musst dir etwas einfallen lassen. Ich will ihn jedenfalls hier raus haben. Sofort.«
»Mum …«
»Er ist angezogen und gehfertig, und seine Tasche ist gepackt. Ich habe mich entschieden, Marsaili. Ich behalte ihn keine Minute länger hier.«
Jetzt ist lange Schweigen. Über wen haben die bloß gesprochen?
Und mit einem Mal steht, als ich hochsehe, Marsaili in der Tür und sieht zu mir herüber. Ich hab sie gar nicht hereinkommen hören. Meine Kleine. Ich liebe sie mehr als alles andere auf der Welt. Das muss ich ihr mal sagen. Aber sie sieht müde und blass aus, das Dingelchen. Und ihr Gesicht ist nass von Tränen.
»Brauchst nicht zu weinen«, sage ich zu ihr. »Ich fahre in Urlaub. Ich bin nicht lange weg.«
Acht
Fin stand da und betrachtete das Ergebnis seiner Arbeit. Er hatte beschlossen, für den Anfang das ganze verfaulte Holz herauszureißen, das jetzt, zu einem großen Haufen getürmt, im Hof zwischen dem Haus und der alten Steinhütte mit dem rostigen Blechdach lag. Wenn es lange genug nicht regnete, würde der Wind es trocknen, und er konnte es abdecken und für das Novemberfeuer aufheben.
Die Mauern und Fundamente waren noch ganz solide, aber er würde das Dach abdecken und erneuern müssen, damit das Gebäude wasserdicht wurde und innen austrocknen konnte. Als Erstes musste er die Schieferplatten herunterholen und stapeln. Aber dafür brauchte er eine Leiter.
Der Wind peitschte und blähte seinen blauen Overall, zerrte an seinem karierten Hemd und trocknete ihm den Schweiß im Gesicht. Fin hatte fast vergessen, wie erbarmungslos der sein konnte. Wer hier lebte, merkte ihn erst, wenn er einmal aufhörte. Fin schaute über den Hügel nach unten zu Marsailis Bungalow, aber es stand kein Auto davor, also war sie noch nicht zurück. Fionnlagh war in der Schule in Stornoway. Er würde später hinuntergehen und fragen, ob er sich eine Leiter borgen konnte.