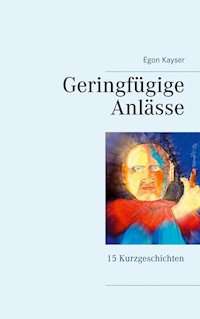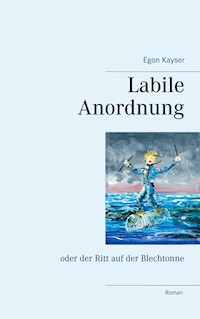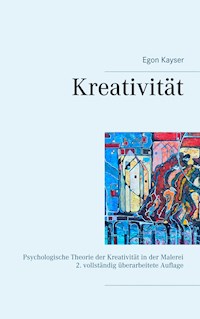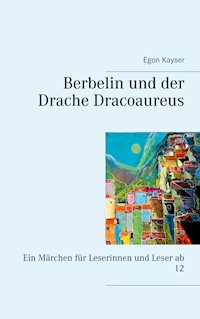
9,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Berbelin wuchs als Königstochter in gesicherten Verhältnissen auf. Aber elterliche Liebe gab es nur bei vollkommener Anpassung an elterliche Forderungen und höfische Etikette. Zuwendung fand sie unerlaubterweise bei einem jungen Schreinerlehrling. Als schließlich der König eine Eheschließung mit einem Adligen seiner Wahl anordnete, kam es zu einem Bruch der scheinbar so fest gefügten Ordnung. Es entwickelte sich ein Machtkampf zwischen Königshaus und Prinzessin, in dem beide Seiten vor nichts zurückschreckten, auch nicht vor dem Einsatz des Drachen Dracoaureus, der, hinterlistig, gewinnsüchtig und ohne jede Moral, durch Einsatz von Feuer und Schrecken jedem Herrn diente, wenn der genug bezahlte. Als schließlich alles, auch Berbelin, erschöpft oder zerstört zusammenzubrechen drohte, kam es zu einer unerwarteten Wende.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 608
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhaltverzeichnis
Eine Vorbemerkung über liebliche Prinzessinnen und dunkle Abgründe, über denen die Drachen kreisen
Erster Teil
Der Tag, an dem Berbelins Kindheit endete
Vorsorge
Aufgehoben sein und man selbst sein
Sewolt und die „andere“ Grenze
Verliebte Mädchen am 16. Geburtstag
Der Drache
Blick in die Seele Berbelins
Sewolts Besuchsversuch
Der große und der kleine Schatz
Es wird ernst
Sewolt und der Meister
Planung des Fests: Brautkleid, Festessen und Festmusik
Am Traualtar
Zweiter Teil
Amtliche Verlautbarung und Flucht
Kleine Drachenkunde
Sewolt, Hieronymus und die kleinen Schwächen des Drachen
Im neuen Zuhause
Drachengift
Des Meisters Bußgang
Intrigen, Gerüchte, Schäden: Der Wettstreit der Bosheiten wird fortgesetzt
Ein Friedensvertrag
Ein neuer Friede, eine neue Liebe
Herodes
Gold! Gold?
Aufbesserung des Einkommens und eine Frage des moralischen Urteils
Die Schlacht des Königs gegen den Drachen
Dritter Teil
Berbelin plant die Rückkehr ins Schloss
Rückkehr als eine Neue
Mutter, Graf und Zofe
Die dunkle Seite des Schlosses
Einstellung eines Spions
Neues Glück
Ohnmacht und Wut
Kriegsgeschäft
Neue Anordnungen
Ach ja, der Beichstuhl!
Alle Abbildungen: Egon Kayser, Öl bzw. Acryl auf Leinwand
für Anjaauch mit Dank für wertvolle Rückmeldungen zur 1. Fassung
Eine Vorbemerkung über liebliche Prinzessinnen und dunkle Abgründe, über denen die Drachen kreisen
Es war einmal eine Königstochter mit dem seltenen Namen Berbelin, und es war einmal ein Drache namens Dracoaureus. Dies ist die wunderliche Geschichte der beiden und einiger Anderer.
Natürlich gibt es Drachen. Anders als vielleicht im fernen Osten sind sie in unseren Breiten nicht unbedingt freundlicher Natur. Doch wir können beruhigt sein: Üblicherweise besiegen Helden Drachen und erobern sich dadurch die Gunst besonders schöner Prinzessinnen. Das muss allerdings nicht auf jeden einzelnen Fall zutreffen, zumal es bisweilen den Prinzessinnen gelingt, Drachen in ihre Herzens- und Geschäftsangelegenheiten, seien sie heller oder dunkler Natur, einzuspinnen. In solchen Fällen kann ihnen kaum daran gelegen sein, dass ein kühner Recke mit scharfer Klinge ihrem geflügelten Geschäftspartner den Kopf vom Leibe trennt.
So viel erst einmal zu den Drachen. Und Prinzessinnen? Was ist mit den Königstöchtern, deren Eltern in erster Linie Sklaven der höflichen Etikette sind und allenfalls in zweiter Linie einmal einen liebevollen und nicht nur berechnenden Blick auf ihre Töchter werfen? Bräuchten diese Prinzessinnen nicht stattdessen ganz und gar liebevolle Mütter und zugewandte Väter?
Nun, ersatzweise werden diese Prinzessinnen mit Ammen und Zofen umgeben. Diese absolvieren dabei eine gefährliche Gratwanderung: Einerseits müssen sie den Prinzessinnen jeden Wunsch von den Augen ablesen, anderseits dürfen sie ihnen keineswegs alles durchgehen lassen. Vielleicht gelingt ihnen diese Gratwanderung. Vielleicht gelingt es ihnen sogar, in den Seelen der ihnen Anvertrauten die Grundlage für das Wesentliche in ihrem Leben zu schaffen, nämlich sie für die Liebe zu öffnen. Aber der unvoreingenommene Beobachter bleibt skeptisch. Es ist zweifelhaft, ob durch diesen Ersatz die kindliche Sehnsucht nach einer guten Mutter, nach guten Eltern, gestillt werden kann. Und uns als Außenstehende treibt doch die Befürchtung um, dass diese Prinzessinnen den Schmerz ihrer ungestillten Wünsche und Sehsüchte nur verwinden können, indem sie sich innerlich verhärten - und dadurch ihren Eltern ähnlich werden. Dass man sich aus Enttäuschung, Schmerz, Kränkung verhärtet: Vielleicht ist das ja sogar bei uns allen in mal milderer und mal ausgeprägterer Weise so, selbst wenn wir keine Prinzessinnen sein sollten.
Zwei Seelen wohnen schließlich in der Brust von Berbelin, der Prinzessin unserer Geschichte: die Fähigkeit zur Liebe und die zu unglaublicher Härte. Müssen wir nicht befürchten, dass das eine in das andere, die Liebe in Hass und Zerstörung, umschlägt? Und wenn sich das Herz verhärtet hat, um nicht mehr zu leiden, und all der Schaden angerichtet ist, zu dem ein Mensch fähig ist: Kann diese Person dann jemals zurückfinden in die Liebe? Oder bleibt sie auf immer verloren und zieht immer mehr die ihr Anvertrauten und schließlich auch diejenigen, die helfen wollen, mit sich hinab in einen bodenlosen Abgrund, über dem nur noch die Drachen kreisen?
Werfen wir also einen Blick auf einen solchen Fall, und das ist hier der der Prinzessin Berbelin und ihr bestürzender Lebensweg. Und sie wird auf ihrem Wege sozusagen umflattert von dem listigen und in der Soinne buntschimmernden Drachen Dracoaureus.
Erster Teil
Der Tag, an dem Berbelins Kindheit endete
Es war also einmal eine Königstochter. Sie trug den besonderen Namen Berbelin. In den letzten Monaten war sie sehr hochgeschossen. Inzwischen überragte die Vierzehnjährige gar ihren Vater Friedrich Theodor III., den König von Sylonien, fast um Haupteslänge. Daraus allein lässt sich nicht unbedingt schließen, dass Friedrich Theodor kein großer König war. Was sich über ihn sagen lässt, ist, dass er ein jähzorniger, stolzer und viel beschäftigter Mann war, der in seiner Regentschaft einen Weg sah, Vermögen und Ansehen zu erwerben. Sein Königreich betrachtete er als sein persönliches Eigentum. So hatten es allerdings auch seine Ahnen schon immer getan. Um ein Königreich zu sein war das Land eigentlich ein wenig zu klein, und tatsächlich war es ursprünglich ein Fürstentum gewesen. Ein Ahnherr Friedrich Theodors hatte aber immer wieder den Eindruck gehabt, „Fürst“ klinge ein wenig geringer als er sich fühlte, und so ließ er öffentlich auf allen Marktplätzen und brieflich an alle seine Verwandten, an alle ihm bekannten Adligen sowie an seine Geschäftspartner kundtun, dass Sylonien nunmehr ein Königreich und er der König sei. Seiner Frau hatte das auch gefallen, allerdings hatte sie darauf bestanden, nunmehr nicht etwa „Prinzessin von Sylonien“, sondern eine Königin zu heißen. Ihr Gatte, froh, dass sie mitspielte, hatte es damals großzügig erlaubt. Es mag sein, dass nicht allen Menschen im Lande und nicht allen Adligen, die davon hörten, der Ehrgeiz des Herrschers angenehm war. Aber man gewöhnte sich daran, dass man es nun in Sylonien mit König, Königin und Königreich zu tun hatte. So war es gekommen, dass nun auch Friedrich Theodor III. König war. Er wohnte mit Frau und Tochter – abgesehen einmal von all den Bediensteten und Staatsbeamten – in einem recht umfänglichen und in seinem tadellosen baulichen Zustand durchaus beeindruckenden weißen Schloss mit sieben Türmchen und umgeben von einem reinlichen und schön gestalteten Park inmitten einer Landschaft mit sanften Hügeln, nährstoffreichen Wiesen, üppigen Äckern und Wäldern, und das Land lag genauso anmutig unter der gelb-roten Sonnenkugel, wie das Bild auf der folgenden Seite es zeigt.
Dem Kind, Berbelin, war all dies zugänglich; allerdings verlangten die Eltern, dass sie außerhalb ihrer Sichtweite von Luisa begleitet wurde, die von Berbelins viertem Geburtstag an ihre persönliche Zofe war. Luisa war eine freundliche, sportliche und kluge junge Frau, der vor einiger Zeit die Beziehung zu einem jungen Handwerker zerbrochen war. Sie hätte sich sicherlich oft einsam gefühlt, nun aber war sie durch ihre Pflichten als Zofe der Königstochter ganz in Anspruch genommen. Das war ein Beruf für Tag und Nacht, der so gut wie keine Zeit mehr ließ für ein „eigenes" Leben, also auch nicht für neue Bekanntschaften mit Männern.
Ein Blick ins Königreich Sylonien
Luisa war nicht immer für Berbelin zuständig gewesen. Vorher hatte die Prinzessin eine Amme gehabt – eine korpulente und warmherzige Frau, der Berbelin sehr zugetan war. Vielleicht war es deren Wärme und Zugänglichkeit, der Berbelin Seele einen gesunden inneren Kern verdankte, denn die Eltern waren eher beschäftigt und bewegten sich in den Bahnen der strengen höfischen Vorschriften, zu denen auch gehörte, dass man ein Kind nicht zu sehr verwöhnen sollte. Die Amme gab ihr Zuwendung, die seitens der Eltern so oft fehlte. Bislang war Berbelin ein Einzelkind geblieben, die Eltern hätten dies durchaus gern geändert, was aber nicht gelang. Vor allem an einem männlichen Thronfolger wäre dem König gelegen gewesen. In diesen längst vergangenen Zeiten zählten in hochadligen Kreisen Buben einfach mehr, ob uns das heute passt oder nicht.
Vor etwa zehn Jahren, also ungefähr um Berbelins vierten Geburtstag herum, war etwas geschehen, was das Kind damals nicht verstand, nicht verstehen konnte, und ihm viel Kummer bereitete, der Spuren in ihrer Seele hinterließ, eine Wunde, die nie völlig verheilen würde. Ein Diener der Königin, dem Letztere sehr vertraute, berichtete ihr, er habe die Amme zweimal dabei beobachtet, wie sie silberne Löffel an sich genommen habe. Die Königin glaubte ihm, ohne Nachforschungen anzustellen oder die Amme zu befragen. Dass sie ihm so leicht Glauben schenkte, lag wohl vor allem daran, dass ihr die Amme seit einiger Zeit ein Dorn im Auge war. Das wiederum lag daran, dass diese ein so enges und, wie die Königin meinte, „verweichlichendes“ Verhältnis zu Berbelin aufgebaut hatte. Die verräterische Mitteilung des Dieners war der Königin also ein willkommener Vorwand, die Amme auf der Stelle zu entlassen, und sie wurde sogar daran gehindert, sich von dem Kind zu verabschieden. Die Mutter sagte der Tochter, ohne zu überprüfen, was diese und ob diese es verstand, die Amme sei beim Diebstahl goldener Löffel ertappt und auf der Stelle "herausgeworfen" worden. Berbelin verstand die Worte der Mutter, die sich aber umdrehte und wegging, nicht. Sie stellte sich vor, man habe die Amme aus dem Fenster geworfen. Sie suchte, wo sie konnte, nach der Frau, weinte viel und wurde dafür getadelt. Man teilte Berbelin dann Luisa als ihre persönliche Zofe zu. Luisa hatte sich im Schloss bewährt; zuerst hatte sie in der Küche mitgearbeitet und dann auch verschiedene andere Tätigkeiten im königlichen Haushalt zufriedenstellend erledigt. Als die persönliche Zofe der Königin eine Zeit lang erkrankt war, durfte Luisa sie vertreten. Die Königin war zufrieden mit ihr, und es traf sich gut, dass gerade als die Amme entlassen wurde, auch die Zofe Eleonores wieder gesund war, sodass Luisa bei Berbelin an die Stelle der Amme treten konnte. Eleonore hielt ihr mehrere eindringliche Vorträge, was dem Kinde zu gestatten war und was nicht. Im Lauf der Zeit entstand zwischen Luisa und der Königstochter ein enges und vertrauensvolles Verhältnis; wie freundschaftlich es war, wusste Luisa gut vor der Königin zu verbergen, denn sie hatte am Fall der Amme gelernt, dass Nähe, wenn sie nach außen sichtbar oder spürbar wurde, Argwohn erregte. Luisa begleitete Berbelin bei fast allem, was sich außerhalb der unmittelbaren Aufsicht durch ihre Eltern zutrug. Wenn das Wetter es erlaubte, hielt sich Berbelin oft im Schlossgarten auf. Die Zofe erlaubte ihr in zunehmendem Maße, eigene Wege zu gehen, unter der Bedingung, dass Berbelin sich pünktlich da wieder einfand, wo die Zofe sich aufhielt. Natürlich geschah das alles unter großer Vorsicht, die Königin durfte auf keinen Fall erfahren, welche Freiheiten die Zofe der Tochter ließ. Luisa war, wie bereits erwähnt, klug und umsichtig. Als Berbelin zwölf Jahre alt war, begleitete Luisa sie in die kleine Stadt, die sich vor dem Haupteingang des Schlossparks ausbreitete. Da sich Luisa nicht sicher war, ob sie das gedurft hätte, benutzten sie einen Nebenausgang des Parks, fuhren erst ein Stück auf Feldwegen, und gelangten dann, ungesehen von Leuten aus dem Schloss, zwischen die Häuser. Luisa konnte und durfte einen Einspänner kutschieren. Was sie aber nicht durfte und dennoch tat, war, ab und zu Berbelin die Zügel zu überlassen. Das geschah aber nur dann, wenn niemand zusah und solange sie noch über Land fuhren. Berbelin liebte den Umgang mit Pferden, und so auch diese Fahrten. Allgemein besuchte sie gern auch die königlichen Stallungen und ließ sich erklären, wie mit den Pferden umzugehen war. Reiten im Damensattel war einer Prinzessin durchaus erlaubt, und Berbelin tat das auch oft, aber natürlich war es gänzlich unschicklich für eine Prinzessin, auf irgendeinem Kutschbock zu sitzen und die Zügel zu halten. Dennoch hatte sie im Lauf der Zeit immer wieder mal den einen oder anderen Stallknecht und Kutscher überredet, sie, sofern es keine weiteren Zeugen gab, für kurze Augenblicke auch eine Kutsche steuern zu lassen. Die jungen Männer waren sehr angetan von der hübschen und charmanten kleinen Prinzessin und fühlten sich geschmeichelt, wenn sie sie um harmlose kleine Gefälligkeiten wie diese bat. Auch wahrten alle gern diese Geheimnisse. So besaß die nun also gerade mal zwölf Jahre alte Prinzessin bald eine Menge Kenntnisse und auch Fertigkeiten auf dem Gebiete der Fortbewegung mit Pferdekraft. Die Eltern erfuhren nichts davon, ja sie ahnten es nicht einmal. Sie gingen nämlich wie selbstverständlich davon aus, dass ihre Tochter sich ‚würdig’ so verhielt, wie es sich für den hohen Adel ziemte, auch wenn sie noch ein Kind war.
Vor dem Schlosspark breitete sich eine kleine Stadt aus, und viele hübsch herausgeputzte Dörfer fanden sich im Umland, so wie das Bild es zeigte. Heute nun war es so, dass Luisa auf den Gassen des Ortes wieder die Zügel übernahm. In dem Städtchen befanden sich die verschiedensten Werkstätten und Läden von Handwerkern und Kaufleuten. Auch die Schneiderei, die den Hof mit Kleidung versorgte, war hier, aber auch verschiedene Holzwerkstätten, Töpfereien, und kleine Manufakturen für die Herstellung von Porzellan und Glas. Luisa wollte Berbelin eine Glaswerkstatt zeigen, in der kleine gläserne Kunstwerke zu besichtigen waren. Berbelin war fasziniert, zu beobachten, wie ein Glasbläser einen dicken Tropfen flüssigen Glases aus dem Ofen zog und eine Kugel blies, die sich dann unter kunstfertigem Drehen und pusten allmählich in einen gläsernen Fisch verwandelte. Luisa hatte das früher schon einmal beobachtet und wollt es der Prinzessin unbedingt zeigen. Beide freuten sich unsäglich über diesen heimlichen Ausflug.
Während sie in der Glasbläserei kleine Kunstwerke bewunderten, zog draußen ein Gewitter herauf, und das Pferd des Einspänners, der vor der Werkstatt wartete, wurde ängstlich und scheute. Die beiden hörten, wie der Donner grollte und das Pferd wieherte. Sie liefen hinaus und sahen, wie ein fünfzehnjähriger Jüngling das Pferd beruhigte. Luisa war ihm sehr dankbar dafür. Man geriet in eine ausgiebige Plauderei, in der zu erfahren war, dass der Junge Sewolt hieß und eben eine Schreinerlehre bei dem schon recht betagten Meister Hieronymus begonnen hatte. Als Luisa während dieses Gesprächs einmal für einen Augenblick verschwunden war, verabredeten sich Berbelin und Sewolt für den nächsten Tag an einem kleinen Nebentor des Schlossgartens. Auf der Rückfahrt erzählte Berbelin der Zofe von dem Teil des Gespräches, bei dem Luisa nicht zugegen gewesen, und von der Verabredung. Die Zofe brachte viele Einwände vor, und es war vor allem leicht zu erraten, dass sie Angst vor dem Tadel der Königin hatte, wenn sie eine solche Begegnung zwischen der Königstochter und einem Lehrling aus dem Dorf zuließe. Die Zofe ließ sich aber überreden, begleitete also am darauffolgenden Tage Berbelin an die Schlossparkgrenze und blieb in der Nähe, als die beiden miteinander sprachen. Das wiederholte sich in den folgenden Wochen mehrmals, und schließlich ließ Luisa die Prinzessin gar mit dem Einspänner ein Stückchen mit Sewolt außerhalb des Schlossparks fahren, während die Zofe sich auf einen Stein setzte und strickte. Alles verlief harmlos und gut, natürlich unter strengster Geheimhaltung dem Hofe gegenüber, und Luisa gewöhnte sich schließlich daran, die Prinzessin ein Stück zu begleiten, sie dann ihrer Wege ziehen zu lassen und auf sie zu warten. Niemand sonst aus dem Schloss erfuhr davon; allenfalls wurden sie von einem Gärtner gesehen, der aber keine besondere Notiz davon nahm und es nicht hätte einordnen können. Berbelin und Luisa wurden sozusagen Verschworene, und die Freiheit, die Luisa ihr zugestand, war eigentlich die Freiheit, die sie selbst in ihrem Leben vermisste.
Von Sewolt erfuhr Berbelin, dass er seine Eltern mit zehn Jahren durch ein einstürzendes Hausdach verloren hatte. Die kleine Familie hatte unter diesem Dach eines einfachen Gasthauses übernachtet. Zwar war Sewolts Vater Zimmermann gewesen, aber natürlich überprüft ein Zimmermann nicht jeden Dachstuhl, unter den er sich begibt, auf seine Stabilität. Die Tragik ist nun, dass er das aber besser getan hätte. Nur Sewolt, gerade zehn Jahre alt, hatte den Einsturz unbeschadet überstanden. Mit einem Schlag – und zwar im doppelten Wortsinne – war der Kleine nun Vollwaise. Sein Onkel, ein Bruder des Vaters, und seine Frau wären als einzige Familienmitglieder in Frage gekommen, den Jungen aufzunehmen. Dieser Onkel hatte jedoch bei einem Unfall ein Bein verloren, und er, seine kränkliche Frau und ihrer beider Tochter Sybille, Sewolts Cousine, waren bettelarm und schon mit der Bewältigung ihres eigenen Lebens überfordert. Eine Gruppe von Alchemisten, mit denen sein Vater gut bekannt gewesen war, hatte das Waisenkind aufgenommen. Die meist älteren Männer, die alle nicht nur ihrem Interesse für die Alchemie nachgingen, sondern Werkstätten verschiedener Art betrieben, unterrichteten ihn in Vielem, und mit vierzehn nahm der alte Hieronymus ihn als Lehrling in seiner Schreinerwerkstatt auf. Etwa zur selben Zeit verbesserte sich die Situation der Familie von Sewolts Onkels dadurch ein wenig, dass dem Onkel durch den Tod seiner Mutter ein kleines bescheidenes Haus mit einer kleinen Tierhaltung in einem der Stadt nahegelegenen Dorf zufiel. Man tat sich aber schwer mit dem Alltag, Sybille und ihre Mutter kümmerten sich um das Haus, den Gemüsegarten und die wenigen Tiere. Die Familie hätte nun zwar Sewolt vielleicht aufnehmen können, der war aber recht heimisch bei den Alchemisten geworden und wollte lieber dortbleiben, zumal er seine Lehre dort begonnen hatte. Ohnehin starb der Onkel zwei Jahre später an einer Folge der Beinamputation. Seine Frau wohnte nun mit Sybilla allein in dem Häuschen. Das Leben war wirtschaftlich hart, die Frau wie gesagt kränklich, Sybilla aber eine ausgesprochene Frohnatur, die sich nicht unterkriegen lassen wollte. Sie und ihre Mutter waren die einzigen Verwandten, zu denen Sewolt Kontakt hatte. Sobald einer der Alchemisten ihn dorthin mitnehmen konnte, besuchte er sie gern - vor allem wegen der immer wohlgelaunten Cousine.
Berbelin und Sewolt waren einander natürlich erst sehr fremd, es schien manchmal so - und war ja eigentlich auch so - als kämen sie aus verschiedenen Welten, aber gerade das machte sie füreinander auch besonders interessant. Zwei Jahre lang gingen die beiden miteinander um wie befreundete Kinder, die sie im Grunde ja auch waren. Sie plauderten, fuhren mit dem Einspänner kleine Strecken über die Wiesen, spielten mit Bällen, versteckten und fanden sich wieder und dergleichen. Sie trafen sich ungefähr alle zwei Wochen, und nach etwa zwei Jahren begannen sie, wenn die Zofe außer Sicht war, kleine Zärtlichkeiten auszutauschen, und Berbelin wie auch er spürten bald eine sehr angenehme Aufregung, wenn eine Begegnung anstand. Wie weit sie bei ihrer Annäherung in diesem Alter gingen, wissen wir als Außenstehende besser nicht. Vielleicht hätte es Königin Eleonore wissen müssen, aber sie erfuhr gar nichts davon. Sobald sich Luisa und Berbelin jeweils dem Schlosse näherten, besprachen sie stets auf das Genaueste, wie auf Fragen zu antworten gewesen wäre, die vielleicht gestellt würden, nämlich wo man gewesen sei und was man dort getan hätte. Luisa hatte keine Vorbehalte gegen Liebeleien des inzwischen vierzehnjährigen Mädchens aus dem Hochadel mit einem drei Jahre älteren Lehrling "aus einfachen Kreisen", wie es so hieß. Sie versorgte Berbelin mit wichtigen Kenntnissen über die Beziehung zwischen den Geschlechtern. „Nicht, dass Ihr was Kleines mit nach Hause bringt, man würde uns alle drei hängen“, sagte sie warnend, und dazu kam es ja auch nicht. Was Luisa anlangt, so hätte diese sicherlich auch gern einen Freund gehabt, aber sie fand dafür wenig Gelegenheiten; der letzte Freund, den sie gehabt hatte, hatte sie betrogen. So war sie also sozusagen allein, und gerade das ließ sie wohl gegenüber Berbelin besonders großzügig sein. Im Grunde verhielt es sich nämlich wohl so, dass Berbelin und Sewolt auch etwas stellvertretend für sie „erledigten“, indem sie sich näherkamen. Aber auch ganz abgesehen davon wollte Luisa Berbelin möglichst jeden Wunsch erfüllen, so eng fühlte sie sich ihr verbunden. Im Lauf der Zeit wurde es allen immer selbstverständlicher, dass Luisa Berbelin im Einspänner durch den Schlosspark fuhr, dann an einem Seiteneingang des Parks und außer Blickweite vom Schloss aus mit ihr wartete, bis Sewolt Berbelin abholte – mal zu Fuß, mal auf einem Pferde, mal selbst in einem Einspänner sitzend. Danach wartete die Zofe, besonders dann sogar stundenlang, wenn die beiden eine Scheune aufsuchten, die ein gutes Stück weit außerhalb des Schlossparks einsam am Waldrand stand. Luisa hatte immer Strick- oder Häkelzeug dabei und liebte diese Wartezeiten. Und stets kehrte Berbelin zum abgesprochenen Stand der Sonne zur Zofe zurück und war dann eigentlich immer bester Stimmung, sodass ein fröhliches Plaudern der beiden folgte, Scherze, Andeutungen Berbelins, die neugierig machten. Aber nie wurde Luisas Neugier dann befriedigt.
Was für den Fortgang unserer Geschichte noch wichtig ist: Durch ihre Treffen mit Sewolt bekam Berbelin, vor allem seit sie vierzehn war und erst recht dann ab sechzehn, eine Vorstellung davon, was ihr im Umgang mit dem anderen Geschlecht behagte und was nicht. Diese Erfahrung war die Grundlage dafür, dass sie erahnen konnte, wie dramatisch und unerträglich es sein müsste, einem Jüngling oder Mann körperlich nahe zu kommen, den man nicht selbst und freiwillig gewählt hatte, zu dem es einen also nicht hinzog wie sie zu Sewolt. Eine Begegnung, die sich nicht auf solch natürliche Weise angebahnt hätte, und zu der keine ganz und gar freiwillige Entwicklung hingeführt hätte, wäre für sie unvorstellbar gewesen. Vermutlich hätte sie das ohne diese Erfahrung mit Sewolt nicht einschätzen können, nun aber konnte sie es. Hierin, in derart praktischer Erfahrung, unterschied sie sich von den meisten anderen gleichaltrigen Adelsfräulein, mit denen sie verkehrte.
Aber lassen wir Berbelins Begegnungen mit Sewolt einmal für einen Moment außer Acht und werfen einen Blick ins Königsschloss!
Was das Schloss der Königsfamilie anlangt, waren Berbelin alle Räume zugänglich - mit einer Ausnahme: Ihr wurde beigebracht, dass unbedingt der Ostflügel des Schlosses zu meiden sei. Sein Betreten war streng verboten, und so geriet dieser Bereich des Schlosses allmählich aus dem Bewusstsein des Kindes. Ostflügel? Was ist das? Sie vergaß, dass es ihn gab, und heute, als sie also vierzehn Jahre alt war, wusste sie nichts mehr davon. Erst viel später würde sich daran etwas ändern. Jedenfalls hatte sie ohne ein Bewusstsein dieser dunklen Bedrohung leben dürfen - wobei wir hier einmal außer Acht lassen wollen, ob ein Kind nicht allein dadurch unter dem Einfluss von etwas steht, wenn die Eltern darüber zwar Stillschweigen wahren, aber davon wissen.
Soeben also betrachtete Friedrich Theodor seine Tochter und war ein wenig verwundert darüber, dass diese nun aus größerer Höhe ein wenig auf ihn herabschaute. Bis eben war sie ihm doch noch wie ein Kind vorgekommen! Einige Zeit, als sie auf allen Vieren zu krabbeln und dann zu laufen begonnen hatte, hatte sie ihn ununterbrochen bei seinen Geschäften gestört, dann war es stiller geworden, sie hatte die Störungen eingestellt und war seinem Blickfeld fasst gänzlich entschwunden. Nun aber, ganz unerwartet, stand sie da. 'Unübersehbar wird sie eine Frau, und zwar eine ansehnliche', wird er sich gedacht haben, und dass ihm das weitere Möglichkeiten und Schachzüge des Regierens eröffnen würde. Wirklich: Das war es, was ihm durch den Kopf ging. Und was ihm durch den Kopf ging, hatte weder mit Freude über dieses gut geratene Mädchen noch mit Vaterstolz zu tun - von väterlicher Liebe soll an dieser Stelle lieber gar nicht erst die Rede sein. Tatsächlich bemerkte er also soeben ganz überrascht, welche Entwicklung sie genommen hatte. Und sicherlich war diese Beobachtung der Grund dafür, dass er so zu ihr zu sprechen begann: „Berbelin, du bist die Tochter des Königs."
Berbelin und die Mitteilung des Königs
Sie hätte sagen können, dass sie das seit langem wisse, aber sie spürte natürlich, dass sich für ihn damit etwas Bestimmtes verband, was er wahrscheinlich sogleich als unabänderliche Wahrheit zum Ausdruck bringen würde und zwar vermutlich gar auf eine Weise als hätte es Gesetzeskraft. Sie fürchtete sich davor, ohne zu wissen, was es sein würde. Etwas Unangenehmes, wenn nicht gar Beängstigendes, stand wieder einmal im Raum. Von Pflichten und Verbindlichkeiten würde die Rede sein, das wusste sie schon jetzt. Aber dann war sie doch über das, was er sagte, überrascht – nein: erschrocken, entsetzt.
„Du wirst schöner von Tag zu Tag“, meinte er, und sie bezweifelte zurecht, dass er sie am Tag zuvor überhaupt wahrgenommen hatte. Er aber fuhr so fort: „In unserem Geschlecht verhält es sich nicht anders als in anderen Königshäusern auch. Es ist wichtig für dich, dass du deine Gefühle keine Irrwege gehen lässt, die dich Tränen kosten.“ Durch Berbelins Kopf gingen bange Fragen wie: ‚Was weiß er? Weiß er etwas über Sewolt? Worauf will er hinaus?’ „Dein Vater“, fuhr Friedrich Theodor fort, „wird bald einen Mann für dich aussuchen, den du, sobald du siebzehn bist, heiraten wirst. So ist es Brauch.“
Sie erstarrte. Sie hatte zwar etwas Bedrohliches gespürt, das im Raume gelegen hatte, aber das schlug dem Fass den Boden aus.
„Die Tochter des Königs zu sein, hat, wie du weißt, erhebliche Vorteile, aber sie hat auch den Preis dieser kleinen Einschränkung der Freiheit.“
Sie stand wie angewurzelt da. Hatte er wirklich gesagt ‚kleine Einschränkung‘? Befand sie sich inmitten eines Alptraums? Eine Erwiderung war der Königstochter nicht gestattet. Dem König kam auch gar nicht erst der Gedanke, dass ihr eine Gegenrede in den Sinn hätte kommen können, denn er war Gegenreden von ihr nicht gewohnt, weil sie nicht erfolgten. Und sie erfolgten nicht, weil sie nicht gestattet waren, und so wusste er also nichts davon, dass sie, die doch nicht mehr ganz so unschuldig war wie er glauben wollte, zum Einspruch in der Lage oder willens gewesen wäre. Also stand sie schweigend ihm gegenüber. Sie war weder errötet, noch hatte sie gelächelt oder geweint. Allenfalls war sie ein wenig blass geworden. Ihre Mimik war starr, obwohl sie bei anderen Gelegenheiten ein lebendiges Mädchen sein konnte.
Die Liebe des Vaters, ja, sicher, irgendwo war sie. Durch alles andere hindurch oder im Hintergrund oder unter allem anderen, irgendwo war sie, und es mag sein, dass sie ihr und ihm noch ab und an spürbar war. Vielleicht war es aber auch nur die Sehnsucht danach, die noch gelegentlich fühlbar war. Aber darum schien es in diesem Augenblick gar nicht zu gehen. Im Vordergrund stand vielmehr das Wort des Vaters, das Gesetz, die symbolische Ordnung. Nicht die Ordnung der Dinge wie diejenige, dass der Apfel nach unten fiel, der Baum Wasser und Sonne brauchte, um leben zu können, nicht die Ordnung der Naturgesetze also. Die symbolische Ordnung bestand aus Regeln, was wer wann sagen dürfe, aus Regeln, wer welchen Rang hatte und was ihm deshalb zustand und was nicht, aus Normen und Etiketten, Sitten und Gebräuchen, die alle, die am Hof an ihrem eigenen Wohlergehen interessiert waren, im Kopfe hatten und befolgten.
Das Wort des Vaters benannte diese Gesetzmäßigkeiten, es definierte sie und sorgte für ihre Durchsetzung. Das Wort des Vaters war etwas anderes als seine Liebe. Und je ausführlicher er Berbelin – wie gerade eben - mit seinem Wort übermannte, umso mehr geriet das in den Hintergrund, was vielleicht bei der einen oder anderen früheren Gelegenheit noch als seine Liebe erkennbar oder zumindest mit viel gutem Willen erahnbar gewesen sein mochte.
Diesmal hatte ihr das Wort des Vaters nicht nur die Sprache verschlagen, sondern für den Augenblick auch alle Lebendigkeit. Die sprachliche Umschreibung, dass jemandem das Blut in den Adern gerinnt, trifft genau das, was hier geschah.
Aber dann sortierten sich alle einer Vierzehnjährigen verfügbaren geistigen Kräfte hinter ihren erstarrten Gesichtszügen. Sie wurde wieder Herrin ihrer Gedanken, und sie dachte, dass sie durchaus in der Lage sein würde, sein väterliches Wort zu erfüllen – allerdings nur genau bis zu dem Augenblick, in welchem sie am Traualtar stehen würde, um dann, im allerletzten Moment und natürlich für all die versammelte Prominenz völlig unerwartet, „Nein“ zu sagen. Nur dieses einzige Wort, so kurz wie vernehmlich für jedermann. So dachte sie, so war sie überzeugt von sich und ihrem unerbittlichen Willen. Ob sie sich da nicht ein wenig überschätzte? Gedacht war es leicht!
‚Ich muss mir jedoch’, stellte sie sich vor, ‚bis dahin, also in den nächsten zwei, drei Jahren, Sicherheiten für mich schaffen.’ Denn für sie bestand kein Zweifel: Dieser königliche Vater zöge ihr in seinem Jähzorn jeglichen sicheren Boden unter den Füßen weg, wenn sie täte, was sie vorhatte. Das wäre der Preis, den sie zu zahlen hätte.
‚König, der Name des Vaters', dachte sie wieder und wieder, ‚die symbolische Ordnung. Für ihn verschmilzt sie mit dem, was er für Liebe hält. Er kann es nicht mehr unterscheiden oder er hat keine mehr in sich.’ Sie aber konnte es unterscheiden, und seine Worte hatten endgültig die Liebe, die er vielleicht noch für sie empfand, für sie unsichtbar gemacht.
„Du kannst nun gehen“, beschied er sie, wodurch sie, die in so tiefe Gedanken abgetaucht war, erneut erschrak. Mag sein, dass er enttäuscht war, denn vermutlich hatte er erwartet, sie würde ihm dankbar zustimmen. Er zeigte, wenn es sie denn überhaupt in ihm gab, derartige Gefühle nicht. Enttäuschung zu zeigen hätte ja bekundet, dass jemand in der Lage war, diese ihm auszulösen, dass er oder sie die Macht dazu gehabt hätte. Das hätte er niemandem zugestanden.
‚Das Wort ist gesprochen, ich soll gehen’, dachte sie. 'An diesem Wort wird er verzweifeln. Er wird und muss vor allem für die Selbstverständlichkeit bezahlen, mit der er glaubt, mich seinem Regelwerk einverleiben zu können. Der Vater muss dafür bezahlen, dass er die Liebe der Tochter zu ihm in dieser Ordnung gefangen nimmt und erstickt.'
Denkt so eine Vierzehnjährige? Ist sie dazu in der Lage?
Nun, wie immer es sich bei anderen Vierzehnjährigen verhalten mag, hier war es so. Vielleicht dachte sie nicht mit genau den Worten und Begriffen, die in dieser Erzählung verwendet werden, aber sie spürte es so und dachte sinngemäß so. Sie hatte, indem ihr Erwiderungen gegen den Vater gänzlich untersagt waren, gelernt, statt zu reden zu denken und vor dem Denken zu beobachten. Widerstand und Trotz, die unbedingt im Inneren zu bleiben hatten, hatten dort ihre Arbeit getan. Sie hatten Berbelins Geist auf eine Weise geschult, die der Nährboden für eisigste Kälte wurden. Sicher gab es in ihr auch in einem gewissen Ausmaß Wärme und Zärtlichkeit, aber hier, in dieser Atmosphäre, im Würgegriff dieser symbolischen Ordnung, gediehen Frost und Eis besser als das.
Sie machte einen kleinen Knicks, drehte sich um und verließ den Raum.
Wann endet eine Kindheit? Endet sie mit dem Erreichen eines bestimmten Lebensalters, wie uns einige Bücher einreden wollen? Endet sie mit der Pubertät, gar erst mit dem Verlassen des Elternhauses? Liefern diese allgemeinen Theorien Maßstäbe, um dieses spezielle Mädchen zu beurteilen?
So hatte also der Vater gesprochen, wo aber war die Mutter? Berbelin hatte längst gelernt, genau zu unterscheiden, mit welchen Sorgen, die sie selbst, ihre Seele, ihren Leib betrafen, sie sich an die Mutter wenden konnte und mit welchen nicht. Und was die letzteren betraf, so war deren Zahl, wie sie empfand, ungleich größer. Sie hatte aufgehört, sich mit Angelegenheiten ihrer körperlichen Entwicklung oder leiblicher Vorgänge an die Mutter zu wenden. Die Mutter erschien ihr, was dies betraf, als geradezu zu fremd, um mit ihr etwas Intimes zu besprechen. Ebenso verhielt es sich mit ihrer Gefühlswelt. Ja es war sogar so, dass sie immer mehr dazu übergegangen war, sich an die Mutter nur mit Fragen zu wenden, die allergrößte Oberflächlichkeiten betrafen. Sie gab ihr gegenüber beispielsweise vor, sich für geografische Gegebenheiten, die in ihren Unterrichten angesprochen worden waren, zu interessieren, oder für kunsthandwerkliche Fragen. Sie stellte ihr Fragen, die Stickereien betrafen oder die künstlerische Gestaltung von Gartendarstellungen durch Zeichner und Maler, die dem Schloss Bilder lieferten. Eigentlich stellte sie der Mutter solche Fragen bald nur noch zur Ablenkung. Etwas musste ja gesprochen werden, und sie wollte nicht den Eindruck machen, dass sie sich mit Aspekten der Leiblichkeit, der Gefühlswelten oder der Beziehungen zwischen den Geschlechtern befasste. So lenkte sie also die Aufmerksamkeit der Mutter auf Fragen der Kultur und des Schulwissens. Und sie war erfolgreich, denn die Mutter gewann von ihr das Bild eines Mädchens, das sie nicht war.
Sie empfand die Zuwendung und Liebe ihrer Mutter als in hohem Maße abhängig davon, ob sie, Berbelin, Bedingungen erfüllte, deren Erfüllung der Mutter für eine Königstochter ziemlich oder auch unabdingbar war. Insofern war die Mutter, kaum überraschend, auch völlig eingesponnen in das Regelwerk von Vorschriften, Erwartungen, Etikette.
Ganz undenkbar aber war jeglicher rebellische Impuls. An diesem Tag, an dem der König nun Berbelin mitgeteilt hatte, was er mit ihr vorhatte, war ihr, Berbelin, völlig klar, dass alles in ihrem Inneren zu verbleiben hatte, was dagegensprach, diesem Ansinnen des Vaters nachzukommen. Auch mit ihren aristokratischen Freundinnen konnte sie das vorerst nicht teilen. Zum einen, weil es ihr selbst sehr schwergefallen wäre, die rechten Worte zu finden; zum anderen, weil man sie gelehrt hatte, das eigene Nest nicht zu beschmutzen; und schließlich, weil sie aus dem Kreise der Freundinnen heraus Verrat befürchtet hätte. Diesen Mädchen stand ein ähnliches Schicksal bevor. Sie kämpften mit aller innerlichen Kraft, die ihnen verfügbar war, dagegen an, die Wünsche nach Freiheit, nach Aufbegehren gegen dieses Schicksal, in sich zu verleugnen. Sie strebten danach, irgendwann die Positionen ihrer Mütter zu erreichen. Dabei waren Nachteile in Kauf zu nehmen, an die man sich vermeintlich gewöhnen konnte. Je weniger man dagegen aufbegehrte, so war ihnen immer wieder anempfohlen worden, desto weniger spürte man sie. Die Aussicht, dass ihnen auf Beschluss der Eltern irgendwann ein Mann zugesellt würde, war mit ein wenig Angst, vor allem mit Aufregung und einer Art Lampenfieber verbunden, ohne dass diese Mädchen sich – in der Regel mangels intimer Erfahrung mit dem anderen Geschlecht - genauer hätten vorstellen können, was da auf sie zukam. Und immerhin war ja nicht ganz auszuschließen, dass es der Traumprinz sein würde.
In Berbelin aber machte sie selbst sich von diesem Tage an in aller Heimlichkeit auf den Weg. Wie das? Sie verließ das Elternhaus innerlich, und dieser Vorgang war es, mit dem Berbelins Kindheit endete - eben dieser Beschluss, mit dem sie sich selbst davontrieb, auch wenn sie äußerlich noch wenige Jahre bleiben sollte!
Vorsorge
Vorsorgen für sich selbst – wie sollte, wie konnte das aussehen?
Es war nicht lange danach, als sie beobachtete, wie der Vater eine schwere Schatzkiste mit einem großen Schlüssel öffnete. Er ließ diese besondere Kiste, obwohl der Deckel schwer war und der Schlüssel groß und klobig, nicht von einem Diener öffnen wie er das sonst getan hätte, sondern machte die Arbeit persönlich und, jedenfalls war es das, was er glaubte, ohne Zeugen. In der Kiste befanden sich hauptsächlich Goldstücke, aber auch wertvoller Schmuck, Perlen und Edelsteine. Kaum irgendwo wäre es angemessener gewesen, von einem Schatz zu sprechen, allenfalls da, wo ein Drache auf einer ähnlichen Ansammlung von Preziosen gelegen hätte. Freilich passte ein Schatz zu einem König, das ist ja wohl nicht bestreitbar, und darum ist das, was hier geschah, letztlich so ungewöhnlich nicht. Der König entnahm der Kiste mehrere Goldstücke, mit denen er Zahlungen vorhatte, die inoffiziell waren, und die Geschäfte betrafen, von denen nur er und der Empfänger oder die Empfängerin des Geldes wusste. Und danach hängte er den Schlüssel wieder zurück; dieser wohnte nämlich in einem kleinen unscheinbaren Holzschränkchen, das in einer Kammer befestigt hing, in der ansonsten etliche Ballen wertvoller Stoffe aufbewahrt wurden, die der Anfertigung festlicher Tischdecken dienten. Friedrich Theodor dachte längst nicht mehr an das, was er kürzlich seiner Tochter eröffnet hatte. Sicher war es ihm auch deshalb nicht mehr gegenwärtig, weil sie es kritiklos hingenommen und sich dann getrollt hatte. Er ging davon aus, dass eine solche Mitteilung für eine Königstochter erwartbar war. Er rechnete fest damit, dass eine heranwachsende Tochter ein solches Vorgehen des königlichen Vaters erhoffen, ersehnen musste. Musste. Heute aber dachte er nicht mehr an das, was er ihr gesagt hatte.
Und er ahnte nicht, dass Berbelin im Zimmer zugegen war, freilich versteckt hinter einem schweren Fenstervorhang. Seit jenem Gespräch hatte sie den Handlungen des Vaters besondere Beachtung geschenkt, soweit sie nicht unter den Blicken der Öffentlichkeit oder Dienerschaft erfolgten. Sie wollte nämlich etwas über die Orte herausfinden, an denen er eventuell Wertgegenstände aufbewahrte. Genauer gesagt ging es ihr um die Wertgegenstände, deren Verschwinden nicht sofort auffallen würde...
Es liegt vielleicht nahe, diese besondere Art der Aufmerksamkeit einer Vierzehnjährigen auf das Handeln ihres Vaters aufs Schärfste zu verurteilen wie überhaupt jegliches Ausspionieren eines Elternteiles durch ein Kind. Der Geist der Erzählung gibt aber zu bedenken, dass jene Worte, die der Vater zu ihr gesprochen hatte, die Jugendliche schwer erschüttert hatten. Schließlich hatte sie längst die nötigen Erfahrungen gesammelt, um sich vorstellen zu können, was es heißen würde, von einem Manne ins Bett geführt zu werden, den man vielleicht nicht mochte oder vor dem man sich womöglich ekelte. Selbst hatte sie das zwar nicht erlebt, denn sie hatte sich den Freund ja, wie wir wissen, selbst ausgesucht. Aber dadurch kam es in den Bereich ihres Vorstellungsvermögens, was sein könnte, wenn man nicht selbst die Wahl hatte treffen können. Davor schauderte es ihr, das machte ihr Angst, gleichgültig wie tief der königliche Vater in seine symbolische Ordnung auch eingetaucht und deshalb vielleicht gar entschuldigt sein mochte.
Aber zurück zur Schatzkiste! Nun konnte Berbelin genau beobachten, wie es sich mit dieser alten Truhe verhielt und wo ihr Schlüssel aufbewahrt wurde. Besonders aufschlussreich aber war es für sie, zu sehen, was sich in der Truhe befand. Oben auf lagen glänzende Golddukaten, und zwar eine große Zahl. Man könnte also, so dachte sie naheliegenderweise, ab und an etwas von diesen Golddukaten fortnehmen, denn der Vater würde sicher nicht immerzu nachzählen, wie viele Stück Gold denn noch da waren. Sicher dürfte man nicht übertreiben, aber das Auge würde sich daran gewöhnen, wenn der Pegelstand in der Kiste hinreichend langsam absank. Kaum also hatte der Vater das Zimmer verlassen, tastete sie in der kleinen Kammer nach dem Kästchen, fand den Schlüssel, öffnete die Truhe, nahm ein halbes Dutzend Münzen – für die damaligen Alltagsleute wäre es ein Vermögen gewesen - heraus und ließ sie in der Brusttasche ihres Kleides versinken. Sie richtete wieder alles genau so wie sie es vorgefunden und verschwand unbemerkt. Im königlichen Schlossgarten, in welchen sie sich kurzzeitig auch schon mal ohne Begleitung der Zofe begeben konnte, um sich „die Füße zu vertreten“, gab es eine - vom Schloss aus nicht einsehbare - Stelle unter einem Gebüsch, an der sie die Münzen vergrub. Auch dabei wurde sie von niemandem beobachtet, sodass also der Grundstock eines Kapitals, über das sie mit siebzehn oder achtzehn verfügen können wollte, gelegt war.
Als sie ins Schloss zurückkehrte, begegnete sie auf dem großen unteren Flure ihrer Mutter, der Königin Eleonore. Diese bemerkte sofort, dass die Tochter ganz schmutzige Finger hatte und sprach sie darauf an. „Ich habe im Garten nach einem Schatz gegraben“, sagte die Tochter und lachte.
Die Mutter aber entgegnete: „Du bist eine Königstochter und wirst auf alle Zeiten haben, was du benötigst. Schatzsuche ist überflüssig und außerdem nur für kleine Jungens zulässig.“
Die Mutter wusste nicht, was der König zu seiner Tochter gesagt hatte, denn er hatte es auch nicht für nötig erachtet, es seiner Frau mitzuteilen, hatte er doch das Gesagte für allzu selbstverständlich gehalten.
„Außerdem“, ergänzte die Mutter mit einem schelmischen Gesichtsausdruck, „außerdem weißt du doch: Schätze werden immer von Drachen bewacht. Ganz selten nur gelingt es einem schönen Helden, ihn zu töten und den Schatz zu erobern. Wo kämen wir hin und wie arm wäre die Welt, wenn die Jungfrauen sich die Schätze selbst ausbuddeln würden!“ Sie verkniff es sich, das zentrale Element der Geschichte ausdrücklich zu erwähnen, nämlich, dass der Held dann zur Belohnung für das Töten des Drachens die königliche Jungfrau bekommt. Die Tochter aber war nicht so dumm, das nicht zu wissen, und sie dachte, es sei letztlich gleichgültig, warum man gegen seinen Willen verheiratet werde. Ein Drachen tue da nichts zur Sache. Eine Vergewaltigung sei eine Vergewaltigung. Ihr grauste erneut bei der Erinnerung an das, was der Vater gesagt hatte.
Aufgehoben sein und man selbst sein
Berbelin aber, eben jene schöne heranwachsende Königstochter, hatte, wie wir gut wissen, einen Freund, und sie mochte ihn sehr. Auch wie sie ihn kennengelernt hatte, wissen wir: Sie verdankten ihre Bekanntschaft im Grunde einem Gewitter und einem scheuenden Pferd. Natürlich hätten ihre Eltern einer solch engen Freundschaft mit einem Jungen nicht zugestimmt, jedenfalls nicht in ihrem Alter, und auf gar keinen Fall einer Freundschaft mit jemandem aus Handwerkerkreisen. Kurzum: Gar nichts an dieser Freundschaft oder Liebe hätte bei ihren Eltern Anklang gefunden, was Berbelin sehr genau wusste, und darum fand alles im Geheimen statt. Sewolts Eltern konnte man nicht mehr fragen, wie sie über den Umgang seines Sohnes gedacht hätten. Womöglich wohlwollend, denn beide waren ihm gegenüber immer so großzügig gewesen, wie es ihnen möglich gewesen war - jedenfalls erinnerte Sewolt das so; die Mutter hatte keine weiteren Kinder bekommen können, und so hatte sich alle ihre Liebe auf ihren Sohn konzentriert. Der Vater war ein gutmütiger Mann gewesen, dessen Tragik darin bestanden hatte, dass ausgerechnet er als Zimmermann mitsamt seiner warmherzigen und um Sewolt immer besorgten Frau von einem einstürzenden Dach erschlagen worden war. So konnte jedenfalls niemand mehr die beiden mehr nach irgendetwas fragen, aber vermutlich hätten sie anders reagiert als Berbelins Eltern es hätten. Womöglich wäre für ihr Urteil die Frage von Gewicht gewesen, was denn die Herzen der jungen Leute empfänden.
„Es gibt keine Chance, dass du jemals an unserer Tafel speisen wirst“, sagte Berbelin als Sechzehnjährige zu ihm, „was ich einerseits sehr bedaure.“
„Einerseits. Und andererseits?“
„Andererseits ist die Ordnung so wie sie ist. Es ist die symbolische Ordnung, die uns alle im Griff hat, uns aber auch Sicherheit gibt. Im Namen des Vaters.“
„Göttlich?“
„Es ist väterliche Ordnung. Väter sehen es gern so, dass sie mit der göttlichen zusammenfließt. Gott hin oder her: Entscheidend ist das Wort des Vaters.“
„Und soll das auch auf alle Zeiten deine Ordnung bleiben?“ fragte der enttäuschte Jüngling. „Du studierst doch bei deinem klugen Privatlehrer auch Philosophie! Lernst du dort nicht auch, über den Tellerrand eurer Ordnung hinauszuschauen?“ Tatsächlich war sie eine strebsame Schülerin. Ihre Eltern hatten es für wichtig erachtet, dass sie sich auch mit grundsätzlichen Fragen auseinandersetzte, denn eine Königstochter durfte sich im Gespräch nicht blamieren. Deshalb hatten sie dafür gesorgt, dass sie nicht einfach bei einem Pfarrer, sondern – unter anderem - bei einem Doktor der Theologie Unterricht erhielt. Er brachte zugleich eine breite philosophische Ausbildung mit, und aus seinem Munde hatte sie den Begriff der symbolischen Ordnung vernommen. Die Eltern hatten, als sie ihn engagierten, nicht geahnt, dass sie damit den Zweifel ins Haus geholt hatten. Sicher belehrte er Berbelin im Grunde gottesfürchtig. Aber er deutete zugleich immer wieder, sozusagen zwischen den Zeilen des Gesprochenen, etwas ganz anderes an. Er gab ihr zu verstehen, dass es vielleicht auch andere Möglichkeiten gab, auf das Universum, die Welt, die Ordnung zwischen den Menschen, auf Gott und sich selbst zu schauen. Zwar war sie noch eine Jugendliche, aber ihr Verstand war bereits außerordentlich rege, mit Vielem ging sie analytisch und skeptisch um, in den meisten Fällen, ohne es auszusprechen. Sie ahnte, dass es gefährlich für Doktor Cramerius werden könnte, wenn sie irgendetwas von dem bei den Eltern zum Thema machte, was sie zunehmend beschäftigte. Sie hätte Vielerlei von dem gern angesprochen, was ihr Angst machte, aber sie unterließ es. Sie hatte begriffen, dass die Eltern Abweichungen ihrer Gedanken von der vorgefassten Ordnung und dem von der Kirche systematisierten Glauben nicht geduldet hätten. Ihr war klar geworden, dass es furchtbare Folgen haben würde, sollten die Eltern bei ihr Zweifel an der Wohlbeschaffenheit der bestehenden Ordnung spüren. Sie würden, so wie sie es mit der Amme einst getan, Herrn Cramerius seines Dienstes entheben. Aber nicht nur das. Sie würden auch sehr frühzeitig ins Denken der Tochter mittels der Androhung von Strafe einzugreifen versuchen, um es auf den rechten Wegen zu halten. Das alles spürte sie. Und indem sie es spürte, verschärften sich die Zweifel, denn sie spürte auch die Angst der Anderen davor, dass etwas ins Rollen und Rutschen kommen könnte, wenn man erst einmal anfinge, die fest gefügte Ordnung zu hinterfragen. Und so folgerte sie, so fest und gewiss in sich selbst ruhend könne ein Gebäude nicht sein, wenn es so viel Angst gäbe, dass es ins Rutschen käme. Berbelin hätte das Meiste von dem, was sich in ihrem Gefühlsleben andeutete, nicht in Worte fassen können, und natürlich machte es ihr selbst die meiste Angst. Wer wollte sich schon in Unsicherheit stürzen, wenn nicht wenigstens irgendwo festes Neuland in Sicht war? Wer wollte einfach so in einen Sumpf hineinstapfen?
Sewolt war ein sehr attraktiver junger Mann, und meist näherten sich beim Austausch ihrer Gedanken über die Welt ihre Lippen, und sie betraten allmählich ein Feld, auf dem es keine Grenzen für sie gab. Und vom dem her, was in der Hitze des Begehrens zwischen ihnen geschah, konnte Berbelin wie schon erwähnt, immer klarer erahnen, was es bedeuten müsste, wenn sie einem Manne ausgeliefert würde, den sie nicht selbst gewählt hätte. An genau dieser Stelle konnte sie die Grenze wahrnehmen, an der der Bereich der väterlichen Verdikte gegen ihre ganz persönlichen Wünsche stieß, an der seine Ordnung und die ihrer Vorväter so schmerzhaft mit ihr selbst kollidierten. Und dieses „Selbst“ war erst durch den Gedankenaustausch mit Doktor Cramerius denkbar oder besser erahnbar geworden, nämlich als etwas, das in Teilen außerhalb dessen lag, was in ihrem gesellschaftlichen Raume vorgegeben war. Das war auch der eigentliche und wirkliche Punkt, dessentwegen Cramerius wirklich eine Gefahr für die Eltern und ihre Ordnung war. Zum Glück für ihn jedoch wussten sie es nicht. Sewolt freilich wusste es. Indem er sie fragte, ob der Unterricht bei Cramerius nicht auch dazu führte, dass sie die Ordnung in Frage stellte, berührte er etwas, was sie selbst kaum aussprechen konnte. Vor allem aber rührte er ihre Angst auf, aus dieser Ordnung heraus ins Nichts fallen zu können. Es war genau dieselbe Angst, die sie auch begleitete, wenn sie sich an Vaters kleinen Schatz heranmachte. Es war eine Gratwanderung zwischen der Angst, von ihm fortgeschickt zu werden, wenn sie weiter sie selbst würde, und der Angst, sich selbst gänzlich zu verlieren, wenn sie den väterlichen Vorgaben folgen würde - nicht nur, sich zu verlieren sondern ganz und gar in dem, was sie eigentlich war oder sein würde, verletzt und schließlich vernichtet zu werden. Vielleicht dachte sie es nicht in genau diesen Begriffen und Worten, aber sie fühlte es. Als Sewolt ihr also diese Frage gestellt hatte, war sie innerlich in Panik geraten, und bevor sie ihm erlaubte, in sie einzudringen, verlangte sie von ihm, sie niemals wieder so etwas zu fragen. Er stimmte zu und wusste ganz richtig, dass sie selbst es sein würde, die auf diese Frage zu gegebener Zeit, und zwar in nicht allzu ferner Zukunft, zurückkommen würde. Sie lagen im Stroh einer Scheune, Strohhalme piekten sie in ihren Po und Rücken. Sie waren in Liebe entflammt füreinander jenseits aller Klassenschranken und jenseits aller Zweifel, die man wegen ihres Alters hätte haben können. In der warmen Flut der Gefühle füreinander war all dies unbedeutend, und so schwammen sie auf ihrer Liebe dahin als gäbe es kein Morgen. Und dann kam der Abschied, und nach dem Abschied ein weiterer Abschied, und er wusste, dass seine Frage nach der Freiheit beantwortet war durch die Tat. Nichts, so dachte er, sei endgültiger als die Tat.
Dass Sewolt nicht an der königlichen Tafel würde speisen können, war ihm ohnehin klar. Und hätte er es doch können, hätte dies viele neue Probleme für ihn aufgeworfen. Er hatte schließlich nur sehr begrenzte Ahnung von der Etikette des Hofes, auch wenn es nur ein kleines und eher provinzielles Königreich war. Und während Berbelin zweimal in der Woche, natürlich unter den strengen Augen ihrer stets dabei anwesenden Mutter, Unterricht bei einem Tanzlehrer bekam, wusste Sewolt nicht, wie er selbst sich beim Tanze hätte bewegen müssen, und es hätte ihn viel Zeit gekostet, all das nachzuholen, was die jüngere Geliebte bereits darüber wusste. Sie entwickelte, anders als ihre adligen Freundinnen, keine besonderen Gefühle für ihren gutaussehenden und sich vollendet bewegenden Tanzlehrer. Allerdings ließen die strengen Blicke ihrer Mutter für die Entwicklung solcher Gefühle und Phantasien auch wirklich keinen Raum. Dennoch zeigte Sewolt, wenn sie ihm über diese Stunden berichtete, Anflüge von Eifersucht, und es machte ihr Spaß, diese Eifersucht anzufachen, indem sie der Wahrheit widersprechend beschrieb, wie er sie an sich gedrückt hatte und wie sie seine Erregung gespürt habe, und dem armen Sewolt gelang es allenfalls im Ansatz, den Eindruck zu machen, er stünde über all dem. Schließlich lachte sie und versicherte ihm, all das habe sie doch bloß erfunden, um ihn zu necken. Und er log natürlich, dass ihm das von Beginn an völlig klar gewesen sei. Dann küsste er sie heiß und inniglich, und sie erwiderte es und zog ihn hinunter ins Heu.
Davon, dass sie die private Schatztruhe des Königs entdeckt und immer mal etwas daraus entwendet hatte, sagte sie ihm aber nichts. 'Jeder braucht ein Geheimnis', dachte sie, ‚auch über diese wunderbare Liebe und Nähe zwischen uns hinaus.’ Somit beanspruchte sie für sich selbst immer noch einen kleinen nach außen hin abgeschlossenen Innenraum, wie verschmolzen sie auch manchmal mit Sewolt sein mochte. Sie verschaffte sich Sicherheiten und wahrte dies als Geheimnis. Auch ihm, ihrem geliebten Sewolt, wollte sie dereinst nicht ausgeliefert sein, sollte die Königsfamilie sie verstoßen. Und damit war zu rechnen, wenn sie sich tatsächlich dereinst weigern würde – im letzten Moment weigern würde, wie sie es unbedingt vorhatte – den Mann zu ehelichen, den ihr Vater für sie vorsehen würde. Nein, sie würde dann ihre eigenen Sicherheiten haben und nicht davon abhängen, welche Arbeit ihr Sewolt bekäme oder welche armselige Unterstützung er vielleicht seitens seiner Familie – seiner Tante und der Cousine - zu erwarten hätte. Sie wäre nur noch sehr bedingt eine Prinzessin, aber sie würde auf eigenen Füßen stehen, dachte sie. Er aber brauchte das jetzt noch nicht zu wissen.
Es grenzte wirklich an ein Wunder, dass niemand sie jemals dabei beobachtete, wie sie Talersäckchen um Talersäckchen, Schmuckbeutelchen um Schmuckbeutelchen, der Gartenerde übergab und ihren Schatz anwachsen ließ. Mit der Zeit stellte sie vielerlei Beobachtungen an, von welchen Pfründen sich ihr Vater noch ernährte, und es blieb nicht bei der einen Truhe, bei dem einen kleinen Schatz, an dem sie knabberte. Sie verteilte also ihre Aktivitäten auf verschiedene Besitztümer des Vaters – und übrigens auch der Mutter -, um nicht aufzufallen. Trotzdem aber kam es vor, dass der Vater sich wunderte, wieso ein Haufen Taler stärker geschrumpft war als seinen Abhebungen entsprochen hätte. Aber er redete sich immer wieder ein, dass er die Sache wohl falsch eingeschätzt oder zu flüchtig hingeschaut haben müsse.
Man kann sicher mit Fug und Recht sagen: Er wollte es nicht sehen. Oder sagen wir mal so: Er sah es, aber er wollte es nicht wahrhaben. Auch hätte er niemals sein Töchterchen verdächtigt, sondern allenfalls die Gemahlin, aber auch einen solchen Verdacht wollte er auf keinen Fall zulassen. Die Dienerschaft hielt er für vertrauenswürdig. Er verleugnete vor sich selbst, was eigentlich mit der Zeit unübersehbar war.
„Wird der König nicht eines Tages darauf bestehen, dass du einen Adligen heiratest, sodass du gut versorgt bist und das Familieneinkommen durch eine solche Hochzeit womöglich vermehrt wird?“
In seiner Frage erwies sich Sewolt als Realist, und er knüpfte natürlich damit auch an ihre frühere Bemerkung an, er werde wohl nie an der königlichen Tafel Platz nehmen können.
„Ja“, bestätigte sie sachlich. „Das wird er.“
„Ja aber…“ wollte er erwidern, doch sie legte ihren Zeigefinger auf seine Lippen, sodass er schwieg. „Das eine ist, was der König will“, sagte sie, „das andere ist das, was Berbelin will.“
Natürlich fragte sich Sewolt, wer sich denn da wohl am Ende durchsetzen würde – der König oder sie. Sie selbst hatte doch von der Ordnung gesprochen, derer es bedurfte. Aber er spürte auch ihren Willen. Beide aber bemerkten, dass dieser Konflikt sich nicht durch Worte beschwichtigen ließ, weder der Konflikt in ihr noch der, der auf sie zukommen würde, wenn der König sich dazu entschließen würde, ihr einen anderen Mann als Gatten zuzumuten. Beide, Berbelin wie Sewolt, kannten genügend Fälle, in denen letztlich die Tochter nachgegeben hatte. Angesichts des Drucks war das geschehen, angesichts der Macht. Entscheidend gewesen war zum einen immer wieder der Druck durch den Vater. Zum andern entfaltete die Ordnung ihre Macht – jene Ordnung, der er, der Vater selbst, von Geburt an verschrieben war und der er sich, sobald er denken konnte, selbst zugeordnet hatte. Beispielfälle, in denen sich die Tochter widersetzt hatte, waren Berbelin und Sewolt aber nicht geläufig. Und es wäre ja auch die Frage, ob man aus ihnen Ermutigung hätte ziehen können, denn vielleicht waren die weiteren Schicksale der jungen Frauen gar nicht so ersprießlich. Aber davon wussten sie, wie gesagt, nichts. War nicht seltsam, dass an keiner Stelle die Phantasie auftauchte, der Vater könnte ja auch einen überaus freundlichen, netten, gutaussehenden, charmanten und geistvollen Mann für die Tochter ins Auge fassen? Aus irgendeinem Grunde - oder aus vielerlei Gründen – wurde das gar nicht in Erwägung gezogen!
Sewolt und die „andere“ Grenze
Sewolt hatte schon verstanden, dass Berbelin in das Problem, oder besser gesagt: in den Konflikt verstrickt war, ob sie eigene Meinungen und Überzeugungen entwickeln oder sich sozusagen der Einfachheit und der Sicherheit halber den Vorstellungen ihres sozialen Milieus, vertreten in erster Linie durch ihren Vater, unterordnen solle. Das Nein, das Berbelin vorhatte zu sagen, wenn es um Heiraten ging, war kein grundsätzliches Nein zur Ordnung, in der ihre Eltern und Vorfahren lebten. Aber es war doch so, dass sie an dieser Stelle eine grundsätzlichere Differenz, eine Grenze zwischen dem ahnte, was sie selbst sein oder werden wollte und jener symbolischen Ordnung. Sie ahnte wie von Ferne, dass man nicht teilweise diesseits und teilweise jenseits sein und so in Frieden leben konnte. Sie oder irgendein Teil von ihr ahnte das vage. Aber in erster Linie wollte sie denken, sie könne nur eine einzige Sache, ein Detail wie eine solche spezielle Anordnung des Königs, ablehnen, ansonsten jedoch weiterhin dazugehören. Sie schwankte zwischen der Aussicht, ‚nein’ sagen und doch bleiben zu können und der, verstoßen zu werden.
Sewolt, weder adlig noch sonst wie privilegiert, erfasste die innere Lage seiner Freundin nicht vollständig. Vielleicht wäre es besser gewesen, er hätte sich mehr in das Problem vertieft. Aber er war selbst auch mit sich beschäftigt, mit seiner Gegenwart als Lehrling des Meisters und mit seiner Zukunft. Vor allem aber interessierten ihn Tätigkeiten und Vorgänge im Rahmen der Alchemie, und dabei eine ganz andere Art von „Grenze“ als diejenige, an der Berbelin stand. So verbrachte er bisweilen eine ganze Nacht im alchemistischen1 Labor seines väterlichen Freundes und Meisters Hieronymus, der nicht nur eine Schreinerwerkstatt betrieb, sondern der sich wie seine Brüder im Geiste einem ganz speziellen Ziel verschrieben hatte, nämlich der Lösung eines besonderen Problems: der Herstellung von Gold. Er braute und kochte und rührte Substanzen ausgesuchter Art zusammen, ließ aufwallen, sieden, dampfen, fing Dämpfe wieder auf und mischte sie mit anderen. Es blubberte und roch und stank und duftete in seinem unterirdischen Gewölbe. Er lief herum, füllte um, schüttelte Reagenzgläser und befestigte sie über kleinen Flammen, kurzum: Er hatte Pläne und verfolgte sie und orientierte sich auf das eine Ziel hin: Gold! Dabei fiel diese und jene Tinktur ab, die diesem und jenem Nebenziel diente, Heilkräfte haben und Wirkungen erzielen sollte, die man mal beobachten, mal glauben konnte. Mal traten sie wirklich, mal nur gefühlt ein, weil man daran glauben wollte.
„Wer heilt, hat recht“, sagte, wer es glaubte, und wenn drei es sagten, war es beinahe schon Gewissheit. Der alte Herr und seine meist beinahe ebenso alten Mitstreiter fühlten sich als Magier, Zauberer, Hexenmeister, vor allem aber schwitzen sie, litten oder triumphierten, je nachdem, was es für eine Nacht war, und Sewolt beobachtete, was Hieronymus tat, befragte ihn, verstand Manches, das Meiste nicht, was er sagte, murmelte, seufzte, lehrte. Hieronymus sah sicher in den meisten Fällen in seinem Gebräu und dessen Absonderungen das, was er sehen wollte. Er nahm darin wahr, was er sich sehnlichst wünschte. Realität und Sehnsucht verschwommen auf vielfältige Weise ineinander. Im Grunde müsste man wohl sagen: Er sah, wenn er tief in diese Substanzen hineinschaute, eigentlich in sich selbst hinein. Und da war die Grenze aufgehoben zwischen außen und innen, zwischen Wunsch und Sein, zwischen Realität und Wahn. Gold wurde trotz der uralten Rezepturen bislang nicht hergestellt, aber die Hoffnung stirbt bekanntlich als Letztes. So auch bei Sewolt, der sich nicht entmutigen ließ, zumal er mit seinen Nebenprodukten und kollateralen Ergebnissen in der Regel höchst einverstanden war und sie meist nicht der Gosse übergab.
So waren es ganz unterschiedliche Grenzen, mit denen sich Berbelin einerseits und Sewolt andererseits befassten, aber im Grunde ging es doch ums Überschreiten derselben, um den Blick und den Schritt hinein ins unbekannte Land, ins Unabwägbare und Gefährliche, ob das nun in der Außenwelt oder im Inneren lag, und insofern waren sich diese beiden Seelen verwandt, soviel sie auch gleichzeitig trennen mochte. Meist war es ein stilles, unausgesprochenes Einverständnis, aus dem bald ein körperliches wurde.
Was da geschah, stand ganz im Gegensatz zu dem, was Friedrich Theodor von seinem Töchterlein glaubte oder glauben wollte. Er hielt sie natürlich auch für abgrundtief ehrlich und treu ergeben. Und das war es auch, was er über sie glauben wollte. Worauf er auch niemals gekommen wäre, war, dass sie mit jemandem verkehrte, der im Bunde mit den Alchemisten der kleinen Stadt war. Der König maß ihnen zwar keine große Bedeutung zu – abgesehen davon allerdings, dass er gern von seinen Spionen deren Rezepte für die Glas- und Porzellanherstellung auskundschaften ließ. Er wusste, dass sie dem Hof - und dem Königtum überhaupt - nicht besonders bejahend gegenüberstanden. Nicht, dass er sie für gefährliche Staatsfeinde hielt, aber für eigensinnig, für Zweifler, Nörgler und Skeptiker. Da sie aber immer wieder mal eine nützliche Erfindung machten, die man ihnen abjagen konnte, ließ der König sie wursteln, ohne gegen sie etwas zu unternehmen. Dass jedoch sein Töchterlein in diesen Dunstkreis geraten war, wäre ihm keineswegs recht gewesen – wenn er davon gewusst hätte. Aber weil er sich kaum darum kümmerte, was sie so trieb, weil es ihn eigentlich nicht interessierte, blieb es vor ihm verborgen.
Verliebte Mädchen am 16. Geburtstag
Als sich Berbelins sechzehnter Geburtstag näherte, eröffnete ihre Mutter ihr, es sei der Wunsch des Königs, dass ein großes Fest gefeiert würde. Es sollte viel getanzt und gespeist werden. Viele junge Männer aus den verschiedensten Adels- und vielleicht auch Königshäusern würden geladen und auch kommen, auch, um Berbelin zu sehen, das Schönste der Mädchen im weiten Umkreis.
Berbelin ging völlig zu Recht davon aus, dass es dem König nicht darum ging, seine wohlgeratene Tochter voller Stolz und ohne strategische Hintergedanken der adligen Öffentlichkeit vorzustellen. Dass auch Andere den Grund seines Stolzes und seiner Vaterfreude sehen und nachvollziehen konnten und sie in diese Gesellschaft eingeführt würde, darum würde es nicht gehen. Das war ihr klar, denn es fühlte sich für sie überhaupt nicht so an. Welcher Hintergedanke denn den König wohl dabei umtriebe, fragte sie die Mutter, die dies mit großem Erstaunen vernahm. „Hintergedanken? Wie kannst du deinem Vater Hintergedanken unterstellen? Zweifelst du daran, dass es ihm um dein Bestes geht?“
Berbelin war klar, dass der Ton, den die Mutter nun angeschlagen hatte, nichts Gutes erwarten ließ.
„Sag schon!“ forderte Eleonore. „An was denkst du da, wenn du so fragst?“
„Nun“, stammelte Berbelin, „will er wirklich nur, dass man mich sieht, weiter nichts?“
Die Mutter starrte sie an. „Nun ja, du wirst nicht dein Leben lang alleine bleiben wollen, und auch nicht dein Leben mit Vater und Mutter allein verbringen wollen als alte Jungfer. Es soll wohl vorkommen, dass sich Männer für dich und du dich für Männer zu interessieren beginnen wirst. Wenn aber niemand im adligen Umfeld etwas von deiner Existenz und deiner Schönheit weiß, dürfte das die Sache erschweren.“ Sie lachte hell und spöttisch auf.
„Die Sache?“
„Ja, die Sache. Genauso.“
Bis hierhin war das Gespräch keineswegs so verlaufen, wie Eleonore sich das vorgestellt hatte. Vielmehr war sie nun verärgert; Berbelin kam ihr undankbar vor, wenn nicht gar aufsässig. Sie wollte die Frage in sich gar nicht zulassen, was sich da womöglich anbahnte, was das war, was in ihrer Tochter da herankeimte oder gärte. „Was sind das für Fragen?!“ murmelte sie, als sie sich zum Verlassen des Zimmers anschickte. Berbelin, die blitzschnell eine Überlegung angestellt hatte, rief: „Noch ein Wort bitte!“. Die Mutter blieb abrupt stehen und drehte sich verärgert zu ihr um. „Was noch?“
„So viele fremde Menschen, wie dann dort zu erwarten sind, machen mir Angst, und ich bitte um eine Hilfestellung dabei.“ „Und die wäre?“
Berbelin behauptete, sie habe eine gute gleichaltrige Freundin, die aus einer sehr begüterten Kaufmannsfamilie stamme. Sie habe sie über dieses oder jenes Adelsfräulein kennengelernt, sie habe vollendete Manieren und man merke ihr nicht an, dass sie „nicht unseresgleichen“ sei. "Sie möchte ich einladen zum Geburtstagsfest, wenn ich sie im Hintergrunde wüsste, würde mir das meine Angst vor den vielen fremden Herrschaften mindern.“