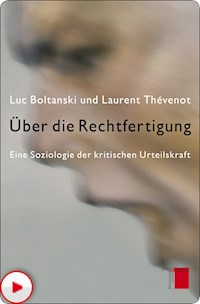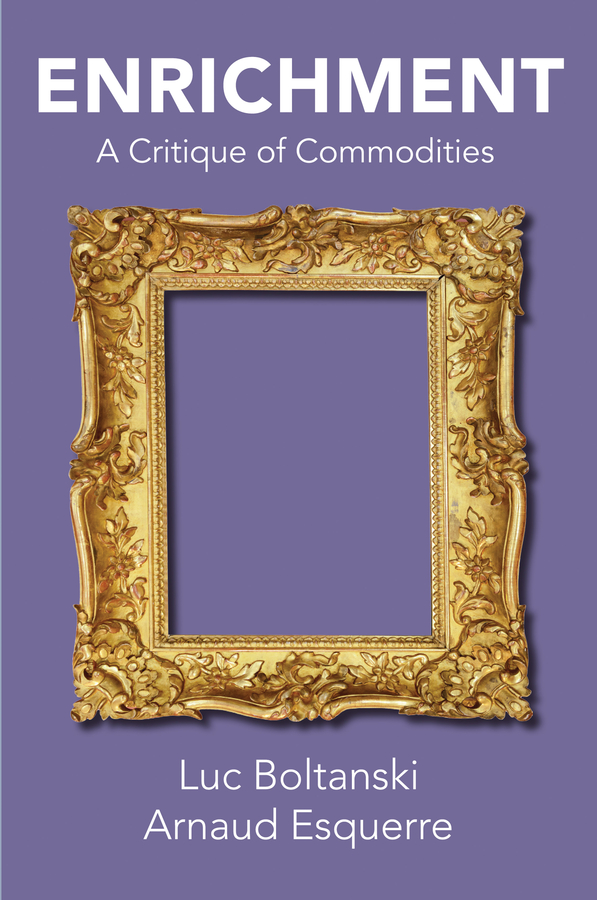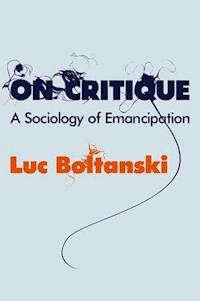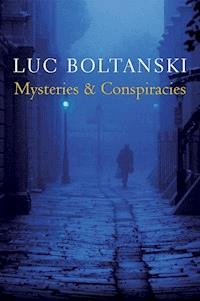29,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Museen, Kunst, Luxusgüter, Immobilien, Tourismus – für die Soziologen Luc Boltanski und Arnaud Esquerre sind dies zentrale Felder einer neuen Ökonomie der Anreicherung, die zunehmend unsere Gesellschaften prägt und vor allem der Bereicherung der Reichen dient. In ihrem brillanten Buch, das seit seinem Erscheinen Furore macht, analysieren sie diesen neuen Kapitalismus.
Sein Ziel ist nicht mehr die industrielle Warenproduktion, die in die Entwicklungs- und Schwellenländer ausgelagert wurde, sondern die Anreicherung von Dingen, die bereits da sind. Der Wert von Waren sinkt normalerweise mit der Zeit, in der Anreicherungsökonomie ist das jedoch umgekehrt: Er steigt. Die Ware – das Kunstwerk, die Uhr, der Urlaubsort oder die Immobilie – wird dabei mit einer bestimmten Geschichte oder Tradition versehen, die sie anreichert. Boltanski und Esquerre verfolgen den Aufstieg dieser neuen Ökonomie, die auf den Industriekapitalismus seit den 1970er Jahren folgt, und zeigen, wie sie von den Medien, den Hochglanzbeilagen und Kunstmagazinen, aber auch von der Politik befördert wird und neue soziale Rollen schafft: Rentiers und Bedienstete, Kreative und Zukurzgekommene.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1056
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
3Luc Boltanski Arnaud Esquerre
Bereicherung
Eine Kritik der Ware
Aus dem Französischen von Christine Pries
Suhrkamp
11Für Dominique
Übersicht
Cover
Titel
Widmung
Inhalt
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
5Inhalt
Cover
Titel
Widmung
Inhalt
Vorwort
Teil
I
Wertverlust und Wertschöpfung
Erstes Kapitel Das Zeitalter der Bereicherungsökonomie
Die Deindustrialisierung in den westeuropäischen Ländern
Alte und neue Stätten des Wohlstands
Die Omnipräsenz angereicherter Dinge
Der Luxusboom
Die Patrimonialisierung
Die Entwicklung des Tourismus
Die Zunahme von kulturellen Aktivitäten
Der Kunsthandel
Arles: Von der Lokomotivwerkstatt zur Ausstellungshalle für zeitgenössische Kunst
Eine ökonomische Neuausrichtung auf die Reichen
Zweites Kapitel Erste Schritte hin zur Bereicherung
Die Charaktereigenschaften einer Bereicherungsökonomie
Ressourcen der Bereicherungsökonomie
Wandel der französischen Kulturpolitik
Neue Perspektiven der Wirtschaftsanalyse
Eine Umstellung auf mehreren Ebenen
Von der patrimonialen Zierde zum Unternehmen Kulturerbe
Lokale Umbrüche innerhalb des globalen Kapitalismus
Im Namen der Dinge
Teil
II
Preise und Wertermittlungsformen
Drittes Kapitel Der Handel mit Dingen
Der Warencharakter
Über die Zirkulation der Dinge
In andere Hände übergehen
Die Bestimmung
Preis und Metapreis
Kritik des Preises
Der Wert als Rechtfertigung des Preises
Über den Preis als Baustein der Realität
Viertes Kapitel Die Wertermittlungsformen
Struktur und Transformationsgruppe der Wertermittlungsformen
Die analytische und die narrative Präsentation eines Dings
Das Problem der Wertermittlung durch Bilder
Über die Reproduktion der Dinge
Leerstellen, Totalitäten und Seltenheit
Institutionen und Wertermittlungsformen
Strukturalismus und Kapitalismus
Konkurrenz aus systemischer Perspektive
Kapitalismus und Märkte
Die Rolle der Reflexivität
Die Struktur der Wertermittlungsformen
Teil
III
Die Warenstrukturen
Fünftes Kapitel Die Standardform
Das Modell der Standardform
Standardform und industrielle Produktion
Prototypen und Exemplare
Das ungebremste Wuchern unpersönlicher Dinge
Die Binnenspannung der Standardform
Die Standardform als Anlass zur Beunruhigung
Sechstes Kapitel Standardisierung und Differenzierung
Die Geschichtlichkeit der Wertermittlungsformen
Von Geschäften mit Dingen zur Warenzirkulation
Die Auswirkungen der Standardisierung auf die Bildung der Wertermittlungsformen
Materielle Ökonomie, immaterielle Ökonomie
Siebentes Kapitel Die Sammlerform
Die Modernität der Sammlerform
Das Dispositiv des systematischen Sammelns
Sammlerobjekte
Preis und Wert der Sammlerstücke
Die Sammelgebiete
Die Struktur der Sammlerform
Achtes Kapitel Sammeln und Bereichern
Die Nützlichkeit des Nutzlosen
Wie das Sammeln vom Marketing aufgegriffen wird
Wie die Luxusunternehmen die Sammlerform verwenden
Vom Holzhandel zu Luxusprodukten: Die Verwandlung des Pinault-Konzerns in den Kering-Konzern
Das Vermögen der besonders Wohlhabenden abschöpfen
Wert und Preis der Luxusprodukt-Marken
Standardprodukte mit »Sammlereffekt« und Sammlerprodukte
Sammlerform und zeitgenössische Kunst
Die Widersprüchlichkeit der Bereicherungsökonomie
Neuntes Kapitel Die Trendform
Trend, Zeichen und Distinktion
Die Struktur der Trendform
Die ökonomischen Vorgaben der Trendform
Von der Trendform zur Sammlerform
Zehntes Kapitel Die Anlageform
Charaktereigenschaften der Anlageform
Über die Liquidität der Dinge als Kapitalanlagen
Das Marktpotenzial von Kapitalanlagen
Teil
IV
Wer von der Vergangenheit profitiert
Elftes Kapitel Profit in der kommerzialisierten Gesellschaft
Konkurrenz und Ausdifferenzierung
Profit und Mehrwert durch Arbeit
Profit und kaufmännischer Mehrwert
Den Standort der Waren oder den Standort der Käufer verlagern
Verlagerungen zwischen den Wertermittlungsformen
Die Vereinnahmung der Reichen und der Kapitalismus
Zwölftes Kapitel Die Bereicherungsökonomie in der Praxis
Ein reich gewordenes Dorf: Laguiole im Aubrac
Der Wandel der Lebensräume durch die Patrimonialisierung
Die neuen »traditionellen Feste« des Dorfs
Patrimonialisierung der Nahrungsmittel
Eine sehenswerte Landschaft
Messer, deren Wert durch die Sammlerform ermittelt wird
Die »handwerkliche« Fertigung eines Messers in Laguiole
Sammelobjekt Messer
Musealisierung als Vermarktungsmittel
Das Problem der Herkunft der Materialien
Die Unterscheidung der Laguiole-Messer von Messern anderer Herkunft
»Ein Name, eine Marke, ein Dorf«
Wie die Einheimischen die freie Verfügungsgewalt über den Namen ihres Dorfs verloren
Eine geographische Angabe, um »die Schätze der Landesregionen zu würdigen«
Dreizehntes Kapital Die Konturen der Bereicherungsgesellschaft
Das Gefüge von Dingen und Personen
Wer kann aus einer Bereicherungsökonomie Profit schlagen?
Abgehängte und Dienstboten
Die Wiederkehr der »Rentiers«
Vierzehntes Kapitel Die Kreativen in der Bereicherungsgesellschaft
Die ökonomische Lage der Kulturarbeiter
Die Selbstvermarktung der Kreativen
Der Zwang zur Selbstausbeutung
Die Herausbildungsbedingungen sozialer Klassen
Irritationen auf Seiten der Kritik
Schluss Handeln und Strukturen
Bereicherungsökonomie und Kapitalismuskritik
Über einen pragmatischen Strukturalismus
Anhang Skizze zu einer Formalisierung der Warenstrukturen
Einige grundlegende Elemente der Sprache der Kategorientheorie
Definition 1
Definition 2
Definition 3
Beispiele
Definition 4
Definition 5
Definition 6
Definition 7
Die Wertermittlungsformen der Ware
Die Standardform
Die Trendform
Die Sammlerform
Die Anlageform
Einige Anmerkungen zu dieser Formalisierung
Übergänge zwischen den Formen
Mögliche Öffnungen
Literaturangaben
Dank
Bibliographie
Namenregister
Sachregister
Fußnoten
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
3
11
5
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
481
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
13Vorwort
Immer wenn sie etwas kaufen oder verkaufen, tauchen die sozialen Akteure in die Warenwelt ein, von der zu weiten Teilen und häufig mehr, als sie zuzugeben bereit sind, ihre Erfahrung dessen abhängt, was sie für die Realität halten. Waren sind zirkulierende Dinge, und was sie eint, ist der Vorgang, dass jedes Mal ein Preis für diese Dinge anfällt, wenn sie gegen Bargeld in andere Hände übergehen. Trotzdem bleiben diese Dinge weiter vielgestaltig, sodass die Warenwelt sich nicht als opake Totalität darstellt, was sie undurchschaubar machen würde, sondern als strukturiertes Ganzes. Die Bezugnahme auf solche Strukturen erlaubt die Identifizierung der getauschten Dinge. Und weil sie über ein stillschweigendes Verständnis dieser verinnerlichten Strukturen verfügen, können die sozialen Akteure sich in der Warenwelt orientieren, Handelsgeschäften nachgehen und vor allem Urteile über das Verhältnis zwischen den Dingen und ihrem Preis fällen.
Doch diese Strukturen und die Beziehungen, die sie zwischen den Dingen, ihrem Preis und dem ihnen zuerkannten Wert herstellen, beruhen auf einer räumlich verankerten Ausdifferenzierung und sind historisch bedingt. Sie verändern sich mit der Zeit ‒ je nachdem, wohin der Kapitalismus sich verlagert, unter dessen Joch der Handel mit Dingen in den meisten Gesellschaften der Gegenwart steht. Wenn man die Warenstrukturen, auf die sich der Handel im 21. Jahrhundert in einem Großteil Europas und womöglich der Welt stützt, mit den Strukturen im 19. Jahrhundert vergleichen möchte, geben Walter Benjamins diesbezügliche Analysen einen nachvollziehbaren Rahmen an die Hand: In »Paris, die Hauptstadt des XIX. Jahrhunderts«[1] speisen sich seine 14Überlegungen zur Geschichte und seine Kritik an einer »verdinglichten Vorstellung von Kultur« aus einer Reflexion über die Ware im Zeitalter des triumphierenden Kapitalismus. Waren »manifestieren sich« in der »Unmittelbarkeit sinnlicher Präsenz« und untrennbar davon ‒ behauptet Benjamin ‒ »als Phantasmagorien«, in denen der »Flaneur« sich verliert, »der sein Asyl in der Menge sucht«. Benjamin hebt die seinerzeit radikal neuen Formen hervor, die die »Weltstadt« annimmt, die nicht nur die Finanzwelt, Luxusartikel und den »Geist der Mode« zusammenführt, sondern auch die durch Blanqui verkörperte revolutionäre Boheme sowie vor allem die Industrie und das Proletariat. In erster Linie interessiert Benjamin der Nachweis, inwiefern die Wesen ‒ Personen und Dinge, die sich auf dem selben Raum zusammendrängen ‒ einen radikalen Bruch mit der Vergangenheit verkörpern ‒ einen Bruch, der durch die Entstehung des Industrie- und des Finanzkapitalismus gekennzeichnet ist und in den von Haussmann veranlassten Zerstörungen und der mit ihnen einhergehenden Neuordnung des städtischen Raums konkrete Gestalt annimmt. Das Zeitalter des »Fetisch Ware« meine, seine Legitimität aus einer futuristischen Inszenierung der Segnungen der »Technik« zu beziehen, und »der sture Fortschrittsglaube« mache den Historiker, der sich in den »Sieger« »einfühlt«, unweigerlich »zum Werkzeug der herrschenden Klasse«.[2]
Wenn man die Figur des Flaneurs ins Paris des 21. Jahrhunderts versetzt, findet sie sich nun aber in einer ganz anderen Realität wieder. Diese ist nicht weniger kapitalistisch als die, mit der es der Flaneur zu tun hatte, den Benjamin heraufbeschwört. Doch die »Luxusartikel« brüsten sich jetzt nicht mehr damit, »industriell« zu sein, im Gegenteil: Sie bemühen sich, ihre Wurzeln in einer Serienproduktion vergessen zu machen, welche sich um15so leichter unterschlagen lässt, als sie weitgehend in das Umland anderer, weit entfernter »Weltstädte« ausgelagert worden ist. Die kapitalistische Akkumulation setzt sich fort und wird sogar stärker, aber sie stützt sich auf neue ökonomische Instrumente und geht mit einer Diversifizierung der Warenwelt einher, die sich nach den Modalitäten richtet, wie der Wert der einzelnen Waren ermittelt bzw. zur Geltung gebracht wird.[3] Dieses Buch widmet sich der Beschreibung dieser Transformation, die in den Staaten besonders spürbar ist, die ‒ wie insbesondere Frankreich ‒ die Wiege der industriellen Leistungsfähigkeit Europas darstellten; es analysiert die Verteilung der Waren auf verschiedene Wertermittlungsformen.
Von daher ist unsere Arbeit in zwei Richtungen orientiert, die wir versuchen werden, miteinander zu verknüpfen. Die erste ist eher historischer Natur. Ihr Gegenstand ist ein ökonomischer Wandel, der ab dem letzten Viertel des 20. Jahrhunderts die Art und Weise zutiefst verändert hat, wie in jenen westeuropäischen Ländern Werte geschaffen wurden, die zum einen durch die Deindustrialisierung gekennzeichnet sind und zum anderen durch die zunehmende Ausbeutung von Ressourcen, die zwar nicht völlig neu sind, aber eine beispiellose Bedeutung gewonnen haben. Unserer Ansicht nach wird das Ausmaß dieses Wandels nur sichtbar, wenn man Gebiete miteinander in Verbindung bringt, die im Allgemeinen getrennt voneinander betrachtet werden, nämlich vor allem die Künste, und zwar besonders die bildenden Künste, die Kultur, den Antiquitätenhandel, die Gründung von Stiftungen und die Schaffung von Museen, die Luxusindustrie, die Patrimonialisierung und den Tourismus. Wir werden versuchen zu zeigen, dass man mit Hilfe der beständigen Interaktion zwischen diesen verschiedenen Gebieten die Art und Weise versteht, wie in jedem von ihnen Profit generiert wird, und unsere 16These lautet, dass sie alle auf der Ausbeutung einer einzigen Quelle beruhen, nämlich auf der Ausschlachtung der Vergangenheit.
Wir werden diese Art von Ökonomie »Bereicherungsökonomie« nennen. Dabei spielen wir mit der Mehrdeutigkeit des Ausdrucks »enrichissement«, den wir zum einen in dem Sinne verwenden, in dem man von der Anreicherung eines Metalls spricht, von der Bereicherung eines Lebens, dem Reicherwerden einer Kultur, der Veredelung eines Kleidungsstücks oder auch von der Bereicherung, die es darstellt, wenn eine Sammlung um eine Reihe von Objekten erweitert wird. Damit soll die Tatsache hervorgehoben werden, dass diese Ökonomie weniger auf der Produktion von neuen Dingen beruht, als vielmehr bereits vorhandene Dinge vor allem dadurch reicher zu machen versucht, dass sie sie mit Geschichten verknüpft. Zum anderen verweist der Ausdruck »Bereicherung« auf eine Besonderheit dieser Ökonomie, dass sie sich nämlich den Handel mit Dingen zunutze macht, die vornehmlich für Reiche bestimmt sind, die mit ihnen als zusätzliche Bereicherungsquelle Handel treiben. Unserem Eindruck nach ist die Beachtung dieser Bereicherungsökonomie und ihrer Auswirkungen erforderlich, um die Transformationen der französischen Gesellschaft der Gegenwart sowie bestimmte Spannungen zu erfassen, die ihr innewohnen.
Die zweite Richtung, in die unsere Arbeit geht, ist eher analytischer Natur. Sie zielt darauf zu verstehen, wie ganz verschiedene Waren zu Transaktionen führen können, die in den Augen der entweder als Anbieter oder als Interessenten beteiligten Akteure zumeist völlig normal wirken und den vorher ausgebildeten Erwartungen mehr oder weniger entsprechen. Mit dem Ausdruck »Ware« bezeichnen wir alle Dinge, für die ein Preis anfällt, wenn sie den Besitzer wechseln. Denn wenn die Warenwelt nicht auf teilweise impliziten Organisationsmodi beruhen würde, bliebe unverständlich, wie die Akteure sich in Anbetracht ihrer sagenhaften Verschiedenheit in ihr orientieren sollen. Das kommerzielle Geschick der Akteure ist zwar ganz verschieden und vom Niveau ihrer kaufmännischen Sozialisierung abhängig. Doch ohne eine Minimalkompetenz würde ein Akteur sich schlicht und ein17fach verirren und wäre nicht in der Lage, sich einen Weg durch eine Welt zu bahnen, in der die Rolle und die Zahl der Markttransaktionen so sehr an Bedeutung gewonnen hat wie in den modernen Gesellschaften. In diesem Sinne werden wir von Warenstrukturen sprechen.
Wenn sie sich auf solche untergründigen Strukturen stützen, können die Akteure eine reflexive Haltung gegenüber dem Verhältnis jener beiden heterogenen Arten von Entitäten ‒ nämlich einerseits den Dingen und andererseits den Preisen ‒ einnehmen, aus denen die Ware als solche sich zusammensetzt, anstatt diese Verbindung bloß als Synthese zu rezipieren und ihre Auswirkungen passiv hinzunehmen. Doch wenn man verstehen möchte, wie das Verhältnis der Dinge zu ihren Preisen rational erfasst werden kann, müssen wir noch die Bezugnahme auf eine dritte Art von Entität berücksichtigen, für dessen Bezeichnung wir den Ausdruck übernehmen, den die Akteure selbst verwenden ‒ den ursprünglichen Ausdruck also, wenn man so will ‒, nämlich den vieldeutigen Ausdruck des Werts. Um das Verhältnis eines Dings zu seinem Preis reflexiv zu erfassen ‒ sei es um diesen Preis zu kritisieren oder um ihn zu rechtfertigen ‒, nimmt man nämlich im Allgemeinen auf das Wesen dieses Dings Bezug, das dessen eigentlicher »Wert« darstellt. Anstatt den Wert für eine substanzielle und zugleich mysteriöse Eigenschaft der Dinge zu halten ‒ eine Sichtweise, von der die klassische Ökonomie durchdrungen war und die sie überdauert hat ‒, werden wir den Wert eher als Instrument zur Rechtfertigung oder Kritik des Preises von Dingen behandeln. Die Strukturen, die wir versuchen werden freizulegen, teilen die Warenwelt auf, indem sie die Gesamtheit der Handelsartikel auf verschiedene Weisen verteilen, ihren Preis zu rechtfertigen (oder zu kritisieren), das heißt auf verschiedene Weisen der Wertermittlung. Wie wir sehen werden, bestehen die verschiedenen Weisen, den Wert von Dingen zu ermitteln, aus einem Spiel mit Differenzen, das auf den Positionswechsel elementarer Oppositionen zurückgeht, sodass es sich in Form einer Transformationsgruppe beschreiben lässt. Auf diese Weise kann man die Homogenität der Warenwelt (die alle Dinge enthält, für die ein Preis 18anfällt, wenn sie in andere Hände übergehen) entsprechend der Art und Weise, wie dieser Preis gerechtfertigt wird, mit der Verschiedenheit der Objekte, aus denen sie besteht, in Einklang bringen.
Indem wir unser Augenmerk auf die Dynamik des Kapitalismus richten, werden wir versuchen, die beiden Ansätze miteinander zu verknüpfen, die den historischen und den analytischen Leitfaden dieser Arbeit gebildet haben. Wir werden uns mit dem Kapitalismus eher im Hinblick auf den Handel als unter dem Aspekt des Wandels befassen, der die Produktion und folglich auch die Arbeit ergriffen hat und gemeinsam mit der steigenden Arbeitslosigkeit ab dem letzten Viertel des 20. Jahrhunderts im Zentrum der Arbeiten über den Kapitalismus stand. Von großem Nutzen war uns dabei die (Re-)Lektüre von Fernand Braudel, der in seinem Meisterwerk über den Kapitalismus die Ware und den Handel in den Mittelpunkt seiner Analysen gestellt hat, und außerdem die Lektüre der Arbeiten, die versucht haben, die Braudel'sche Perspektive bis in unsere Tage zu verlängern, vor allem die von Giovanni Arrighi. Die Warenstrukturen haben eben deshalb historischen Charakter, weil sie sich in die Dynamik des Kapitalismus und die Verknüpfung von Ordnung und Chaos einfügen, die deren Antriebskraft darstellt. Einerseits muss sich die kapitalistische Akkumulation auf gemeinsame Erwartungen und im Zusammenhang damit auf Marktstrukturen stützen können, die vor allem für die Begrenzung der Transaktionskosten sorgen. Doch andererseits gehört es zur Logik dieser Akkumulation, dass sie sich, um sich die Vermarktung neuer Objekte zunutze machen zu können, unaufhörlich verlagert und dadurch ihre eigenen Strukturen unterwandert.
Als die Aussichten, aus der Ausbeutung industrieller Arbeit Profit zu ziehen, sich zu verschlechtern begannen, musste der Kapitalismus, der zunächst vor allem von der industriellen Entwicklung abgehangen hatte, sich verlagern, um aus der Vermarktung anderer Objekte den größtmöglichen Nutzen zu ziehen. Auf diese Weise lässt sich ein Zusammenhang zwischen der Bildung der Warenstrukturen in ihrer heutigen Form und der Ent19stehung einer Bereicherungsökonomie herstellen. Das Vorhandensein einer solchen Vielzahl von isomorphen und zugleich ausdifferenzierten Wertermittlungsformen erlaubt es, dass ganz verschiedene Dinge in der Hoffnung in andere Hände übergehen können, dass sie jedes Mal zum höchstmöglichen Preis verkauft werden und so den größtmöglichen Profit generieren bzw. Verluste eindämmen. Wenn es nur eine einzige Weise gäbe, sich auf den Wert von Dingen zu beziehen, um deren Preis zu rechtfertigen, würde eine große Zahl von Objekten, die heute zu einem hohen Preis eingetauscht werden, eine Abwertung erfahren. Die Diversifizierung der Warenstrukturen geht mit einer parallel dazu verlaufenden Diversifizierung der Leerstellen[4] einher, die diese Waren füllen sollen. Auf diese Weise prägen die Warenstrukturen tendenziell sowohl bestimmte Dinge als auch die Leerstellen, die das Fehlen dieser Dinge hinterlässt, sodass sie an dem Punkt stehen, an dem objektive und subjektive Faktoren ununterscheidbar sind. Dadurch tragen sie zu weiten Teilen zur Prägung dessen bei, was man Realität nennt, insofern diese von etwas abhängt, was Wittgenstein Sprachspiele nennt ‒ Sprachspiele, die den Akteuren erlauben, sich Erfahrungen mit Hilfe reflexiver Operatoren zu eigen zu machen.
Bei der Durchführung dieser Arbeit mussten wir uns zwischen verschiedenen Fächern, verschiedenen Methoden und verschiedenen Forschungsgebieten hin und her bewegen. Diese Verlagerungen waren nicht geplant, sondern drängten sich sozusagen durch die Logik einer Untersuchung auf, deren Gegenstand insofern erst nach und nach deutlich wurde, als die Ergebnisse, die in unseren Augen eine Antwort auf die Fragen gaben, die wir 20uns gestellt hatten, neue Fragen aufwarfen, sodass wir uns zu neuen Untersuchungen veranlasst sahen.
Was die Fächer anbelangt, haben wir so einen Weg verfolgt, der uns von der Soziologie und Anthropologie zur gewinnbringenden Lektüre ganz verschiedener Schriften führte, die man der Geschichtswissenschaft ‒ ob es sich dabei nun um Kunstgeschichte, Technikgeschichte oder um Politik- und Sozialgeschichte handelt ‒, der politischen Philosophie und vor allem der Ökonomie zurechnen kann. In letzterem Fachgebiet, das auch nicht einheitlicher ist als die Soziologie und das von ganz verschiedenen Strömungen durchzogen wird ‒ unterschiedliche Schulen, die bekanntlich so weit gehen, das Label »Ökonomie« als solches in Frage zu stellen ‒, haben sich unsere Lektüren und Anleihen an einigen Stellen in Richtung der Arbeiten bewegt, die eher der neoklassischen Tradition zuzurechnen sind, und an anderen Stellen in Richtung der Arbeiten, die eher zu den Strömungen gehören, die man heterodox oder kritisch nennt. In Bezug auf die Belege, die sie anführen, und sogar in theoretischer Hinsicht liegen sie unserem Eindruck nach gar nicht so weit voneinander entfernt wie auf der Ebene der institutionellen Zugehörigkeiten und des Streits zwischen den Schulen. Unseres Erachtens hängt der eklatanteste Unterschied zwischen der »Orthodoxie« und der »Heterodoxie« vor allem mit dem Verhältnis zusammen, das diese verschiedenen Ökonomiestile zur Soziologie im eigentlichen Sinne unterhalten: Erstere versuchen, die Autonomie der Ökonomie zu verteidigen, die sich insbesondere an dem Stellenwert festmacht, der den aus irgendwelchen, auf die Mathematik zurückgehenden Sprachen übersetzten Modellrechnungen zukommt, während letztere nicht zögern, auch Daten zum Zuge kommen zu lassen, die aus den anderen Sozialwissenschaften stammen.
Unsere Hauptsorge bestand darin, uns von den oftmals schwierigen Beziehungen der Soziologie und Anthropologie zur Ökonomie freizumachen, die zahlreiche Soziologen und Anthropologen dazu verleiten, die Ökonomie entweder gar nicht zu beachten (als ob es symbolische Tauschbeziehungen gäbe, die von den 21Tauschbeziehungen von Gütern unabhängig wären) oder sich aus der Ökonomie stammende Modelle vorschnell zu eigen zu machen, um sie auf die eigenen Gegenstände anzuwenden und bei dieser Gelegenheit die diese Gegenstände betreffenden politisch-ökonomischen Entscheidungen zu rechtfertigen; oder aber ganz im Gegenteil eine kritische Einstellung zur Ökonomie im Allgemeinen zu entwickeln, als ob allein die Soziologie und die Anthropologie Zugang zu den wahren Beziehungen zwischen den Menschen hätten, die eine gewissermaßen für inhuman gehaltene ökonomische Wissenschaft nicht zu erfassen vermöge. In unserem Buch fehlt es keineswegs an Kritik, aber sie richtet sich gegen den Kapitalismus der Gegenwart und nicht gegen die Ökonomie als solche. Unsere Absicht bestand also darin, die Bemühungen der Forscher fortzusetzen ‒ von denen es in einer nicht allzu fernen Vergangenheit wahrscheinlich noch mehr gab als heute ‒, die sich gegen alle Formen von Fachorthodoxie für eine Vereinigung der Sozialwissenschaften eingesetzt haben. Derartige Bemühungen müssen unserer Meinung nach heute eine Überwindung der Spannung anstreben, die zwischen den eher aus dem Positivismus übernommenen (in der Ökonomie häufig vertretenen) Ansätzen auf der einen und den eher auf den Konstruktivismus zurückgehenden (in der Soziologie häufiger vertretenen) Ansätzen besteht. Wir haben versucht, mit Hilfe der Entwicklung eines pragmatischen Strukturalismus auf diesem Weg voranzukommen. Ein solcher Ansatz erlaubt die Verknüpfung von Sozialgeschichte mit einer Analyse der kognitiven Kompetenzen, welche die Akteure beim Handeln einsetzen.
Was die Untersuchungsmethoden betrifft, sind wir höchst eklektisch vorgegangen, wie Rosinenpicker, wenn man so sagen kann. Auch wenn wir hin und wieder Beispiele angeführt haben, die aus anderen Ländern stammen, um zu zeigen, dass wir von einem Prozess sprechen, der sich ausbreiten könnte, haben wir uns auf den Fall Frankreich konzentriert, das wahrscheinlich zu den Ländern gehört, in denen die Transformationen, die wir versucht haben herauszuarbeiten, am deutlichsten hervortreten. Wir sind das verfügbare statistische Material kreuz und quer durchge22gangen; haben zahlreiche formelle und informelle Interviews entweder mit Informanten geführt, die über institutionelle Autorität verfügen, oder mit sogenannten »gewöhnlichen« Akteuren, wie zum Beispiel Künstlern oder auch Sammlern verschiedener Dinge, die von zeitgenössischen Kunstwerken bis zu Wappen von Fußballclubs reichen; wir haben das ergiebige Datenmaterial durchgesehen, das zu kommerziellen Zwecken oder zur Selbstdarstellung erhoben wurde und das teilweise in Papierform vorlag und teilweise im Internet eingesehen werden kann; haben Lehrbücher für Luxus-, Tourismus-, Kunst- und Kulturmarketing analysiert; Orte ethnographisch erfasst, an denen die Bildung einer Bereicherungsökonomie sich »lebensnah« erfassen ließ (wie im Aubrac oder in Arles).
Die folgenden Seiten sind also das Ergebnis einer Art von Handwerk, das früher in den Sozialwissenschaften und in der Sozialanthropologie gängig bzw. in der Geschichtswissenschaft noch gängiger war als in der Soziologie, heute aber eher in Verruf geraten ist, obwohl es große Vorteile in Bezug auf die Freiheit und vor allem die Flexibilität bei der Ausführung eines Projekts aufweist, das, weil es keinerlei Verpflichtung gegenüber Finanzierungsinstanzen eingehen musste, je nach erzieltem Resultat ständig neu definiert und neu ausgerichtet werden kann. Es gerät zu oft in Vergessenheit, dass man, wenn man sich darauf beschränkt, auf der Grundlage einer großen Menge von Daten (big data) zu arbeiten, einen sozial bereits konstruierten Gegenstand vorfindet und es einem verwehrt ist, die Reflexivität der Akteure und den sozialen Wandel mit einzubeziehen, die noch nicht Gegenstand einer taxonomischen Erhebung und einer technischen sowie institutionellen Aufzeichnung waren.
Unsere Materialerfassung war umso umständlicher, weil das, was sich nach und nach als unser Untersuchungsfeld herausstellte, also zum einen die Bildung einer Bereicherungsökonomie und zum anderen der gegenwärtige Zustand der Warenstrukturen und der Kompetenzen, die es den Akteuren ermöglichen, sich zu orientieren, bisher in keinem der beiden Fälle zu Konstruktionen geführt hat, die eine Gesamterfassung noch dazu statistischer Art 23erlauben würden. Es gibt keine Rechen- oder Verwaltungszentren, die Daten über all die Gebiete sammeln, bündeln und aufbereiten, die unserer Ansicht nach berücksichtigt werden müssten, um die in unseren Augen so ungemein wichtigen Merkmale der gegenwärtigen sozioökonomischen Entwicklung zu erfassen. Wir haben uns also auf einer großen Zahl von Gebieten hin und her bewegen müssen: von der Gegenwartskunst zur Luxusindustrie, vom Kulturerbe[5] zum Tourismus usw. Die Untersuchung aller dieser Gebiete sollte vertieft werden, das ganze Buch kann als Einladung gelesen werden, ein neues Forschungsfeld zu bearbeiten. Von daher hoffen wir, dass andere diese Aufgabe wieder aufgreifen, die in der Lage sind, die Ergebnisse zu vervollständigen und die hier vorgelegten Hypothesen weiterzuentwickeln.
Teil I
25Wertverlust und Wertschöpfung
Erstes Kapitel
27Das Zeitalter der Bereicherungsökonomie
Die Deindustrialisierung in den westeuropäischen Ländern
Im letzten Viertel des 20. Jahrhunderts wurde die Massenproduktion in den westlichen Gesellschaften nicht mehr als einziges und womöglich auch nicht einmal mehr als hauptsächliches Mittel zur Gewinnmaximierung und Wertakkumulation betrachtet. Auch für den Kapitalismus hat sich die Expansion über die Massenproduktion hinaus als eine durch den Profitzwang auferlegte Notwendigkeit erwiesen, weil die zunächst für quasi unendlich gehaltenen Möglichkeiten, die diese Form eröffnete, ihre Grenzen zu erreichen schienen. Diese Expansion war allerdings nicht dadurch gekennzeichnet, dass die Standardform aufgegeben wurde. Sie erfolgte in Form einer intensiveren Finanzialisierung und ‒ im Bereich der Produktion und/oder der Vermarktung von Artikeln ‒ einer Neuverteilung der geopolitischen Karten. Einige sogenannte »Schwellenländer« übernahmen die arbeitsaufwändige Massenproduktion als Hauptpfad zur Bereicherung, während manche der Länder, die im 19. und 20. Jahrhundert die Heimstätte des globalen Kapitalismus gewesen waren, sich zum einen auf das Finanzwesen und die Entwicklung hochtechnisierter Güter konzentrierten, um aus der Ferne weiterhin die Macht über die Herstellung der gängigsten Güter zu behalten, die Nebenprodukte der technologischen Neuerungen darstellten, sich aber zum anderen auch sehr viel intensiver als in der Vergangenheit der Vermarktung von Gebieten zuwandten, die für den Kapitalismus lange Zeit mehr oder weniger randständig gewesen waren.
Durch die geographische Expansion des Kapitalismus wurden zahlreiche Produktionsstandorte von Standardartikeln, deren Entwicklung und Verkauf trotzdem im Wesentlichen bei den Firmen verblieb, die ihren Sitz weiterhin in den westlichen Kernländern des globalen Kapitalismus hatten, in Richtung der Länder neu 28verteilt, in denen Arbeitskräfte im Überfluss vorhanden und kaum organisiert waren und in denen folglich die Löhne niedrig lagen. Eine Auswirkung solcher Transfers war die Beschleunigung der Deindustrialisierung in den westeuropäischen Ländern. Die Deindustrialisierung der 2000er Jahre, von der die westlichen Volkswirtschaften und insbesondere Frankreich betroffen waren, ist ausgiebig untersucht worden.[6] Die Beschäftigungszahl in der Industrie erreichte im Jahr 1974 mit mehr als 5 900 000 Lohnempfängern einen Höhepunkt. Anfang der 2010er Jahre hat sie etwas mehr als 40 Prozent ihrer Stärke verloren. Im selben Zeitraum ist das, was die Statistiker unter Verwendung einer weiter gefassten Definition »Produktionssphäre« nennen, von 48 auf 35 Prozent der Beschäftigten zurückgegangen.[7] Mit Ausnahme einiger Hochtechnologiebranchen wie der Luftfahrt, der Kernenergie, der pharmazeutischen Industrie und der Rüstungsindustrie waren mehr oder weniger alle Branchen von diesem Rückgang betroffen:[8] Bergwerke, Eisenindustrie, Maschinenindustrie, Schiffbau, Textilindustrie usw. Die Produktionsgüterbranche und die Branche für gängige Konsumartikel waren besonders betroffen. Ihr Niedergang, der sich zwischen 1960 und 1970 in der Textil- und in der Lederwarenbranche abzuzeichnen begann, hat in der Folge den gesamten Bereich der Warenproduktion erfasst.
Unter »Deindustrialisierung« verstehen wir allerdings nicht den Übergang in eine »postindustrielle« Gesellschaft, wie die Soziologie sie in den 1960er Jahren oftmals prophezeit hat.[9] Alles 29in allem sind solche Prophezeiungen nicht Wirklichkeit geworden. Denn zum einen werden viele Branchen, die lange am Rand der industrialisierten Welt standen ‒ wie Kleinhandel, Bildungswesen, Gesundheitswesen, personenbezogene Dienstleistungen usw. ‒, heute ‒ auch wenn sie nicht zum privaten Sektor gehören, sondern unter staatlicher Aufsicht stehen ‒ nach Managementmethoden geführt, die in den großen Weltkonzernen ihren Ursprung hatten und Buchführungsstandards unterliegen, die in der Industrie entwickelt wurden, was durch die allgemeine Verbreitung der Informatik einfacher wurde. Doch vor allem werden in den europäischen Gesellschaften mehr Industrieprodukte denn je verwendet, zum Beispiel Mobiltelefone oder PCs, die mittlerweile zu den gängigsten Haushaltsgeräten gehören. Es waren dort noch nie so viele industrielle Handelswaren im Umlauf, aber sie werden nicht in diesen Ländern hergestellt. Im selben Zeitraum hat sich der Inlandsverbrauch in Frankreich nämlich nahezu verdoppelt ‒ genauso wie die Bedeutung des Dienstleistungsmarkts für den globalen Mehrwert ‒, wohingegen die Bedeutung der Industrie um beinahe zwei Drittel zurückgegangen ist. Über Erklärungen für diesen Deindustrialisierungsprozess führen die Wirtschaftsmathematiker heftige Debatten. Es ist schwierig, den Anteil zu messen, der bei der Deindustrialisierung einerseits der Auslagerung bestimmter, lange von den Firmen selbst übernommenen, aber nicht direkt zu den Produktionsfunktionen gehörenden Aufgaben zukommt und andererseits der wachsenden Arbeitsproduktivität. Doch es ist sehr wahrscheinlich, dass den bedeutendsten Anteil daran der Import von Artikeln hat, die in Ländern mit (je nach Branche von neun bis 80 Pro30zent[10]) geringeren Arbeitskosten hergestellt wurden, in denen die Arbeiterschaft sich nur selten mobilisiert hat und kaum geschützt ist ‒ in erster Linie in den Ländern des Fernen Ostens wie China und Vietnam, aber nach der Implosion der kommunistischen Regime auch in osteuropäischen Ländern wie der Slowakei, Rumänien oder Bulgarien.
Die Standortverlegungen in der Industrie sind im Laufe der letzten 50 Jahre Teil der Geschichte des abendländischen Kapitalismus geworden und stellen wahrscheinlich einen der Wege dar, die eingeschlagen wurden, um die Krise zu überwinden, die der Kapitalismus ungefähr von Mitte der 1960er bis Mitte der 1980er Jahr erlebt hat. Unter Stichworten wie Produktivitätsrückgang und überschüssiger Produktionskapazitäten im Verhältnis zur kaufkräftigen Nachfrage, was regelmäßig einen Einbruch der aus der Produktion von Fertigwaren gezogenen Profite nach sich zog,[11] ist der Schritt zur Standortverlegung häufig untersucht worden, er hat aber auch politische Wurzeln. Für die großen Konzerne bot er eine Möglichkeit, sich der staatlichen Steuerlast zu entziehen, er war jedoch auch eine Antwort auf die Mobilisierung des europäischen Proletariats, insbesondere in den zehn Jahren, die auf den Mai 1968 folgten. Eine der Folgen und vielleicht auch eines der uneingestandenen Ziele dieses Prozesses war es, eine Arbeiterklasse, die sich in den Jahren zwischen 1960 und 1970 vor allem in Frankreich und Italien besonders kämpferisch gezeigt hatte, in ihre Schranken zu weisen, ja sich ihrer sogar zu entledigen. Dennoch wäre dieser Schritt zur Standortverlegung nicht im selben Tempo und im selben Umfang möglich gewesen ohne die Maßnahmen zur Deregulierung des Finanzsektors in den 1970er und 1980er Jahren, die den Kapitaltransfer von den alten Industrieländern in die sogenannten Schwellenländer begünstigten und so in den Niedriglohnländern der Schaf31fung von Subunternehmen Vorschub leisteten, die weitgehend von Auftraggebern mit Sitz in den europäischen oder nordamerikanischen Metropolen abhingen.
Alte und neue Stätten des Wohlstands
In Frankreich hat der Verlust der Arbeitsplätze in der Industrie vornehmlich die Regionen getroffen, in denen die Industrie die Hauptquelle des Wohlstands war, das heißt besonders den Norden und den Nordosten des Landes[12] ‒ Regionen, in denen die extreme Rechte ihre höchsten Wahlergebnisse erzielt, wie eine große Zahl von Studien gezeigt hat, in denen versucht wurde, regionale Geographie, Ökonomie und politische Wissenschaft miteinander zu verbinden. Andere Regionen, in denen die Industrie zunächst keine so große Rolle gespielt hatte, an denen der Deindustrialisierungsprozess aber trotzdem nicht spurlos vorübergegangen ist, sind dagegen reicher geworden. Dieses Phänomen ist umso irritierender, als es sich in zahlreichen Fällen vor allem um ländliche Regionen handelt, die bereits im Laufe der 1960er Jahre die Folgen einer Schwächung der Bauernschaft zu spüren bekommen hatten: Das »Ende der Bauern« hatte auch den Niedergang der Marktflecken und Kleinstädte nach sich gezogen, ja in manchen Gegenden sogar quasi einen Verödungsprozess ausgelöst. Es sieht allerdings ganz so aus, als ob für diese Regionen die zunehmende Vermarktung von bis dahin als randständig geltenden Gebieten von Vorteil gewesen ist, als ob sie sich der Ausbeutung neuer Ressourcen zugewandt hätten und als ob die Umwandlung von Objekten, Orten und sogar Erfahrungen, die in Bezug auf die ureigenen kapitalistischen Interessen lange Zeit nur eine nachrangige Rolle gespielt hatten, in potenzielle Wohlstandsquellen ihnen zugutegekommen wäre.
Mit Hilfe der ökonomischen Geographie lässt sich dieser zweite Entwicklungsschritt nicht direkt angehen, weil sie aufgrund 32fehlender Analysekategorien für einen solchen Prozess in diesem Fall nicht auf so fundierte Statistiken zurückgreifen kann wie im Fall der Industrie. Ihr Beitrag ist für unsere Untersuchung aber trotzdem ausgesprochen relevant. Wie Vincent Hecquet auf der Basis eines statistischen Ansatzes und Laurent Davezies[13] von der Geographie aus gezeigt haben, hängt der Wohlstand der Regionen keineswegs allein vom Entwicklungsgrad der Produktionssphäre ab, was in der »neuen ökonomischen Geographie« dazu führt, den »Beitrag der Landesregionen zum Wachstum« und »die soziale Entwicklung der Landesregionen« getrennt voneinander zu behandeln.[14] Der Niedergang der Industrieregionen unterscheidet sich nämlich deutlich vom wachsenden Wohlstand der vor allem an der West- oder an der Südküste gelegenen Regionen, in denen die Bevölkerungszahl stark gestiegen ist und Beschäftigungszahlen sowie Einkommen in die Höhe gingen. Diese Regionen mit immer größerer Gewerbetätigkeit entwickeln sich auf einer Grundlage, die, wenn man der von den Geographen verwendeten Klassifizierung folgt, nicht »produktiv«, sondern »residentiell« ist.[15] Man trifft in diesen Regionen auf eine große Zahl von Pensionären (49 Prozent aller Pensionäre), die in der Regel besser situiert sind als der Durchschnitt,[16] viele Zweit33wohnungen (66 Prozent), Bewohner auf Zeit bzw. »Pendler«, die zeitweise in den französischen Großstädten, häufig aber auch im Ausland arbeiten und leben, aber auch auf zahlreiche Arbeitslose oder Sozialleistungsempfänger (vor allem RSA ‒ Revenue de solidarité active, eine Art Grundeinkommen für Arbeitslose und Geringverdienende in Frankreich), die in diesen Regionen »Gelegenheitsjobs« finden, die sich mehr oder weniger mit Beschäftigungen im Haushalt vergleichen lassen. Diesen Autoren zufolge handelt es sich um »nicht gewerblich genutzte, dynamische Landesregionen«, die durch etwas gekennzeichnet sind, das sie als eine auf »residentiellen Ökonomien« beruhende »Entwicklung ohne Wachstum« bezeichnen. In diesen höchst »dynamischen« und höchst »attraktiven« Landesregionen (44 Prozent der französischen Bevölkerung), die über »residentielle Vorteile« verfügen, entwickeln sich Tourismus und Tätigkeiten wie die Restaurierung, Übernahme und Instandhaltung von Immobilien, die bis dahin im Niedergang begriffen waren. Auf den ländlichen Grundstücken an der Atlantik- und an der Mittelmeerküste hat die Ankunft neuer Bewohner eine starke Bautätigkeit nach sich gezogen.[17] Während in den Industrieregionen die Beschäftigungszahlen abnehmen, werden durch die Entwicklung dieser sogenannten residentiellen Landesregionen zahlreiche Stellen im Hauswirtschaftssektor geschaffen, darunter auch Arbeitsplätze für Arbeiter, die aber »im lokalen, sich auf die lokale Nachfrage richtenden Sektor (der wiederum zu weiten Teilen nicht verlagerbar ist[18])« liegen.
Entwicklungen dieser Art haben die Entfaltung und Verflechtung von Wertermittlungsformen vorangetrieben, die bis dahin zwar nicht unbekannt oder unerheblich gewesen, aufgrund ihrer unzureichenden Einbindung in die Geschäftspraktiken aber doch im Embryonalzustand verblieben waren. Die Bereicherungsökono34mie ist Bestandteil einer mit einer Art von Kapitalismus verzahnten sozialen Welt, den wir in dem Sinne als Vollkapitalismus bezeichnen, dass er verschiedene Weisen, Werte zu schaffen, miteinander verknüpft. Der Kauf und Verkauf von Artikeln aus Massenproduktion und besonders von Erzeugnissen mit einem hohen Technologisierungsgrad rangiert in dieser sozialen Welt zwar weiterhin an erster Stelle, denn Artikel dieser Art bilden die Grundlage für den überwiegenden Teil des Handelsverkehrs. Es gibt aber zahlreiche Hinweise darauf, dass sich die Vermarktung intensiver und sichtbarer als in der Vergangenheit auch in neue Richtungen orientiert hat. Im Unterschied zu dem, was in den Jahren zwischen 1960 und 1970 kritisch mit dem Ausdruck »Konsumgesellschaft« belegt wurde, wobei häufig die »passiven, manipulierten und ihren Trieben ausgelieferten« Käufer im Vordergrund standen, ist eines der Merkmale dieses Vollkapitalismus, dass er das kaufmännische Geschick stark gefördert und lohnenswert gemacht hat: Sein Horizont besteht darin, dass jeder nicht nur Konsument, sondern auch Händler ist. Weil wir diese Perspektive bis zum Äußersten weiterverfolgen, werden wir uns mit der Ware befassen und nicht in Betracht ziehen, dass man die Händler als eigenständige Kategorie untersuchen sollte.[19]
Die Expansion des Kapitalismus hat sich darin niedergeschlagen, dass Modeerscheinungen eine prononciertere und allgemeinere Rolle spielen. Davon zeugt zum Beispiel die Wichtigkeit, die Marken einnehmen, besonders im Zusammenhang mit der in der soziologischen Literatur häufig so bezeichneten Celebrity-Kultur, deren soziale Rolle vor allem ab den 1960er Jahren zahlreichen 35Arbeiten zugrunde lag[20] und deren ökonomischer Dimension in jüngster Zeit wachsende, vor allem durch die Entwicklung des Internets noch weiter zunehmende Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Außerdem hat zum Beispiel durch die Preisexplosion bei Auktionsverkäufen von sehr hohe Preise erzielenden Kunstwerken, die sich in die Nähe ökonomischer Finanzialisierungsprozesse rücken ließ, die kaufmännische Bedeutung von kulturellen Aktivitäten auf noch nie dagewesene Weise für Furore gesorgt. Wir werden allerdings den Schwerpunkt vor allem auf die Entwicklung einer Ökonomie der Aufmerksamkeit für Dinge in deren Umfeld legen, die bei einer wachsenden Zahl von Personen dazu führt, nach Objekten zu streben, die weniger wegen ihrer direkten Nützlichkeit als aufgrund ihrer Ausdruckskraft und wegen der Geschichten wertgeschätzt werden, die ihre Zirkulation begleiten. Diese Dinge offenbaren sich ihnen durch das, was ihre Spezifität ausmacht, das heißt durch ihre Differenzen, wenn man sie in die Nähe von anderen, mehr oder weniger ähnlichen Dingen rückt, und zwar etwa so, wie Sammler Objekte mit einer gewissen Familienähnlichkeit zusammentragen und vergleichen, als ob sie die Spannung zwischen ihrer Ähnlichkeit und ihrer Unterschiedlichkeit genießen wollten.
Als vorläufiger Hinweis auf einen Wandel bei der Aufmerksamkeit, die den Dingen entgegengebracht wird, mag die Bedeutung dienen, welche die Praxis des Sammelns im Laufe der letzten Jahrzehnte gewonnen hat. Die wachsende Verbreitung und Verinnerlichung einer dem Ethos des Sammlers entsprechenden Art von Aufmerksamkeit für die Dinge lässt sich nicht nur an der Anzahl von bescheidenen Sammlungen und Sammlern bemessen. Das Schema, auf dem die Praxis des Sammelns beruht und dessen kognitive und affektive Seite häufig beschrieben worden ist, hat auch bzw. vor allem eine ökonomische Dimension, die besonders ins Auge sticht, wenn man sich den Transaktionen zuwendet, zu 36denen diese von einem wohlhabenden Publikum angestrebten, außergewöhnlichen oder außerordentlichen Dinge ‒ wie zum Beispiel Kunstgegenstände oder Antiquitäten, Luxusprodukte, sogenannte Künstler- oder Architektenhäuser usw. ‒ führen. Denn Objekte dieser Art und die Instrumente, die für die Ermittlung ihres Werts sorgen, bilden den Kern der Bereicherungsökonomie. Deshalb kann man sich sogar fragen, ob nicht das Sammeln weniger als spezifische Praxis denn als generative, zu einer bestimmten Haltung gegenüber den Dingen führende Form eine Art von Operator darstellt, der es erlaubt, einen Zusammenhang zwischen den verschiedenen gewerblichen Tätigkeitsbereichen herzustellen, auf denen dieser Ökonomietypus beruht.
Von diesen Bereichen möchten wir jetzt eine erste Beschreibung geben. Dabei werden wir in der Hauptsache von Frankreich ausgehen, das einen besonders guten Beobachtungspunkt für Phänomene darstellt, deren Vorhandensein sich an vielen Orten auf der Welt feststellen lässt. Wie die industrielle Ökonomie ist auch die Bereicherungsökonomie räumlich sehr ungleich verteilt: In manchen Ländern nimmt sie große Gebiete ein, aber in anderen Ländern, in denen intensive Landwirtschaft, industrielle Aktivitäten oder Dienstleistungen dominieren, kann sie sich auf die Größenordnung eines Großstadtviertels beschränken. Insofern muss man anhand der Dichte und nicht anhand der Staaten über die räumliche Verteilung der Bereicherungsökonomie nachdenken, denn solche Verdichtungen entwickeln sich möglicherweise weiter, wie im Fall der Großindustrie, die von ein paar englischen Landkreisen aus eine große Zahl von Weltregionen erobert hat. Genauso wie von einem Industriegebiet kann man von einem Bereicherungsgebiet sprechen, für dessen Aufbau oftmals eine hohe Konzentration von Gotteshäusern (wie die romanischen oder gotischen Kirchen in vielen italienischen Städten oder die Tempel im japanischen Kyoto) genutzt wird.
37Die Omnipräsenz angereicherter Dinge
Überblickshaft lassen sich die Felder, auf denen die Bereicherung sich ökonomisch entfaltet, nur schwer beschreiben, weil ihre inhaltliche Verschiedenheit nicht geringer wird, wenn man sie unter einem Oberbegriff zusammenfasst, mit dessen Hilfe die Verbindungen zwischen ihnen herausgearbeitet und sie mit einem einheitlichen Ausdruck oder Schlagwort bezeichnet werden können. Die semantischen, rechtlichen und statistischen Rahmenbedingungen, auf denen die Beschreibung der ökonomischen und sozialen Welt beruht, sind geschaffen worden, um den Behörden den Zugriff auf eine in der Hauptsache industrielle Ökonomie zu ermöglichen. Deshalb gibt es gegenwärtig kein Kategoriensystem bzw. keinen rechnerischen Rahmen, das bzw. der es erlauben würde, die ökonomische Bedeutung, die dem verschwommenen Etwas zukommt, dessen Konturen wir versuchen zu umreißen, und die Zahl der Personen, deren Hauptbeschäftigung sich daran festmacht, relativ genau zu bestimmen. Das liegt vor allen Dingen daran, dass es eine Nähe herstellt zwischen Branchen (wie der Kunst und dem Tourismus), Tätigkeiten (wie der Leitung eines Museums oder der Herstellung von »Krokotaschen«), Status (wie zum Beispiel des prekär Beschäftigten, des Festangestellten, des Beamten und des Rentiers) und Berufen, die in der statistischen Nomenklatur auf Einheiten verstreut sind, die jeweils nach verschiedenen Logiken zusammengestellt wurden und eher im Einklang mit den alten Klassifikationen der industrialisierten Welt stehen.[21]
Darüber hinaus nähern die bestehenden Rahmenbedingun38gen sich den Beschäftigungsverhältnissen auf der Grundlage zweier Ansätze, deren Resultate sich nur schwer vereinbaren lassen, nämlich einerseits aus der Perspektive der Berufe, die jeweils angegeben werden, und andererseits aus der Perspektive der Wirtschaftszweige, die von der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung berücksichtigt werden, was die Analyse der indirekten, auf die einzelnen Tätigkeits- und/oder Berufstypen zurückführbaren Auswirkungen erschwert. Infolgedessen fehlen Statistiken, auf die sich die Totalisierungen stützen könnten, anhand derer es möglich wäre, die spezifischen Prozesse herauszuarbeiten, die im Zentrum dieser Entwicklung stehen, und ihren Verlauf zu verfolgen. Aus diesem Grund verteilt sich die Darstellung dieser ökonomischen Neuausrichtung auf die Reichen in der gängigen ökonomischen Literatur auf verschiedene Gebiete, die nach unterschiedlichen Berechnungsformen erfasst werden und häufig auf Definitionen und Kategorien beruhen, die keineswegs einheitlich sind, was ihre Gesamterhebung nicht leichter macht. Das Fehlen eines rechnerischen Rahmens und einheitlicher Kategorien für die Bereicherungsökonomie ist kein Zufall und liegt auch nicht in einer verspäteten systematischen Erfassung der Wandlungen der Realität durch die Institutionen begründet, sondern wird sich am Ende unserer Analyse als eine der Bedingungen erweisen, warum diese Ökonomie so profitabel ist.
Um das, woraus die ökonomische Dimension der Bereicherung besteht, auf eine Weise deutlich zu machen, die es unseren Lesern erlaubt, uns gestützt auf ihren ganz gewöhnlichen Sinn für die soziale Realität zu folgen, müssen wir uns zunächst den Gegenständen selbst zuwenden. Dabei wird ein erster Anhaltspunkt unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehen: Es handelt sich um die wachsende Sichtbarkeit von Objekten, deren Tausch zu einem im Vergleich mit ganz gewöhnlichen Preisen hohen oder sehr hohen Preis erfolgt. Diese Sichtbarkeit lässt sich in den Zentren der großen Metropolen feststellen, aber auch in vielen restaurierten und denkmalgeschützten Orten oder Dörfern, und steht im Kontrast zur Verarmung der Städte, Vororte oder Zonen, die vor allem durch industrielle Aktivitäten gekennzeich39net waren. Sie wird zum Beispiel auch in den für eine Leserschaft bestimmten Medien verbreitet, die zwar eher wohlhabend, aber im Durchschnitt nicht wohlhabend genug ist, um viele der Dinge zu kaufen, die nicht nur in den Werbebeilagen, sondern auch auf den redaktionellen Seiten abgebildet sind.
So veröffentlichen in Frankreich die wichtigsten Organe der Tages- und Wochenpresse, deren Leserschaft immer weiter zurückgeht, Beilagen zu diesen Themen, um Gelder aus der Luxusindustrie einzuwerben, die bei mehreren dieser durch ökonomische Verluste bedrohten Zeitungen zu ihrem Überleben beitragen. Erwähnenswert sind dabei vor allem die Beilage der Wochenzeitschrift Le Nouvel Observateur, Obsession, oder Next, die Beilage der Tageszeitung Libération, oder aber die wöchentliche Beilage der Zeitung Le Monde (M le magazine). Diese Unterhaltungsmagazine sind für ein nicht klar definiertes Publikum bestimmt, das sich aber, wenn es sich in dem Spiegel betrachtet, der ihnen darin vorgehalten wird, sowohl für gebildet als auch für wohlhabend halten kann. Das ist zum Beispiel auch beim Air France Magazine so, das im Verlagshaus Gallimard erscheint und kostenlos an die Kunden dieser Fluggesellschaft ausgegeben wird. In Bezug auf unseren Gegenstand haben diese Magazine den Vorteil, dass sie die Werbeanzeigen für Luxusobjekte (Uhren, Parfüms, Kleidung, Immobilien und Hotels der Spitzenklasse usw.) aufs Engste mit den redaktionellen Teilen verzahnen, in denen es entweder um Trendobjekte ‒ vintage oder design ‒ geht oder um für ihre Altehrwürdigkeit und für ihren Wert als Kulturerbe geschätzte Orte geht, um Kunstwerke, Kunstausstellungen und Künstler oder aber um die Gourmetküche, die als »immaterielles Kulturerbe« gilt. Diese verschiedenen, Werbung betreibenden oder redaktionellen Inhalte gehen in diesen Magazinen nahtlos ineinander über, als ob sie untrennbare Bestandteile derselben Welt wären.
Die in diesen Medien präsentierten Objekte werden weniger aufgrund ihrer Nützlichkeit oder Strapazierfähigkeit ausgewählt, wie das bei gängigen Industrieartikeln der Fall ist, sondern aufgrund ihrer intrinsischen Kostbarkeit bzw. einfach aufgrund ih40rer Andersheit und davon untrennbar auch ihres Preises. Diese Dinge werden häufig mit nationalen oder regionalen Identitätsmarkern in Verbindung gebracht, die ihre Authentizität garantieren sollen (auch wenn mit ihrer Herstellung heimlich, still und leise Subunternehmer in Niedriglohnländern betraut werden können, wie im Fall gewöhnlicher Artikel). Die Faszination, die angeblich von diesen Gegenständen ausgeht, sei auf eine Art Aura zurückzuführen, die sie umgebe und ihnen etwas Außergewöhnliches verleihe, das sie für eine Wertschätzung durch die Elite prädestiniere. Dabei kann es sich um Antiquitäten handeln; um Artikel von Luxusfirmen, die häufig als handwerklich gefertigt ausgegeben werden und von denen viele mit der Modebranche zu tun haben, wie etwa Uhren, Schmuck, Handtaschen, Kleidung; um Spitzenweine oder hochwertige Lebensmittel, die aus ausgewiesenen und geschützten »Terroirs«, also Anbaugebieten kommen. Oder aber um zeitgenössische Kunstwerke, die in Galerien gezeigt werden, auf Messen oder bei Auktionsverkäufen, die sowohl aufgrund ihrer kulturellen als auch ihrer ökonomischen Bedeutung Aufmerksamkeit erregen.[22]
In diesen Präsentationen wird nicht nur den Gegenständen wachsende Bedeutung zugesprochen, sondern auch den Welten, in denen diese Objekte entworfen werden und zirkulieren. Und vor allem den Menschen um sie herum, ob es sich dabei um »Kreative« handelt, wie Designer, Modeschöpfer, Köche, Antiquitätenhändler, Friseure, Sammler, Ausstellungskuratoren usw. oder um ihrerseits bemerkenswerte »Persönlichkeiten«, deren Name und Bild mit diesen außerordentlichen Dingen in Verbindung 41gebracht wird (wie zum Beispiel die »Musen« von Modeschöpfern oder die »Gesichter« eines Parfüms). Alle diese »Mode-, Kultur- und Geschmacksdarsteller« werden sehr häufig erwähnt und porträtiert, wenn sie Kontakt zu Künstlern im klassischen Sinne des Wortes haben, also zu Malern oder Bildhauern. Die Aufmerksamkeit ist so auf eine relativ bunt zusammengewürfelte Gruppe von Objekten gerichtet, die so behandelt werden, als würden sie sich auf der gleichen Ebene befinden (auf einer »Immanenzebene«, könnte man in einer Paraphrase von Gilles Deleuze sagen), so wie Kleidungs- und Möbelstücke, Dekorationsgegenstände, Vintage-Objekte und alte oder zeitgenössische Kunstwerke.
Schon ein Gebäude stellt für sich allein eine Verkörperung der Art von tiefgreifendem Umbruch dar, von dem hier die Rede ist: Im Turiner Lingotto-Viertel befindet sich die 1922 eröffnete, ehemalige große Werkhalle des Automobilherstellers Fiat. Das 1982 geschlossene Fabrikgebäude wurde in eine Ladengalerie mit Hotels, Restaurants und einem Kongresszentrum umgewandelt. In das Dach eines der für die Arbeiterschaft symbolträchtigsten Orte der Welt baute der italienische Stararchitekt Renzo Piano, der schon zahlreiche Museen entworfen hat, zu denen auch das Centre Pompidou in Paris gehört, die im Jahr 2002 eingeweihte Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli ein. Seither drängen sich die Menschen durch diese helle und luftige Galerie, um die Werke aus der Gemäldesammlung des früheren Fiat-Chefs zu bewundern. Was ist geschehen, dass wir von der Massenproduktion von Standardwagen und den in diesem Zusammenhang ausbrechenden Arbeitskämpfen zur stillen und ehrfürchtigen Betrachtung von Kunstwerken übergegangen sind, die der »Boss der Bosse« angeschafft hat?
Der Luxusboom
Im Zentrum dieses verschwommenen Etwas steht die Luxusindustrie. In Frankreich wird sie von einem sehr dynamischen Fachverband (dem Comité Colbert) aus organisiert. Je nach Pro42dukt hat sie Anfang der 2000er Jahre vor allem im Exportbereich ein besonders starkes Wachstum in Höhe von 6 bis 20 Prozent pro Jahr erlebt.[23] Drei Viertel des weltweiten Exports von hochwertigen Konsumgütern, der sich in den Jahren zwischen 2000 und 2011 nahezu verdoppelt hat, entfällt auf die westeuropäischen Länder, insbesondere auf Frankreich und Italien (das bei Bekleidung, Lederwaren und Schuhwerk jeweils 39, 38 und 33 Prozent der hochwertigen Exportgüter stellt), Schmuck und wertvolle Uhren kommen vor allem aus der Schweiz, während Luxuswagen unter deutschen Markennamen vermarktet werden (deren Marktanteile im Laufe der 2000er Jahre von 19 auf 29 Prozent stiegen, bevor die Verkaufszahlen von Luxuslimousinen infolge der Krise von 2008 abstürzten). Mit 11,2 Prozent Weltmarktanteil für hochwertige Qualitätsgüter (und einer Wachstumsrate von jährlich 9,8 Prozent[24]) steht Frankreich an der Spitze dieser Branche. Die Exporte von Luxusartikeln gehen vor allen Dingen in die entwickelten Länder (70 Prozent), die über den höchsten Anteil an Reichen verfügen, aber auch in die Schwellenländer (nicht zuletzt China), in denen der Konsum stark zugenommen hat: von 21 Prozent im Jahr 2000 auf 39 Prozent im Jahr 2011.[25] Zusammen mit den Golfstaaten gehören sie mittlerweile zu den größten Importeuren.[26]
Solche hochwertigen Qualitätsgüter sind zum Beispiel Spit43zenweine und -spirituosen oder Markenkleidung,[27] Parfüms und Kosmetikprodukte. Ein Teil der Produktion von einigen dieser Güter wird immer häufiger in Niedriglohnländer ausgelagert, sie werden aber in der Regel in den Ländern zusammengemischt, -gesetzt oder -genäht und etikettiert, aus denen sie eigentlich stammen sollen.[28] Dass das Herstellungsland vom Land der Etikettierung und Entwicklung eines Produkts abweicht ‒ was in der Regel geheim gehalten wird, um eine Entwertung des außerordentlichen Artikels und seine Gleichstellung mit irgendeinem gewöhnlichen Produkt zu vermeiden ‒, zeigt sich am deutlichsten an der Unterscheidung von »Made in« und »Made by« oder »Designed in«.[29] Diese Güter können also unter einem Markennamen verkauft werden, dessen nationale Identität vom Marketing herausgestellt wird, was für diese Produkte einen Mehrwert erbringt und häufig auch eine angeblich handwerkliche Fertigung »auf althergebrachte Art« vorspiegelt, die sie aus der Masse heraushebt und ihre vermeintliche Außergewöhnlichkeit verstärken soll. Doch in einer Zeit, in der Standortverlegungen und ihre Auswirkungen auf die wachsende Arbeitslosigkeit viel Kritik er44fahren, kann das Etikett »Made in France« auch dazu dienen, »das ethische Engagement und die soziale Verantwortung der Luxusfirmen« zu demonstrieren,[30] was ebenfalls den Mehrwert des Produkts erhöht.
Die Luxusindustrie stützt auch den Markt für zeitgenössische Kunst, indem sie Verbindungen zwischen berühmten Künstlern und Markenartikeln fördert, die wie handwerklich gefertigte Einzelstücke behandelt werden (zum Beispiel Hermès-Handtaschen oder Louis-Vuitton-Koffer). Die Geschichte des Kering-Konzerns gibt ein gutes Beispiel dafür ab, wie eine Firma ökonomisch dadurch besonders aufgeblüht ist, dass sie die Vermarktung von Industrieprodukten aufgegeben hat, der sie sich bis dahin gewidmet hatte, um sich ab den 2000er Jahren dem Luxussektor zuzuwenden. Die Auswirkungen derartiger Verlagerungen machen sich bis in große Bildungseinrichtungen wie der HEC (École des hautes études commerciales) oder der Sciences Po (Institut d'études politiques) bemerkbar, deren ehemalige Studierende zum Teil eine Management- oder Marketinglaufbahn einschlagen und die Ausbildungsgänge in zeitgenössischer Kunst in ihre Curricula aufnehmen. Eine der für diese Studiengänge Verantwortlichen rechtfertigt deren Erfolg mit der Bemerkung, »die Studierenden wissen sehr wohl, dass die Luxusmarken eine Verbindung zur zeitgenössischen Kunst eingehen, dass Pinault oder Arnault in Kunstwerke investieren und die großen Manager ihrer Zeit Mäzene sind. Und diese Marken sind ihre zukünftigen Arbeitgeber.«[31]
In der Welt des Luxus floriert ein Bereich ganz besonders: die »Luxuslebensmittel«, die ‒ dem Geographen Vincent Marcilhac zufolge[32] ‒ »für mehrere Hunderttausend Arbeitsplätze und für Dutzende Milliarden Euro Umsatz stehen«. »Dieser Bereich«, fügt derselbe Autor hinzu, »stellt eine Stärke Frankreichs in Be45zug auf den Handelsüberschuss dar und spielt eine wichtige Rolle für das Image der Marke Frankreich im internationalen Vergleich.«[33] Während ungefähr vom letzten Drittel des 19. Jahrhunderts bis Mitte des 20. Jahrhunderts die sich auf Lebensmittel beziehenden Eingriffe von Produzentenorganisationen und öffentlicher Hand vor allem auf eine Homogenisierung und eine Zertifizierung der Produkte gerichtet waren und auf den Kampf gegen Verfälschungen und Verunreinigungen ‒ mit Hilfe von Maßnahmen, die aus hygienischen Gründen auf die Erhöhung der Lebensmittelsicherheit für die Konsumenten zielten (insbesondere was Milch und Wein anbelangte, weil diese beiden Produkte in den Augen der Mediziner von größter Bedeutung für die Gesundheit sind)[34] ‒, hat sich die Forschung zur Verbesserung der Produktqualität in den letzten Jahrzehnten in eine andere Richtung entwickelt, wenn sie vor allem die »Authentizität«[35] in den Vordergrund stellt. Dieser Wandel ging nun aber mit einer Bedeutungsverschiebung des Ausdrucks »Qualität« einher, der zunächst für als stabil, homogen und ungefährlich geltende Produkte verwendet worden war, deren Verbesserung auf der Durchsetzung von Normen beruhte, die auch deshalb eher in die Richtung einer Standardisierung, ja sogar Industrialisierung gingen, um ihren Preis zu verringern, mittlerweile aber Lebensmittel bezeichnet, die als außergewöhnlich, nämlich eben gerade als nicht normiert gelten und zu deutlich höheren Preisen verkauft werden.
Dies lässt sich besonders gut am Fall der Weine erkennen, den Marie-France Garcia-Parpet aufs Gründlichste untersucht hat und in dem man besonders im Süden und Südwesten von der für den Konsum der einfachen Leute im Inland bestimmten Mas46senproduktion von preiswertem »gewöhnlichen Rotwein« (»Wein vom Fließband«) zu einer Produktion übergegangen ist, die sich der Herstellung von »ursprünglichen« Produkten mit »Charakter« zugewandt hat, welche auf die Weinkultur pocht und auf Export ausgerichtet ist. Diese Transformation ging mit der Aufwertung der »Terroirs« einher, die nicht nur durch besondere mineralische Eigenschaften und spezifische klimatische Bedingungen definiert wurden, sondern auch durch wiederbelebte oder erfundene Traditionen (wie die »Confrérie de Chinon«), die Kreation von Namen und den Gebrauch von historischen Bezugnahmen auf berühmte Personen, die angeblich in der Nähe des Weinbaugebiets gelebt haben (wie Rabelais bei den Loire-Weinen), sowie durch administrative Maßnahmen zur Begrenzung und Steuerung der Produktion.[36] Ein Ergebnis solcher Manöver bestand offenkundig darin, Seltenheitseffekte zu erzeugen, die als Grund für eine Preiserhöhung bei den Produkten angeführt werden können.
Allgemeiner gesagt, hat »die Schaffung von lokalen kulturellen Besonderheiten« die Bildung von »Monopolrenten« erlaubt,[37] weil der gerade anlässlich der Weine erwähnte Lokalisierungsprozess rund um die Terroirs bei einer großen Zahl von anderen Produkten mehr oder weniger lokaler Herkunft ‒ wie Trüffeln, Steinpilze, Rindfleisch (Aubrac) oder Geflügel (Bressekapaune oder -hühner) ‒ nachgeahmt worden ist, aber auch bei Produkten, deren Inhaltsstoffe importiert werden, wie Schokolade, deren Verarbeitung aber angeblich gemäß einer lokalen Tradition erfolgt. Fest verwurzelte Traditionen werden besonders häufig in Reaktion auf ökonomische oder moralische Bedenken angeführt, wie bei der Foie gras, die als nationales Symbol betrachtet wird. In diesem Fall kann man mit Michaela DeSoucey von ei47nem »Gastronationalismus« sprechen.[38]