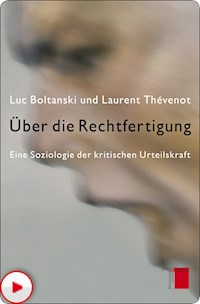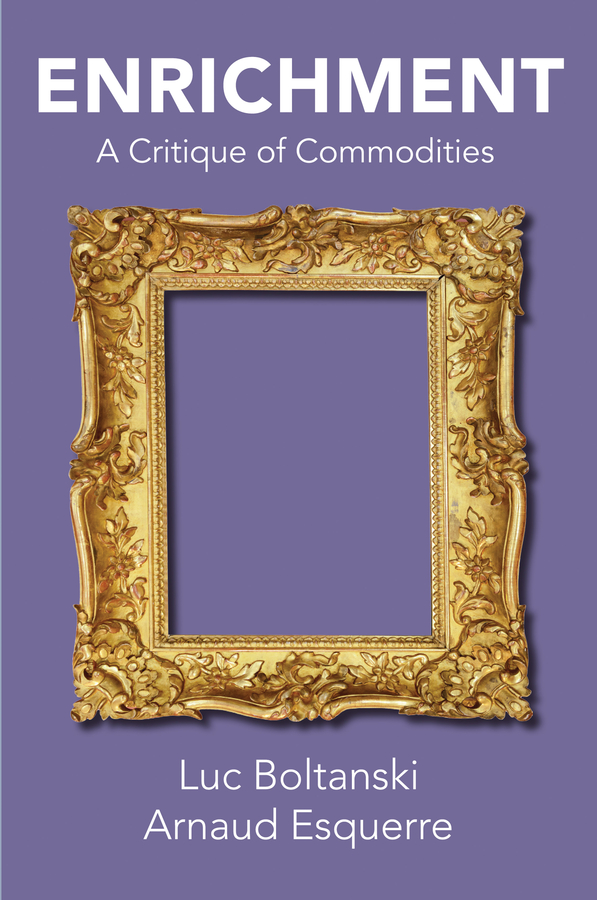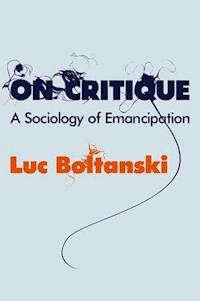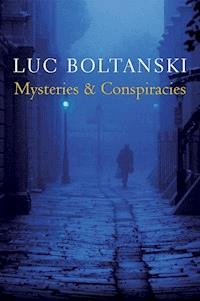21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Was hat die Kriminalliteratur mit der Paranoia und den Sozialwissenschaften zu tun? Dieser Frage geht Luc Boltanski in seinem höchst originellen Buch nach. Seine Antwort: Wie die Sozialwissenschaften entsteht auch die Kriminalliteratur um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert, und in diese Zeit fällt auch die Entdeckung der Paranoia in der Psychiatrie. Zusammen zeugen sie von einem sich zunehmend verbreitenden Zweifel an der »Realität der Realität«, der als Symptom der Moderne gelten kann. Boltanski deckt diesen faszinierenden Zusammenhang zwischen Kriminalliteratur, Paranoia und Wissenschaft insbesondere durch fulminante Analysen der Romane von Arthur Conan Doyle und Georges Simenon auf.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 782
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Was hat die Kriminalliteratur mit der Paranoia und den Sozialwissenschaften zu tun? Dieser Frage geht Luc Boltanski in seinem höchst originellen, preisgekrönten Buch nach. Seine Antwort: Wie die Sozialwissenschaften entsteht auch die Kriminalliteratur um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert, und in diese Zeit fällt auch die Entdeckung der Paranoia in der Psychiatrie. Zusammen zeugen sie von einem sich zunehmend verbreitenden Zweifel an der »Realität der Realität«, der als Symptom der Moderne gelten kann.
Boltanski deckt diesen faszinierenden Zusammenhang zwischen Kriminalliteratur, Paranoia und Wissenschaft insbesondere durch fulminante Analysen der Romane von Arthur Conan Doyle und Georges Simenon auf. Während in England der Privatmann Sherlock Holmes durch die Lösung von Rätseln und Komplotten in der englischen Oberschicht die Stabilität der Realität wiederherzustellen sucht, ist es in Frankreich der asketische Beamte Maigret, der in den Pariser Milieus seine Nachforschungen anstellt. Auf brillante Weise verknüpft Boltanski seine literatursoziologischen »Ermittlungen« zur Kriminal-, Spionage- und Verschwörungsliteratur mit solchen zum Paranoia-Diskurs in der Psychiatrie und zur Entstehung der sozialwissenschaftlichen Erforschung der sozialen Realität: Wie der Detektiv oder Kommissar sucht auch der Paranoiker oder Sozialwissenschaftler nach der Wirklichkeit hinter der sozialen Wirklichkeit. Ein Meisterstück!
Luc Boltanski, geboren 1940 und ein Schüler von Pierre Bourdieu, ist einer der gegenwärtig prominentesten französischen Soziologen und Forschungsdirektor an der École des Hautes Études en Sciences Sociales. International bekannt wurde er sowohl durch seine maßgeblichen Beiträge zur Theorie einer pragmatischen Soziologie der Kritik als auch durch seine Analysen des neuen Geists des Kapitalismus. Für sein Buch Rätsel und Komplotte erhielt er 2012 den Prix Pétrarque de l'essai France Culture/Le Monde.
Zuletzt erschienen
Soziologie der Abtreibung. Zur Lage des fötalen Lebens, 2007
Luc BoltanskiRätsel und Komplotte
Kriminalliteratur, Paranoia,moderne Gesellschaft
Aus dem Französischenvon Christine Pries
Titel der Originalausgabe: Énigmes et complots.Une enquête à proposd'enquêtes © Éditions Gallimard, Paris, 2012
Die Veröffentlichung erfolgt mit freundlicher Unterstützungdes Französischen Ministeriums für Kultur – Centre National du Livre
und der Maison des sciences de l'homme.
Ouvrage publié avec le concours du Ministère francais chargé de
la culture – Centre National du Livre et la Maison des sciences de l'homme.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation
in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet
über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2013
Der vorliegende Text folgt der Erstausgabe 2013.
© dieser Ausgabe Suhrkamp Verlag Berlin 2013
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Zur Gewährleistung der Zitierbarkeit zeigen die grau hinterlegten Ziffern die jeweiligen Seitenanfänge der Printausgabe an.
Satz: Hümmer GmbH, Waldbüttelbrunn
Inhalt
Vorwort 13
Erstes KapitelREALITÄT/gegen/Realität 21
Aristide Valentins Londoner Odyssee 21
Was unter einem »Rätsel« zu verstehen ist 24
Kriminalroman versus phantastische Erzählung und Schelmenroman 27
Die Verfassung der Realität: Reales versus Realität 36
Gesellschaftsroman, Kriminalroman, Spionageroman 40
Die Realität in der Krise: Komplottform und Untersuchung 43
Realität und Nationalstaat 46
Worum es im Kriminalroman und Spionageroman geht 50
Kriminalroman und Demokratie 62
Der englische Staat und der französische Staat 64
Der Polizist und der Detektiv 69
Kriminalroman, Spionageroman und Soziologie 74
Kriminalroman und Spionageroman als Transformationssysteme 80
Zweites KapitelDie Untersuchungen des Londoner Detektivs 87
Der bindungslose Detektiv 87
Herren und Diener 92
Legalität und Normalität 103
Der Detektiv als Mann der Tat 113
Skandale und Affären 121
Wie lässt sich ein Skandal vermeiden? 128
Klassengesellschaft und Rechtsstaat 135
Konservative Kriminalerzählung und kritischer Krimi 143
Drittes KapitelDie Untersuchungen des Pariser Polizisten 151
Die französische Quelle des Kriminalromans 151
Vom sozial ausgerichteten Fortsetzungsroman zum Justizroman 153
Die zwei Gesichter des Staates: Administrative Kontinuität und politische Unstetigkeit 160
Kommissar versus Detektiv 168
Der gespaltene Maigret 172
Polizeimaßnahmen 176
Die Kompetenz des Ermittlers 180
Maigrets Anthropologie 189
Die persönliche Macht des einfachen Verwaltungsbeamten 196
Maigret in seinem Schloss 201
Der Kriminalroman aus Sicht des Staates 207
Die sozialen Grundlagen der verbrecherischen Phantasie 211
Viertes Kapitel Die Identifizierung von Geheimagenten 229
Der Spionageroman als Weiterführung des Kriminalromans 229
Die zwei Zustände des Staates 232
Spionageroman und Kriegsroman 235
Wer ist der Feind und wo befindet er sich? 237
Die neununddreißig Stufen als Prototyp des Spionageromans 240
Thema und Variationen 246
Der Staat im ursprünglichen Spionageroman 248
John Buchans implizite Soziologie 251
Der Ort der Macht 254
Staat und Nation; Volk und Kapitalismus 257
Die Judenfrage 262
Die fehlende Masse der Kausalität 266
Rund um die Protokolle der Weisen von Zion 268
Die Kehrtwende 277
Über dem Komplott 283
Der Spiegel der Komplotte 286
Die Symmetrisierung der Anschuldigungen 291
Die Enthüllung, dass der Staat ein Komplott darstellt 296
Fünftes KapitelDie endlose Untersuchung der »Paranoiker« 307
Komplott und Paranoia 307
Eine klinische Deutung der Paranoia 309
Die ersten Paranoia-Konzeptionen 314
Der Ressentimentmensch als Verkörperung der Moderne 318
Der Aufstand der frustrierten Intellektuellen 324
Nihilismus, Ambivalenz und Ressentiment 328
Von der Individualpathologie zur Sozialpathologie 335
Liberalismus oder … Paranoia 339
Die Paranoia-Epidemie 349
Woran erkennt man Verschwörungstheorien? 353
Was ist ein Komplott? 362
Wie weit soll die Untersuchung gehen? 368
Akzeptables und Inakzeptables 379
Die Grammatik der Normalität 385
Die Grammatik der Wahrscheinlichkeit 389
Sechstes KapitelDie Policey der soziologischen Untersuchung 399
Die Soziologen und ihre »Dummheiten« 399
Die Frage der Kausalität 402
Juristische Entitäten, soziologische Entitäten und narrative Entitäten 409
Der »Aberglaube« der Sozialwissenschaften 416
Wie kann man Poppers Fluch entgehen? 425
Netzwerke und Seilschaften 440
Wie soll man mit der Multipositionalität umgehen? 444
Soziologische Untersuchungen, journalistische Untersuchungen, polizeiliche Untersuchungen 449
Das Ereignis in journalistischen Schilderungen und soziologischen Studien 461
EpilogUnd die Geschichte kopierte die Literatur 473
Danksagung 483
Namenregister 487
Sachregister 495
11»Daß die Geschichte die Geschichte kopiert haben sollte, war schon bestürzend genug; daß die Geschichte die Literatur kopieren soll, ist unfaßbar …«
Jorge Luis Borges,»Thema vom Verräter und vom Helden« (Kunststücke, 1944)
13Vorwort
In diesem Buch geht es um die Figuren des Rätsels, des Komplotts und der Untersuchung. Es versucht zu verstehen, warum diese Figuren für die Vorstellung von der Realität seit dem Ende des 19. und dem Beginn des 20. Jahrhunderts immer wieder eine so bedeutende Rolle gespielt haben. Es nimmt zunächst Werke zweier für ein breites Publikum bestimmter literarischer Gattungen zum Gegenstand, in denen diese Figuren entfaltet wurden: den Kriminalroman und die Spionagegeschichte – und zwar in ihrer ursprünglichen Form, das heißt ungefähr von Ende des 19. bis Mitte des 20. Jahrhunderts (Kapitel 2, 3 und 4). Indem es danach die Thematik der Untersuchung – die den Kern des Kriminalromans bildet – und die des Komplotts – die das Hauptthema von Spionageromanen ist – entwickelt, gelangt das Buch zu Fragen, die nicht nur für die Vorstellung von der Realität in der Populärliteratur von Interesse sind, sondern auch für die neuen Arten, die Realität zu problematisieren, die mit der Entwicklung der Wissenschaften vom Menschen einhergehen. Diese haben die Untersuchung zu ihrem Hauptinstrument gemacht. Aber sie haben auch versucht, einen Verfahrensrahmen aufzustellen, der es erlaubt, Untersuchungen mit Anspruch auf »wissenschaftliche« Gültigkeit von den zahlreichen Ermittlungsformen zu unterscheiden, die sich in den Gesellschaften, die ihr Gegenstand waren, entwickelten – ob es sich dabei nun um polizeiliche Untersuchungen und/oder ihre fiktionalen Inszenierungen handelt, um journalistische Untersuchungen beziehungsweise Recherchen oder aber um Untersuchungen, die von manchen sozialen Akteuren angestellt werden, wenn sie sich daranmachen, die ihrer Ansicht nach realen, aber verdeckten Ursachen der Übel zu enthüllen, die sie erleiden.
Die geistes- und sozialwissenschaftlichen Bestandteile dieser Arbeit sind vor allem auf drei Gebieten entwickelt worden. Ers14tens auf dem Gebiet der Psychiatrie, die Anfang des 20. Jahrhunderts eine neue nosologische Entität erfunden hat: die Paranoia. Eines von deren Hauptsymptomen ist die Neigung, endlose Untersuchungen anzustellen, die in den Wahn führen können. Zweitens auf dem Gebiet der politischen Wissenschaft, die die Problematik der Paranoia aufgreift, wobei sie sie von der psychischen auf die soziale Ebene verschiebt und zum einen das Komplott beziehungsweise die Verschwörung zum Gegenstand macht und zum anderen die Neigung, die historischen Ereignisse unter Bezugnahme auf »Verschwörungstheorien« zu erklären (Kapitel 5). Das dritte berücksichtigte Gebiet ist das Gebiet der Soziologie. Es werden hier besonders diejenigen Probleme weiterverfolgt, auf die diese Disziplin stößt, wenn sie spezifische – so genannte soziale – Formen von Kausalität zu entwickeln und die individuellen oder kollektiven Entitäten zu bestimmen sucht, denen die Ereignisse zugeschrieben werden können, die das Leben von Personen, von Gruppen oder aber den Lauf der Geschichte durchziehen (Kapitel 6).
Die Verknüpfung dieser anscheinend disparaten Gegenstände erfolgt durch einen Analyserahmen, der im ersten Kapitel vorgestellt wird, das von daher als allgemeine Einleitung gelesen werden kann. Dieser Rahmen versucht, die sozialen und politischen Umstände näher zu erfassen, unter denen die Figur des Rätsels und die Figur des Komplotts an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert zu Tropen geworden sind, die sowohl auf dem Gebiet der Fiktion als auch auf dem Gebiet der Deutung der historischen Ereignisse und der Funktionsweise von Gesellschaften eine herausragende Rolle spielen sollten. Meine These lautet, dass zwischen den Fragen in Bezug auf die Vorstellung von der Realität und dem Wandel, dem im fraglichen Zeitraum die Art und Weise unterworfen ist, wie die Realität selbst zustande kommt, eine Verbindung besteht. Im Zentrum dieser Analysen steht das Verhältnis von Realität und Staat. Als spezifischer Gegenstand kann das Rätsel nämlich nur auftreten, wenn es sich von einer gefestigten und vorhersehbaren Realität abhebt, deren Fragilität vom Verbrechen aufgedeckt wird. Und es ist der Na15tionalstaat, so wie er sich Ende des 19. Jahrhunderts entwickelt, dem sich das Projekt einer Gestaltung und Vereinheitlichung der Realität beziehungsweise, wie es die heutige Soziologie nennt, ihrer Konstruktion für eine Bevölkerung, auf einem Territorium, verdankt. Aber dieses im eigentlichen Sinne demiurgische Projekt sieht sich mit einer Vielzahl von Hindernissen konfrontiert, in deren Zentrum die Entwicklung des Kapitalismus steht, die auf nationale Grenzen keine Rücksicht nimmt.
Die Figur des Komplotts wiederum richtet sich auf Verdachtsmomente in Bezug auf die Machtausübung. Wo befindet sich die Macht wirklich,[1] und wer hat sie in Wahrheit [en réalité ] inne? Die staatlichen Autoritäten, die diese Last eigentlich auf sich nehmen sollen, oder andere Instanzen, die im Dunkeln agieren, Bankiers, Anarchisten, Geheimbünde, die herrschende Klasse usw.? Auf diese Weise bauen sich politische Ontologien auf, denen eine geteilte Realität Halt gibt: Einer vordergründig sichtbaren, aber trotz ihres offiziellen Status trügerischen Oberflächenrealität steht eine tiefe, verdeckte, bedrohliche, inoffizielle, aber sehr viel realere Realität gegenüber. Die Abenteuer des Konflikts zwischen diesen beiden Realitäten – REALITÄT/gegen/Realität – bilden den roten Faden des vorliegenden Buches. Sie werden darin in verschiedenen Facetten entfaltet. Das erstmalige Auftreten und die sehr schnelle Entwicklung erst des Kriminalromans und dann des Spionageromans, die Identifizierung der Paranoia durch die Psychiatrie, die Entwicklung der Sozialwissenschaften und insbesondere der Soziologie stehen – als Prozesse, die alle ungefähr zeitgleich ablaufen – so hinter einer neuen Art und Weise, die Realität zu problematisieren und die ihr innewohnenden Widersprüche zu bearbeiten.
Das Buch endet mit einem Epilog, der als Ersatz für den unmöglichen Abschluss einer Geschichte, die offenbar noch weit 16vom Erreichen ihres Endes entfernt ist, auf das Gebiet der Literatur zurückkommt. Aber er tut dies anlässlich eines Werkes, Franz Kafkas Prozeß, das mit einer Intensität, deren Genialität von den verschiedensten Kommentatoren immer wieder gepriesen worden ist, die Hauptfäden zusammenzieht, deren Knäuel wir hier – wenn auch nur ein wenig – zu entwirren versucht haben. Der Prozeß nimmt die Themen des Rätsels, des Komplotts und der Untersuchung, die den Kern von Kriminalromanen und Spionagegeschichten bilden, wieder auf. Indem er aber ihre Ausrichtung umkehrt und ihre Dispositive verkehrt, enthüllt er die beunruhigende Realität, die diese scheinbar harmlosen und unterhaltsamen Geschichten verbergen.
Natürlich kann man den Entschluss zweifelhaft finden, sich beim Aufgreifen der Frage der Realität zunächst einmal auf einen Textkorpus zu stützen, der aus Werken besteht, die sich bewusst als Fiktionen darstellen. Vor allem wenn es sich, wie das hier der Fall ist, um Erzählungen handelt, die üblicherweise der Imagination möglichst freien Lauf lassen, und zwar in der ausdrücklichen Absicht, den Leser zu unterhalten, und das heißt eben gerade, ihn von den Schwierigkeiten und Zwängen des Alltags und dadurch des Realen abzulenken. Man kann es jedoch auch so sehen, dass hauptsächlich durch die Vermittlung von Kriminalromanen und Spionagegeschichten Verunsicherungen in einer breiten Öffentlichkeit zum Ausdruck kamen, die eben weil sie den Kern der politischen Dispositive betrafen und die Leitlinien der Moderne selbst in Frage stellten, außerhalb von begrenzten Zirkeln nur sehr schwer direkt angesprochen werden konnten. Dann wäre die Ungewissheit in Bezug auf das, was man die Realität der Realität nennen kann, gerade wegen ihrer Schlüsselstellung in Richtung auf »das Imaginäre« umgeleitet worden.
Es besteht heute weitgehende Einigkeit darüber, dass Kriminalroman und Spionageroman auf dem Gebiet der Fiktion zu den hauptsächlichen Neuerungen des 20. Jahrhunderts zählen. In der englischen und französischen Literatur sind diese Gattungen Ende des 19. Jahrhunderts und in der ersten Hälfte des 1720. Jahrhunderts ganz unvermittelt in Erscheinung getreten und haben sich mit bemerkenswerter Geschwindigkeit erstaunlich weit verbreitet. Zunächst waren diese auf die Figuren des Rätsels, des Komplotts und der Untersuchung hin ausgerichteten narrativen Formen Teil der so genannten Populärliteratur, doch dann haben sie sich rasch auf die anspruchsvolle Literatur ausgeweitet, die sich ihrer bevorzugten Themen annahm. Aber das Auftreten und die sehr rasche Entwicklung dieser Gattungen sind nicht nur für die Geschichte der westlichen Literatur von Interesse. Kriminal- und Spionagegeschichten, die sich seit Beginn des 20. Jahrhunderts zunächst schriftlich[2] und dann durch Kino und Fernsehen unaufhörlich vervielfältigt haben, sind heute die verbreitetsten narrativen Formen, und zwar weltweit. Dadurch spielen sie eine herausragende Rolle für die Vorstellung von der Realität, die sich von nun an allen menschlichen Wesen darbietet, sogar Analphabeten, wenn sie Zugang zu den modernen Medien haben. In diesem Sinne bilden diese Erzählungen bevorzugte Gegenstände für einen soziologischen Ansatz, der in Abkehr von einer strengen Dokumentenauswertung versucht, bestimmte symbolische Formen und besonders politische Fragestellungen wieder aufzugreifen, die sich im Laufe des 20. Jahrhunderts entwickelt haben.[3] Und zwar ein wenig in der Art und Weise, wie Geschichtswissenschaft und Philosophie die homerischen Epen für die Analyse der symbolischen Strukturen des an18tiken Griechenland heranziehen konnten oder die klassische Tragödie für die Erforschung der Vorstellungen von Macht im Frankreich Ludwigs XIV.
Auf begrifflicher Ebene war diese Arbeit für mich eine Gelegenheit, Fragen anzuschneiden, die ich bis dahin sorgfältig vermieden hatte, weil ich nicht nur nicht wusste, wie ich sie lösen, sondern weil ich noch nicht einmal wusste, wie ich sie formulieren sollte. Die erste ist die Frage des Staates, die für die Soziologie wahrscheinlich am schwersten zu stellen ist, und zwar vielleicht gerade aufgrund der ursprünglichen Verbindungen, die zwischen jenem Machtdispositiv und diesem Erkenntnisdispositiv bestehen. Ich möchte auch die Frage der sozialen Kausalität erwähnen, die von der gegenwärtigen Soziologie weitgehend fallengelassen worden ist; die Frage der für die soziologische Analyse relevanten Entitäten; die Frage der Vergleichsmaßstäbe (Mikro- und Makrosoziologie); und schließlich die Frage des Platzes, der den Ereignissen in den Beschreibungen, die unsere Disziplin vornimmt, eingeräumt werden sollte. Der Leser sei unbesorgt: Keines dieser großen Probleme findet hier eine befriedigende Lösung. Dass ich es aber endlich gewagt habe, ihnen ins Gesicht zu sehen, war für mich gleichwohl eine Erleichterung.
Dieses Buch war auch eine Gelegenheit, Begriffe anzuwenden, die durch ihre Bearbeitung in früheren Arbeiten jetzt schon reibungsloser funktionieren, wie Ungewissheit, Prüfung beziehungsweise Bewährungsprobe, Affäre, Kritik und vor allem eben gerade Realität als konstruierte Realität, die sich als ein kausales Netz darstellt, das in einer Weise auf vorab festgelegten Formaten beruht, dass Handlungen vorhersehbar werden. In Soziologie und Sozialkritik, das 2009 auf Französisch erschien,[4] habe ich zu zeigen versucht, dass die Idee der »Konstruktion der Realität«, die heute zum durchschnittlichen soziologischen Handwerkszeug gehört, nur unter der Bedingung sinnvoll ist, dass man 19die Art und Weise analysiert, wie sich die Realität an die Oberfläche dessen heftet, was ich in demselben Buch die Welt nenne (eine Unterscheidung, die im ersten Kapitel des vorliegenden Buches klarer wieder aufgenommen wird). Alles, was geschieht, geht aus der Welt hervor, aber auf sporadische und ontologisch nicht beherrschbare Weise, während die Realität, die auf einer Auswahl und Gestaltung einiger Möglichkeiten, die die Welt bietet, zu einem bestimmten Zeitpunkt beruht, für den Soziologen, den Historiker und auch für die sozialen Akteure ein Arrangement bilden kann, das sich insgesamt zum Gegenstand eines synthetisierenden Zugriffs eignet. Eines der in diesem Buch verfolgten Ziele ist es daher auch, das in Soziologie und Sozialkritik vorgelegte Begriffssystem mit Fleisch zu versehen.
Ich muss gleichwohl hinzufügen, dass ich mir, als ich es schrieb, gewünscht habe, dass auch Leser, die keine Soziologen, sondern Vertreter anderer Disziplinen (oder gar keiner Disziplin) sind, Interesse an der Lektüre dieses Textes finden könnten. Eines meiner Hauptanliegen bestand darin, symbolische Formen wieder aufzugreifen, die sich, weil sie an den Rändern der sozialen und politischen Realität liegen – dort, wo sie am handfestesten ist und fiktional besonders phantasievoll dargestellt wird –, weder dem Einsatz der klassischen soziologischen Methoden noch dem Rückgriff auf die Mittel, die die Literaturwissenschaft bereitstellt, ohne weiteres anbieten. Dies setzte eine Wiederbelebung der Verbindungen voraus, die die Soziologie immer schon in die Nähe des weiten Bereichs der »Geisteswissenschaften« gerückt haben. Auf diese Weise hoffte ich, einen Beitrag zur Analyse der politischen Metaphysiken zu leisten, die sich nicht notwendig in die kanonischen Formen der politischen Philosophie eingeschrieben, das vorige Jahrhundert aber trotzdem geprägt haben und aller Wahrscheinlichkeit nach auch in unserem jetzigen weiter herumspuken.
[1] [A. d. Ü.: Frz. réellement; wo im Folgenden auf Deutsch die Anspielung auf die »Realität« oder das »Reale« nicht wörtlich wiedergegeben werden kann, wird in eckigen Klammern auf den französischen Ausdruck verwiesen. Auch alle anderen Anmerkungen und Ergänzungen der Übersetzerin werden im Weiteren durch eckige Klammern angezeigt.]
[2] Die Untersuchung von Annie Collovald und Erik Neveu über Kriminalromane und ihre Leser zeigt, dass dieser Verlagsbereich in Frankreich beständig expandiert, was sich vor allem in der wachsenden Zahl von Verlegern und Reihen sowie durch die Diversifizierung von Autoren und Themen äußert. Die Kriminalliteratur ist keine Populärliteratur in dem Sinne, dass sie zuvörderst die unteren Bevölkerungsschichten erreicht. Die Leser rekrutieren sich aus allen Gesellschaftsschichten, wobei die Angestellten, die Vermittlungsberufe, aber auch Führungskräfte und Geistesarbeiter besonders zahlreich vertreten sind (siehe Annie Collovald/Erik Neveu, Lire le noir.Enquête sur les lecteurs de récits policiers, Paris, Bibliothèque du Centre Pompidou, 2004, S. 59-63 und 336-338).
[3] Über den unterschiedlichen Gebrauch, den die Geschichtswissenschaft, aber auch die Soziologie von der Literatur machen kann, siehe Judith Lyon-Caen/Dinah Ribard, L'historien et la littérature, Paris, La Découverte, 2010.
[4] Luc Boltanski, De la critique. Précis de sociologie de l'émancipation, Paris, Gallimard, 2009 [dt.: Soziologie und Sozialkritik, Berlin, Suhrkamp Verlag, 2010].
21Erstes KapitelREALITÄT/gegen/Realität
Aristide Valentins Londoner Odyssee
Mit der Erzählung »Das blaue Kreuz« beginnt Father Browns Einfalt, der erste von fünf Bänden, die die von G. K. Chesterton zwischen 1911 und 1935 veröffentlichten Kriminalgeschichten enthalten.[1] Der Held dieser Geschichten – der Detektiv – ist ein katholischer Priester von kleinem Wuchs und ganz gewöhnlichem Aussehen: Father Brown. Er sieht sich einem großen Verbrecher gegenüber, einem Genie in der Kunst des Verbrechens: Flambeau, der aus Frankreich stammt, aber international, ja sogar weltweit agiert und von der Polizei mindestens dreier europäischer Länder gejagt wird – bevor es, wie man in den folgenden Geschichten sehen wird, Father Brown gelingt, ihn umzudrehen und zu einem wertvollen Mitstreiter bei der Aufgabe zu machen, eine Lösung für die Rätsel zu finden, die wie aus dem All in unsere Erdatmosphäre schießende Sternschnuppen immer wieder in unsere Welt eindringen und den anscheinend so stabilen und geordneten Aufbau der Realität durcheinanderbringen.
Am Anfang von »Das blaue Kreuz« hat sich ein französischer Detektiv – Aristide Valentin – nach England begeben, um Flambeau zu jagen, von dem er nicht mehr weiß, als dass er sich ebenfalls jenseits des Ärmelkanals befindet. Valentin ist ein waschechter Franzose und von daher der Vernunft verpflichtet. Aber gerade weil er weiß, wie die Vernunft beschaffen ist, kennt er durchaus auch ihre Grenzen. Außerdem weiß er, dass es die Vernunft unter Umständen erforderlich macht, dem die größte Aufmerksamkeit zu schenken, was sich ihr zu entziehen scheint. 22Und da Valentin über keinerlei Fährte verfügt, stehen ihm alle möglichen Ermittlungswege offen; keinem von ihnen scheint ein Vorrang vor den anderen zuzukommen. Valentin weiß nicht nur nicht, wo sich Flambeau befindet, sondern auch nicht, was diesen nach London getrieben hat – notwendigerweise kriminelle Machenschaften, die er geplant hat, auf deren Durchführung es aber bisher keinerlei Hinweise gibt. Valentin optiert daher für eine Vorgehensweise, die darin besteht, sich als aufmerksam gegenüber den kleinsten Ereignissen zu erweisen, die anscheinend sinnlos sind, sich aber eben dadurch als Rätsel darstellen.
Auf den ersten Seiten von »Das blaue Kreuz« irrt Valentin durch die Straßen von London. Er sucht nicht nach Indizien (wie Sherlock Holmes), weil er ja nicht einmal weiß, auf welchen kriminellen Tatbestand gewisse besondere Vorkommnisse hinweisen könnten, was es wiederum erlauben würde, zwischen diesen Vorkommnissen und jenem Tatbestand eine Referenzbeziehung herzustellen. Er erweist sich vielmehr einfach als aufmerksam gegenüber jedem Ereignis, das den Charakter eines Rätsels im eben beschriebenen Sinne hat. Erstes Rätsel: In der Absicht, ein englisches Frühstück einzunehmen, geht er zunächst in ein Restaurant – ein ruhiges, einfaches Restaurant, das altmodisch wirkt – und bestellt einen Kaffee und ein pochiertes Ei. Als er Zucker in seinen Kaffee schütten will, bemerkt er zu seinem großen Erstaunen, dass die Zuckerdose keinen Kristallzucker enthält, wie er es erwartet hatte, sondern Salz. Als er daraufhin den Salzstreuer untersucht, stellt er fest, dass der mit Zucker gefüllt ist. Auch der Kellner, den er gerufen hat, gesteht diese Merkwürdigkeit ein und schreibt sie dem Tun zweier Priester zu, einem großen und einem kleinen, beide ruhig und ehrwürdig, die einige Zeit zuvor am selben Tisch eine Suppe zu sich genommen haben. Warum eine solche Zuschreibung? Weil, erklärt der Kellner, der eine der beiden Priester sich zwar normal verhalten habe (er hat die Rechnung bezahlt und ist gegangen), der andere dagegen aber noch einen Augenblick geblieben sei, seine Suppentasse gepackt und ihren Inhalt an die Wand geschüttet habe (zweites Rätsel).
Valentin verfolgt seinen Weg weiter aufs Geratewohl und stößt 23vor dem Schaufenster eines Feinkostladens auf einen Stand mit Früchten: Orangen und Nüsse. Auf dem Stapel Nüsse steht nun aber (drittes Rätsel) das Schild »Mandarinen erster Güte zu zwei Pence das Stück« und auf dem Orangenstapel »Paranüsse, Erste Wahl«. Auf seine Nachfrage hin antwortet der Händler ihm wütend, dass zwei Priester dort vorbeigekommen seien und einer von ihnen absichtlich den Orangenkorb umgeworfen habe (viertes Rätsel). Daraufhin wendet sich Valentin an einen Polizeibeamten auf der anderen Straßenseite und fragt ihn, ob er zufällig zwei Priestern begegnet sei. Der Polizist antwortet, dass diese in einen gelben Autobus gestiegen seien und einer von ihnen betrunken gewirkt habe (was ein fünftes Rätsel aufgibt, weil Priester nicht zu dem Menschenschlag gehören, den man gemeinhin morgens in angetrunkenem Zustand durch die Straßen spazieren zu sehen erwartet). Valentin nimmt selbst einen Bus dieser Farbe und setzt sich aufs Oberdeck. Nachdem er eine Weile gefahren ist, kommt der Bus an einem Pub vorbei, dessen Fensterscheibe zertrümmert ist, als ob sie einen schweren Schlag erhalten habe (sechstes Rätsel). Auf seine Nachfrage hin sagt ihm der Besitzer, dass diese Missetat von zwei Männern in Schwarz begangen worden sei. Beim Zahlen habe einer von ihnen ihm eine Summe ausgehändigt, die dreimal so hoch gewesen sei wie der Preis der verzehrten Gerichte. »Das ist für das, was ich zerschlagen werde«, habe er gesagt, und dann habe er mit seinem Regenschirm die Scheibe zertrümmert. Schließlich, siebtes und letztes Rätsel, erzählt eine Frau, der Valentin in einem bezaubernden Süßwarengeschäft begegnet ist, ihm von einem Paket, das ein Priester ihr mit der Bitte gegeben habe, es an eine bestimmte Adresse zu schicken. Und als er der Strecke dieses Pakets folgt, kommt Valentin auf die Spur des immer noch unbekannten Verbrechers und Verbrechens, die seine Anwesenheit in London rechtfertigen.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!