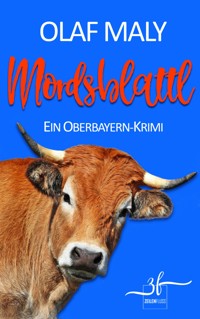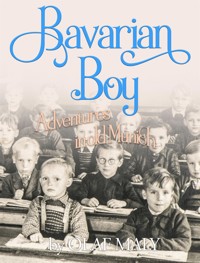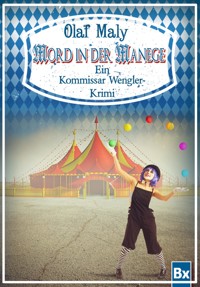4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Zeilenfluss
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Manche Familiengeheimnisse sollte man besser dort lassen, wo sie hingehören: gut vergraben!
Eigentlich hatte Hauptkommissar Franz Josef Bernrieder gehofft, sein nächster Fall sei weniger kompliziert als seine Steuererklärung. Aber nein: Karin Wendling ist tot, ihre Schwester wirkt nahezu erleichtert darüber, und die Liste der Verdächtigen liest sich wie ein Who’s-Who des Chaos.
Während Franz und seine Kollegin Amelie versuchen, Licht in das Dunkel dieser skurrilen Geschichte zu bringen, stolpern sie von einem absurden Wendepunkt zum nächsten: ein Ex-Liebhaber, der Grund zur Freude am Tod hat, ein zweifelhafter Unfall und ein leerer USB-Stick, der erstaunlich viel verrät.
Je tiefer die Ermittler graben, desto deutlicher wird, dass niemand ist, wer er zu sein vorgibt – und dass sie mehr als einer Tragödie auf der Spur sind ...
"Berghex’n" ist der sechste Band der beliebten Krimireihe „Bernrieder ermittelt”. Diese humorvolle und spannende Serie kombiniert bayerischen Charme mit raffinierten Kriminalfällen und unerwarteten Wendungen. Alle Teile der Reihe können unabhängig voneinander gelesen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
BERGHEX‘N
BERNRIEDER ERMITTELT
BUCH 6
OLAF MALY
Verlag:
Zeilenfluss Verlagsgesellschaft mbH
Werinherstr. 3
81541 München
_____________________
Texte: Olaf Maly
Cover: Vivian Tan Ai Hua
Korrektorat: Dr. Andreas Fischer
Satz: Zeilenfluss
_____________________
Alle Rechte vorbehalten.
Jede Verwertung oder Vervielfältigung dieses Buches – auch auszugsweise – sowie die Übersetzung dieses Werkes ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlags gestattet. Handlungen und Personen im Roman sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
_____________________
ISBN: 978-3-96714-522-9
VORWORT
Wenn eine Raupe sich verpuppt, tut sie das, um ein Schmetterling zu werden. Sie verlässt ihren Körper, den sie wochenlang gut mit Essen versorgt hat, um sich zu verwandeln. Sie wickelt sich ein, stirbt und löst sich dabei total auf. Alles, was bleibt, ist ein Kokon mit Flüssigkeit. Aus dieser Flüssigkeit entsteht ein bunter Schmetterling. Sie hat sich, um zum Schmetterling zu werden, selbst geopfert.
Berghexe (Chazara briseis) ist ein Schmetterling (Tagfalter) aus der Familie der Edelfalter.
1
Wenn man von Bad Tölz in Richtung Süden fährt, dann nach einigen Kilometern nach links abbiegt, kommt man in ein kleines Tal. Es ist ein schmales, enges, in das nur diese eine Straße führt. Diese endet dort. Sie führt nicht weiter. Um auf die Hauptstraße zu kommen, muss man umdrehen und zurückfahren. Geradeaus geht es nicht.
In der Mitte des Tales fließt ein Bach, der normalerweise immer gerade so viel Wasser hat, dass man es noch einen Bach nennen kann. Nur im Frühjahr, wenn der Schnee in den Bergen schmilzt, kann es sein, dass er über seine Ufer tritt. Es leben angeblich auch einige Fische in dem Gewässer, was jedoch niemand wirklich gesehen hat und bestätigen kann. Aber da es ein Bach mit klarem Wasser ist, der durch grüne Wiesen seine Bahn gelegt hat, kann man davon ausgehen.
Das ganze Tal ist nicht lang, vielleicht ein paar Kilometer oder etwas mehr, und läuft von West nach Ost. Im Süden und Norden ist es begrenzt von grünen Erhebungen, mehr Hügeln, die nur ein paar hundert Meter hoch sind. Das bedeutet, dass im Winter kaum die Sonne scheint, da die zu dieser Jahreszeit sehr tief steht und nur bedingt über die Berge kommt, die sich noch weiter im Süden auftürmen. Wenn die Wolken, die meist bis zum Grund in den Bergen hängen, sich nach oben verziehen und es zulassen, verirren sich ein paar Strahlen. Die einzige Zeit des Jahres, in der die Sonne das grüne Band beleuchtet, ist im Sommer. Dann blüht dort der artenreichste Blumenteppich und macht die ganzen Wiesen zu einem bunten Meer aus kleinen Blüten, die sich geduldig zwischen den Gräsern einbetten. Wenn es stark regnet, der Bach anschwillt, überschwemmt er manchmal die angrenzenden Wiesen. Dann bleiben sie nass und sumpfig, bis die Sonne sie wieder trockenlegt.
Etwas höher gelegen, über dem Bach, steht ein kleines Haus. Es war einmal ein Bauernhof, aber das ist schon sehr lange her. Die Bedingungen für die Bauern in diesem Tal waren nie optimal, aber als diese immer schlechter wurden und der letzte Bewohner dort gestorben war, verkauften die Erben, die in München wohnten, diesen kleinen Hof. Keiner hatte Interesse, dort zu Hause zu sein.
In dieser Abgeschiedenheit hat Marlene Dorsten diesen Besitz gekauft und sich niedergelassen. Sie war einmal in dieser Gegend unterwegs gewesen und hatte die Einsamkeit gesucht. Nur etwas Ruhe. Niemanden sehen oder hören. Sie war verloren in sich selbst. Dabei fiel ihr das Haus auf, das unbewohnt schien. Ein altes, verwittertes Schild war an die Tür genagelt und besagte, dass es zu verkaufen sei. Da wusste sie, dass es ihr Zuhause werden sollte. Es war nur ein Gefühl, das sie befiel, wie eine Vorahnung, gegen die sie sich nicht wehren wollte und konnte.
Niemand verstand, warum sie von der Stadt in eine solche Gegend zog. Sie suche die Einsamkeit, die Nähe zur Natur, sagte sie, als man sie fragte. In Wirklichkeit wollte sie mit sich und der Abgeschiedenheit allein sein, seit sie ihren Sohn im Alter von nicht einmal zehn Jahren verloren hatte. Ihr Mann hatte ihr Vorwürfe gemacht, dass sie an allem schuld sei, was natürlich nicht so war. Keiner hatte wirklich Schuld. Es war ganz einfach ein tragischer Zwischenfall, der die Familie auseinandergerissen hatte.
Bis heute weiß man nicht, was wirklich vorgefallen ist. Zu dieser Zeit hatten sie alle als Familie noch in München gewohnt. In einem kleinen Haus im Süden der Stadt. Es war ein einfaches Haus, aber sie hatten es geliebt. Es hatte einen beschaulichen Garten, einen niedrigen Zaun, alte Bäume und eine Terrasse mit einem Stoffdach, das man ein- und ausfahren konnte. Urban, ihr Mann, war Manager einer Firma, die Maschinen herstellte. Sie führten ein geruhsames Leben, wie viele es hatten. Arbeiten, die Kinder großziehen, sich ein paar schöne Tage machen und ansonsten ganz einfach leben. Sie hatten keine Probleme, alles war geregelt. Wie es eben sein sollte, in einem geordneten Dasein, das auf die Familie ausgerichtet war.
Eines Tages kam ihr Sohn, Martin war sein Name, nicht mehr nach Hause. Er hatte seine Tante, die nur ein paar Straßen weiter wohnte, besucht, wie er es oft tat. Das war nichts Außergewöhnliches. Auf seinem Heimweg ging er dann verloren. So nahm man an, wenn es auch nie belegt wurde. Man hatte lange nach ihm gesucht, Plakate an allen möglichen Flächen angeklebt und Suchmannschaften organisiert. Die Polizei gab nach ein paar Wochen auf und legte den Fall zu den Akten. Zu all den ungeklärten Vermisstenfällen, von denen es im Land jedes Jahr mehr als siebzigtausend gibt. Es war also kein Einzelfall. Der zuständige Ermittler betonte zwar, dass man nie aufgeben würde, nach ihm Ausschau zu halten, machte aber auch nicht viel Hoffnung, dass er wieder auftauchen würde. Die Akte jedenfalls würde in Wirklichkeit nie geschlossen werden und so lange offen sein, bis man Gewissheit hätte, was vorgefallen war.
Für Marlene Dorsten allerdings war es ein Einzelfall. Der einzige, der sie interessierte. Es war ihr Sohn. Was ihr Mann am Anfang sehr gut verstand, wurde ihm aber mit der Zeit immer mehr zur Last. Wochenlang ging das so, bis Marlene Dorsten es nicht mehr aushielt und sich von Urban trennte. Oder besser, er von ihr. Urbans Drang nach Ruhe war so stark, dass er sich entschloss, sein Leben komplett zu ändern. Er wollte weiterleben, nicht in so jungen Jahren bereits seelisch tot sein. Und er würde mit ihr untergehen, wenn er es nicht täte, sagte er zu ihr und packte seine Sachen. Er musste ein neues Leben anfangen, und das ging nur ohne sie. Sie wiederum konnte es nicht ertragen, mit jemandem zu leben, der ihre Trauer nicht verstehen wollte.
Marlene Dorsten jedoch schloss sich ein und führte ein Dasein nur in sich selbst. Hatte aufgehört, Teil einer Gesellschaft zu sein. Verweigerte auch jegliche Hilfe, die man ihr anbot. Und genau dieses Leben wollte sie auf diesem Hof führen. Dort im Wald, nicht weit weg von Bad Tölz.
2
Franz Josef Bernrieder lag noch im Bett, als ihm der Duft von frischem Kaffee an der Nase vorbeistrich und er sich wunderte, woher er kam. Er ahnte es natürlich, da es derer nicht viele Möglichkeiten gab, aber gewundert hatte er sich doch. Irgendwie hatte er es im Halbschlaf gar nicht mitbekommen, dass seine neue Flamme Iris sich aus dem Bett geschlichen und in der Küche zu schaffen machte. Einerseits freute er sich, dass er einmal verwöhnt wurde, andererseits wollte er lieber noch ein wenig die warme, zarte Haut spüren, die ihm die kühle Nacht so angenehm gemacht hatte.
Iris war einer der Kurgäste, die sich einsam fühlten. Was nicht ungewöhnlich war in diesem Ort, der für jüngere Leute nicht gerade attraktiv ist. Es ist auch nicht einfach für eine junge Frau, immer nur gesundes Wasser zu trinken und den Regelungen der Ärzte Folge zu leisten. Besonders, wenn man sich gar nicht so krank fühlt und sich nur mal ein wenig erholen will. Eine Freundin, die auch einmal in Bad Tölz ihre Leiden unter Kontrolle zu bringen versucht hatte, hatte ihr die Telefonnummer von Franz Josef Bernrieder gegeben. Sie meinte, er kenne sich in seiner Stadt bestens aus und werde sie bestimmt ein wenig herumführen. Oder auch einmal ausführen, wenn sie das denn wollte und ihm das auch entsprechend übermitteln würde. Und sie wollte. Deswegen hatte es sich ergeben, dass sie an diesem Sonntagmorgen in der Küche stand und Kaffee kochte.
Franz Josef Bernrieder zog sich seinen seidenen Morgenmantel an, den er einmal von einer seiner kurzen Bekanntschaften bekommen hatte. Andrea, so hatte sie geheißen, meinte, dass sie seine groben Baumwollmäntel nicht ausstehen könne. Die würden unheimlich kratzen, und das wiederum würde nicht gerade zuträglich für ihre zarte Haut sein. Beim zweiten Besuch hatte sie dann das rote, mit goldfarbenen Stickereien versehene Prachtstück mitgebracht. Chinesische Seide, mit einem großen, über den ganzen Mantel gestickten Drachen. Immer wenn sie bei ihm zu Besuch war, bestand sie darauf, dass er nur diesen anzog. Nichts anderes. Und nichts darunter. Auch wenn es nicht Iris war, die ihm den Mantel geschenkt hatte, er trug ihn gerne. Er war leicht, fast konnte man ihn nicht spüren, so sanft floss er um jeden Muskel. Etwas, was gerade Iris ausgezeichnet gefiel.
Langsam ging er die Treppe hinunter und rief leise nach seiner Gefährtin. Es war warm im Haus, wenn sich draußen auch ein wenig der Nebel niedergelassen hatte. Es sollte wettermäßig ein schöner Tag werden, und er hatte vor, mit seiner neuen Flamme an den Stausee zu fahren. Oder an die Isar. Was immer sie sich wünschte. Dann noch ein schönes Mittagessen in einem der Landgasthöfe und ein Nachmittag im Haus zum Ausklingen des Wochenendes. Es sollte allerdings anders kommen.
»Iris, wo bist denn? Des riecht ja wie in einem Café.«
»Weißt doch, wo ich bin, Franz. Wo soll ich sein, in der Küche! Einer muss ja was machen, dass wir nicht verhungern.«
»Ich bin noch nie verhungert, höchstens aus Mangel an Zuneigung, weißt eh. Ich hab dich total vermisst in unserer Kuschelecke. Grad schön war’s, und du bist einfach weg g’wesen.«
»Ja, mir kommen auch die Tränen, aber alles zu seiner Zeit. Jetzt hab ich Hunger.«
»Mei, Iris, du bist immer so praktisch, so organisiert. Lass dich doch amal geh’n. Ich mein, es is doch Sonntag.«
Inzwischen war er in der Küche angekommen. Auf dem Tisch standen schon die Teller, das Brot war bereits geschnitten und lag im Korb, die gekochten Eier standen in den Eierbechern. Sogar eine Kerze hatte sie gefunden und angezündet.
»Des macht mir richtig Angst, Iris, wenn ich des so seh. Da komm ich mir vor, als wär ich mit dir verheirat.«
»Franz, erstens sind wir nicht verheiratet, was auch gut so ist, und zweitens bekommt man es meistens nicht mehr so, wenn man erst einmal im Hafen der Ehe angelegt hat. Rein statistisch gesehen besteht die wahre Liebe nur für ein paar Jahre. Dann ist es vorbei mit dem Verwöhnen. Deswegen genieße es.«
»Des hab ich mir denkt, dass des nachlasst, wenn man erst amal den ewigen Bund g’schlossen hat. Deswegen mach ich des nicht. Außerdem sollen die Scheidungen teurer sein als wie die Hochzeiten. Und die sind heut schon sauteuer.«
Iris hatte auch noch eine CD in das Abspielgerät gelegt, das auf dem Regal neben dem Bauernschrank stand. Leichte, langsame Musik. Die CD verhieß ›Musik zum Träumen‹. Sie dachte sich, es war eher Musik zum Einschlafen. Aber es war leise, also hatte man auch die Möglichkeit, sich nebenbei zu unterhalten. Franz Josef Bernrieder gab einige Geschichten zum Besten, die er, muss man gestehen, etwas ausmalte, damit er als Held und Retter dastehen konnte. Da Iris ihn dabei immer lächelnd ansah, wusste er, dass sie ihm nur die Hälfte glaubte. Aber das war ihm genug.
Gerade als Franz Josef Bernrieder in sein Brot mit der Himbeermarmelade von der Greiner-Bäuerin beißen wollte, die, wie alle wissen, die beste Himbeermarmelade macht, die man essen kann, hörte er einen Wagen kommen.
Das war nicht schwierig, da der Weg zu seinem Haus mit Kies aufgeschüttet war, der derartige Geräusche nicht verheimlichen konnte. Er hatte das absichtlich so belassen, wie es seine Großeltern einmal angelegt hatten, da er dann immer gewiss war, ob jemand zu ihm kam. Eine Art Alarmanlage.
Manchmal konnte ja jemand kommen, den er nicht gerade ins Haus lassen wollte. Wie einmal, als ein Freund einer seiner Blumen der Nacht bei ihm angekommen war. Mitten in der Nacht. Er hatte gerade noch Zeit gehabt, sie durch den Hinterausgang, über den Balkon, aus dem Haus zu bringen, bevor der eifersüchtige Randalierer fast die Tür eingetreten hatte. Als er ihm geöffnet hatte, war er an ihm vorbeigeschossen und hatte sich erst beruhigt, als er niemanden außer ihm gefunden hatte. Dann hatten sie zur Besänftigung zusammen ein Bier getrunken, um sich einander zu bestätigen, dass es mit den Frauen manchmal schon sehr schwierig sein konnte.
Jedenfalls klingelte es kurz, nachdem er das Auto gehört hatte.
»Iris, ich glaub, wir müssen unsere Pläne verschieben. Wenn des der is, den ich vermute, dass er es is, dann hab ich wieder was zum Tun. Hab mich eh g’wundert, warum des so ruhig war in letzter Zeit.«
»Warum glaubst du das? Es kann doch auch jemand anderer sein.«
»Iris, erstens kenn ich des Geräusch von dem Wagen, und zweitens sind alle, die ich kenn, um die Zeit in der Kirch. Glaub mir, des is jemand aus meiner Dienststelle.«
Dann stand er auf und bewegte sich langsam zum Eingang. Durch das Fenster neben der Tür sah er schon den Polizeiwagen. Es war also kein netter Besuch, der überraschend vorbeischauen wollte, um ihm eine Freude zu machen. Es war der diensthabende Polizist, Korbinian Schuhnagel.
Korbinian stand schon an der Tür, als Franz Josef Bernrieder sie öffnete.
»Franz, tut mir aufrichtig leid, aber …«
»Nix tut dir leid, ein solcher Schmarren. Ich muss mich nur kurz anziehn, und dann komme ich.«
»Kannst ja auch in deinem chinesischen G’wand mitfahr’n. Des wird bestimmt eine riesengroße Gaudi, wenn die andern des seh’n.«
»Des tät euch so g’fallen, des glaub ich. Wart im Auto, ich bin gleich da.«
Dann machte er die Tür zu, sagte Iris, dass er sich anziehen müsse und sie schon einmal frühstücken solle.
Wenige Minuten später stand er wieder in der Küche, umarmte seine neue Liebe, meinte noch, dass es sicher nicht lange dauern würde und so weiter.
»Franz, wenn ihr mich in die Stadt mitnehmen könntet, des wär nett.«
»Iris, lass dir Zeit, wenn’st unbedingt wegmusst, nimm mein Auto und park des neben dem Café Zuckmeier am Hauptplatz. Ich hol des dann später ab. Glaub mir, des is besser. Wenn du aber lieber hierbleiben könnt’st, wär des natürlich schon besser. Wir ham doch noch den ganzen Sonntag. Und jetz muss ich. Ich glaub, wir ham des a bisserl eilig.«
Nach einem kleinen Küsschen und dem Versprechen, dass es nicht lange dauern würde, verließ Franz Josef Bernrieder schweren Herzens sein Haus und stieg in den Wagen, in dem Korbinian Schuhnagel ungeduldig wartete.
»So, Korbinian, wo geht’s hin?«
»Zum Schinderhof.«
»Der is doch seit Jahren leer. Da wohnt doch keiner mehr. Was is denn da?«
»Den hat jemand kauft, und die is jetz tot. Des ist alles, was ich weiß. Die Frau Hammer erwartet dich schon sehnsüchtig.«
Mit bayerischer Blasmusik, die dröhnend aus den Lautsprechern röhrte, fuhren sie auf den Schinderhof.
3
»Amelie, es is immer eine Freude, dich zu seh’n. Auch wenn es ein Sonntag is.«
»Wo du sicher lieber in der Kirch wärst als hier, ich weiß. Aber heut hamma eben was zu tun, was auch irgendwie göttlich is.«
»Weil’s tot is, die Frau?«
»Genau. Der Herr hat sie g’holt, wie man des bei uns so treffend sagt.«
»Und weil wir hier sind, hat da scheinbar jemand nachg’holfen. Sonst könnt ich ja noch in der Kirch sein.«
Der ganze Tross von Amelie Hammer, der Leiterin der Spurensicherung, war bereits am Arbeiten. Falls es Hinweise auf das Geschehen geben würde, sollte man sie finden. Die ersten Stunden nach einer Tat sind immer die wichtigsten. Viele Details können sich auflösen, verschwinden oder unlesbar werden. Wenn man selbst heute weit bessere Möglichkeiten hat, auch die noch so kleinen und winzigsten Dinge zu finden und zu analysieren. Vieles stellt sich oft erst nach den Untersuchungen heraus, wenn man alles auf dem Tisch hat. Bis dahin sieht immer alles ganz normal aus. Außer den Begleiterscheinungen bei einem Mord, versteht sich. Das ist sicher nicht normal und wird auch so behandelt.
Es war ein kleines Haus, nicht mehr als vielleicht zwei oder drei Zimmer, je nachdem, wie man das Innere interpretierte. Die weiß getünchten Mauern waren breit, wie man das so gebaut hatte in der Zeit, als es noch ein Hof gewesen war. Die winzigen Fenster ließen wenig Licht herein, schützten aber auch gut gegen die Kälte im harten Winter. Und gegen die Hitze des Sommers. Teil des Gebäudes war ein Stall, der allerdings nur wenige Tiere hatte behausen können. Heute diente dieser Trakt als Wohnzimmer, das es nicht gegeben hatte, als die Schinders noch dort wohnten. Sie hatten es nicht gebraucht. Sieben Tage arbeiten, von morgens bis abends, verlangte nicht nach einem gemütlichen Abend auf der Couch. Man stand früh auf und legte sich ins Bett, wenn der Tag zu Ende gegangen war. Die Tiere und die Sonne bestimmten das Dasein und den Rhythmus der Tage. Das war das Leben, das sie kannten. Ein anderes gab es nicht. Nur am Sonntag ging man in die Kirche und ließ die Tiere für ein paar Stunden allein.
Über dem Wohnbereich lag noch der ehemalige Speicher, in dem man das Futter für den Winter lagerte. Mit einer Bodenklappe über dem Stall, von der aus man das Heu direkt in die Tröge werfen konnte. Dieser Raum war irgendwann einmal als Büro umgebaut worden.
»Des is ein schönes, kleines Haus, Amelie. Aber jetz zeig mir erst amal, was los is. Die ham wirklich was draus g’macht. Von außen könnt man des gar nicht vermuten.«
Beide gingen gemeinsam in die Küche, die der erste Raum war, wenn man im Flur durch die erste Tür eintrat. Dort, auf dem Fliesenboden, lag eine Frau. Sie war vielleicht Mitte dreißig, nicht mehr. Bekleidet war sie mit einer Jeans und einer leichten, blauen Bluse. Wäre sie nicht auf dem Boden gelegen, könnte man meinen, sie hätte sich gerade einmal kurz hingelegt.
»Richtig tot schaut die mir nicht aus, Amelie.«
»Wie willst denn, dass die ausschaut? Voller Blut oder so? Mit vermatschtem G’sicht?«
»Nein, du weißt schon, was ich mein. Für mich sieht die aus, als würd die grad amal kurz schlafen und jetz gleich wieder aufsteh’n und uns fragen, was wir hier machen.«
»In der Küch, auf dem Boden. Franz, glaub mir, die rührt sich nicht mehr. Des nennt man ›tot sein‹.«
»Danke für die Aufklärung. Wissen wir denn schon, wie und wann die g’storben is?«
»Nein, aber in dem Alter stirbt man nicht einfach so. Da gibt’s schon einen Grund. Und den werden wir finden, da kannst dich drauf verlassen. Zeitmäßig würd ich sagen, liegt die hier so ungefähr zwei, drei Stunden. Nicht mehr. Was deine zweite Frage beantwortet.«
»Amelie, des macht mir richtig Angst, wie du mich kennst.«
Man hörte Stimmen, Leute machten Bilder, Scheinwerfer waren überall aufgestellt. Man konnte meinen, es würde ein Film gedreht. Irgendwie kam sich Kommissar Bernrieder vor, als wäre er total überflüssig. Mehr ein Störfaktor als eine Hilfe. Die Blicke mancher Mitarbeiter waren nicht sehr ermutigend und ließen ihn wissen, dass er nur im Weg stand und sich doch bitte verdrücken solle.
»Da hast ja die ganze Armee schon eing’laden, obwohl wir ja noch gar nicht wissen, ob des ein Fall is.«
»Willst du, dass alle Spuren weg sind, nur weil wir zu spät kommen sind? Dann, wenn des ein Fall is, is des zu spät, dass wir hier rumsuchen.«
»Amelie, wie immer hast du recht. Wer hat denn die Tote g’funden?«
»Ihr Schwester, Marlene Dorsten. Der g’hört des Haus hier. Die Tote heißt Karin Wendling. Die lebt in einer Wohnung in Lenggries und war hier nur, weil die auf des Haus aufpasst hat. Und die Frau Dorsten hat auch in der Wache ang’rufen.«
»Und wo is die jetz?«
»Im Wohnzimmer.«
»Dann schaun wir doch amal. Ich glaub, ich steh hier sowieso bloß im Weg, wenn ich die Blicke deiner Leut richtig versteh.«
Amelie lächelte nur ein wenig, sagte nichts, musste ihren Leuten aber recht geben.
»Nimms nicht persönlich, Franz.«
4
Frau Dorsten, die Schwester der Toten, saß auf einer alten, etwas zerschlissenen Couch, die schon ihre besten Jahre hinter sich hatte. Davor stand ein kleiner Tisch, deutsche Eiche, mit Wasserrändern von unzähligen Gläsern, die einmal darauf gestanden haben mussten. Sie zeugten von Unterhaltung, Freunden, lustigen Abenden. Zeugen aus Zeiten, an die man sich gerne erinnert. An der Seite stand eine alte Schrankwand mit Glastüren. Butzenscheiben. Man konnte nur sehr verschwommen sehen, was dahinter verborgen war. Auf dem rauen, ungehobelten Holzboden lag ein abgetretener Teppich. Es konnte ein Perser sein, war aber nicht zu erkennen. Jedenfalls war er rot und hatte geometrische Muster. Sichtbar war der Raum nicht sehr modern eingerichtet. Auch die Wände hätten einen guten Anstrich vertragen. Nun ja, dachte sich Franz Josef Bernrieder, es war eben ein altes Haus.
Früher, viel früher, als er noch Jugendlicher gewesen war, waren er und seine Freunde manchmal in dieses kleine Tal gekommen. Es war bekannt für die Abgelegenheit, Einsamkeit. Niemand war jemals dort zu sehen. Das Haus war immer abgeschlossen und verwaist gewesen. Und das schon seit Jahren. Manche Fenster waren eingeworfen, und irgendwie war es gespenstisch. Jedenfalls hatten sie sich einen Spaß daraus gemacht, neue Freundinnen damit zu erschrecken und grausige Geschichten zu erzählen, die keinen Deut Wahrheit enthielten. Aber es ging um den Spaß. Oft war das dann die letzte Begegnung mit den Mädchen gewesen, die auf solche Abenteuer sehr wohl verzichten konnten. Nicht alle genossen es, Angst zu haben.
Marlene Dorsten war mit einer Jeans bekleidet und einem dunklen Pullover, der weit über die Gürtellinie ging. Ihre Haare waren kurz geschoren und sichtlich blond gefärbt. Ansonsten hatte sie ein mehr strenges, nicht sehr liebliches Aussehen.
Sie war deutlich nervös, rauchte eine Zigarette nach der anderen, was unter diesen Umständen kein Wunder war. In einer Hand hatte sie ein Glas mit einer leicht bräunlichen, wahrscheinlich alkoholischen Flüssigkeit. Man konnte nicht genau definieren, worum es sich handelte, aber da es in einem kleinen Glas war und sie immer nur leicht daran nippte, konnte es nicht Tee sein. Sie sah kurz auf, als die beiden ins Zimmer kamen.
»Frau Dorsten, erst amal herzlichstes Beileid zu Ihrem Verlust. Ich hab g’hört, dass des Ihr Schwester is.«
Marlene Dorsten sah den Kommissar von unten an. Der Ausdruck in ihrem Gesicht zeugte nicht von Trauer, sondern eher von Erleichterung oder Gleichgültigkeit, was Franz Josef Bernrieder etwas irritierte.
»Wir waren nicht sehr eng, Herr Kommissar, falls Sie des wissen wollen. Sie sind doch der Kommissar, oder?«
»Ja, Entschuldigung. Franz Josef Bernrieder. Polizeidirektion Bad Tölz. Was meinen’s denn mit ›nicht sehr eng‹?«
Inzwischen hatten sich der Kommissar und Amelie jeder auf einen Stuhl gesetzt, den sie im Raum fanden und nahe Frau Dorsten platzierten.
»Ich hab hier g’wohnt, hab mir des Haus kauft, weil ich meine Ruh haben wollt, und die Karin, meine Schwester, hat immer nur was von mir wollen. Glauben‘s mir, es tut mir leid, dass sie g’storben is. Auf der anderen Seiten bin ich nicht ganz unglücklich da drüber.«
»Und warum genau sind Sie da nicht sehr unglücklich?«
»Meine Schwester war kein Kind von Traurigkeit, ganz im Gegenteil. Sie hat immer nur g’macht, was sie wollte, ohne Rücksicht auf andere. Sie war des auch, wo unser Sohn war, wie der verschwunden is. Zwar hat sie immer betont, dass sie damit nix zum Tun g’habt hat, aber wissen tun wir des nicht.«
»Ja, man kann sich die Familie nicht aussuchen. Was is denn mit Ihrem Sohn passiert?«
»Unser Sohn, der Martin, is bei meiner Schwester g’wesen und einfach nimmer heimkommen. Des is jetz schon Jahre her, und keiner weiß, wo er is oder ob er noch lebt. Die Letzte, die ihn g’sehn hat, war meine Schwester, weil er an dem Tag bei ihr übernachtet hat.«
»Des is interessant. Glauben’s, dass des was damit zum Tun hat, dass Ihr Schwester tot is?«
»Herr Kommissar, woher soll ich des wissen. Wie ich heimkommen bin, is sie da auf dem Boden g’legen. Des rauszufinden, sind doch Sie da, oder erwarten Sie, dass ich Ihnen sag, was passiert is?«
»Nein, natürlich nicht, aber wir wollen auch immer gern wissen, was los war, bevor wir hier herkommen und uns des Ergebnis anschauen, von dem, was passiert is. Manchmal löst des schon einige Fragen. Hat Ihr Schwester an Schlüssel g’habt zu dem Haus?«
»Ja, weil sie aufpasst hat, wenn ich amal weg hab müssen. Wie gestern. Ich hab nach München müssen, hab dort übernachtet und bin heut früh heimkommen. Und dann hab ich sie hier liegen seh’n.«
»Wo ham’s denn übernachtet, in München?«
»Wieso is des wichtig?«
»Frau Dorsten, wir müssen des fragen. Alle Leut, die irgendwie da involviert sind, müssen wir überprüfen. Des is ganz normale Routine bei uns. Also, wo ham’s übernachtet?«
»In der Pension am Englischen Garten. Rosenhof heißt die. Da bin ich immer, wenn ich in die Stadt muss.«
»Gut, dem werden wir nachgeh’n. Was ham‘s denn noch g’sehen oder so, wie’s ins Haus kommen sind? War irgendwas Besonderes? Außergewöhnliches?«
»Nix war. Ich hab die Tür aufg’macht und nach ihr g’rufen, aber da hat sich niemand g‘meldet.«
»Sie ham g’wusst, dass sie da war?«
»Aber ja, erstens hab ich ihr g’sagt, sie soll auf’s Haus aufpassen, und zweitens is ihr Auto vor dem Haus g’standen.«
»Und dann?«
»Nix, ich bin ins Haus und hab sie g’sucht. Dann hab ich sie da liegen seh’n und die Polizei g’rufen.«
»Warum die Polizei? Warum nicht einen Krankenwagen? Ich mein, wenn man jemanden am Boden findt, ruft man doch zuerst die Sanker.«
»Herr Kommissar, meine Schwester war bereits tot. Des hab ich doch g’sehn. Da braucht man nicht ein Arzt sein oder so. Die hat sich nicht mehr g‘rührt. Warum soll ich da noch die Sanitäter rufen?«
»Nur weil sich jemand nicht rührt, heißt des noch lang nicht, dass die Person tot is. Man kann auch ohnmächtig sein.«
»Ich hab ihr ein paarmal ins G’sicht g’schlagen und dann den Puls g’fühlt, da war nix.«
»Gut, des erklärt des dann schon. Ham Sie irgendwas ang’fasst, wie Sie auf die Polizei g’wartet ham? Wir müssen des wissen, falls wir irgendwelche Spuren finden.«
»Nein. Telefoniert hab ich mit meinem Handy. Dann bin ich raus und hab erst amal eine g’raucht. Und dann is ja auch schon die Polizei kommen. Aber Spuren von mir werden’s hier alle möglichen finden, weil ich nämlich hier wohn.«
Sie sagte den letzten Satz etwas erregt, fast, als wollte sie damit ausdrücken, dass man sie mit solchen dummen Fragen alleine lassen sollte. Es entstand eine kurze Pause. Frau Dorsten zündete sich wieder eine Zigarette an und goss sich noch einmal aus einer kleinen Flasche, die unter dem Tisch stand, etwas in ihr Glas. Es war, wie vermutet, Cognac. Mehr billiger Weinbrand, den man an der Tankstelle kauft und in der Hosentasche verstecken kann.
»Is da jemand, den wir vielleicht verständigen müssen, Frau Dorsten?«
»Nein, Herr Kommissar, des mach ich schon. Wir ham keine Familie mehr. Unsere Eltern sind schon lang tot. Da gibt’s nur noch meinen Ex-Mann, aber der lebt in Hamburg. Und der hat von meiner Schwester eh nix g’halten. Außerdem haben wir keinen Kontakt mehr. Er hat sein Leben, ich hab meins. Ich glaub nicht, dass ihn des unheimlich stark interessiert.«
»Dann geh’n wir davon aus, dass Sie Ihren Ex unterrichten. Geben‘s uns aber trotzdem bitte die Telefonnummer. Nur falls wir auch Fragen an ihn haben.«
Frau Dorsten war auf einmal nicht mehr gefasst und ruhig, sondern übernervös. Ihre Antwort kam lauter herüber als erwartet. »Ich weiß nicht, was der mit dem hier zu tun haben kann. Der weiß doch nicht einmal, dass ich hier wohne. Und so will ich des auch lassen.«
»Das wissen wir auch noch nicht, ob wir ihn sprechen müssen, aber es könnt ja sein. Wie war der Name von Ihrem Mann?«
»Urban. Urban Dorsten. Aber geben’s ihm bitte nicht meine Adresse. Ich will nicht, dass der hier auf einmal auftaucht.«
Frau Dorsten nahm ihr Handy, tippte einige Male darauf herum und fragte nach der Nummer des Kommissars. Dann schickte sie ihm eine Textnachricht.
»War’s des dann? Ich wollt mich erst amal beruhigen, falls Sie des versteh’n. Außerdem hab ich heut noch nix g’essen. Ich geh davon aus, dass Sie hier noch eine Weile sind, also fahr ich in die Wohnung von meiner Schwester.«
»Des versteh’n wir total, Frau Dorsten. Ihr Telefonnummer haben wir ja, falls wir noch was von Ihnen brauchen. Nur noch eine letzte Frage. Können Sie sich vorstellen, wer des getan haben könnt?«
»Sie geh’n also von einem Verbrechen aus?«
»Des wissen wir noch nicht, aber in dem Fall würd uns des helfen, wenn wir den Umkreis aller Leut hätten, mit denen Ihr Schwester verkehrt hat.«
»Des weiß ich nicht. Des müssen’s schon selber rausfinden. Wie ich schon g’sagt hab, waren wir nicht sehr eng. Und ihren Umgang kenn ich auch nicht.«
Damit stand Frau Dorsten auf, was bedeutete, dass sie das Gespräch für beendet hielt. Franz Josef Bernrieder wusste aus Erfahrung, dass ein Nachhaken nichts bringen würde, also stand auch er auf und drehte sich zur Tür. Amelie folgte ihm.
»Nur noch eine Frag, Herr Kommissar.«
»Ja?«
»Wann kann ich die Leich haben? Ich wollt einen Termin ausmachen, wann sie verbrannt werden kann.«
»Des können wir Ihnen nur sagen, wenn wir mit der Obduktion fertig sind. Des kann dauern, Frau Dorsten. Wir lassen Sie des wissen.«
»Dann machen’s bitte die Tür zu, wenn’s geh’n.«
Sie sahen noch, wie sich Frau Dorsten einen weiteren Schluck aus der Flasche gönnte. Dieses Mal brauchte sie kein Glas.
Ohne ein weiteres Wort verließen der Kommissar und Amelie Hammer das Haus. Ein kurzer Anruf in der Pension Rosenhof bestätigte die Aussage, dass Frau Dorsten dort übernachtet hatte. Allerdings konnte die Person an der Rezeption nicht sagen, ob sie nachts das Haus verlassen hatte, da niemand vom Personal zwischen acht Uhr abends und sechs Uhr morgens anwesend war.
»Also, des Alibi kannst ja auch in der Pfeife rauchen. Meiner Meinung nach hat die keins.«
»Franz, jetz geh’n wir amal davon aus, dass des stimmt, was sie sagt. Wenn nicht, werden wir des rausfinden. Bis jetz wissen wir ja nicht einmal, ob des ein Mord war. Wir haben eine tote Person, die an allem Möglichen hätt gestorben sein können.«
»Wie immer hast du recht, Amelie. Aber des is schon seltsam, find’st nicht? Keine Reaktion, kein Gefühl, keine Empathie. Immerhin war des doch ihr Schwester.«
»Des heißt gar nix, Franz. Was in die Familien so los is, weiß niemand. Manchmal nicht einmal die in der Familie selber. Da würd’st dich oft wundern. Und es is auch meistens besser, man weiß da nix davon.«
»Schaut so aus. Ich seh dich morgen im Büro. Für heut hab ich genug, und außerdem hab ich noch was vor. Machen können wir heut eh nix mehr. Und ihr habt’s noch genug zum Tun hier.«
»So schön möcht ich’s auch amal ham, Franz.«
»Ja, servus.«
5
Korbinian Schuhnagel fuhr seinen Kommissar wieder in dessen Haus zurück. Es war irgendwie still, keiner war zu sehen. Der Hund vom Nachbarn bellte. Ein Hahn krähte, und die Kirchenglocken fingen an zu schlagen. Die Messe war zu Ende. Es ging dem Mittag zu. Die Leute würden von der Andacht nach Hause gehen und sich einen gemütlichen Sonntag machen. Es war ein kühler, aber sonniger Sonntag. Franz Josef Bernrieder freute sich darauf, diesen noch mit seiner Iris am Isarstrand verbringen zu können. Vielleicht dann noch ein Bier im Biergarten zu Leberkäs und Radi. Alles Gedanken, die ihn den Tag perfekt ausklingen lassen sollten. Nur, wenn er so sah, wie still es war, war er sich nicht mehr sicher, ob das auch so sein würde.
Als er ins Haus trat, rief er nach Iris, obwohl er in diesem Moment nicht mehr viel Hoffnung hatte, dass sie noch anwesend war. Nicht ein Geräusch war zu hören. Langsam ging er in die Küche und fand einen Zettel auf dem Tisch, der ihm erklärte, was los war. Alles war perfekt aufgeräumt, das Geschirr stand in der Spüle. Gewaschen. Wenigstens das, dachte er sich.
Iris schrieb ihm, dass sie sich noch auf die Heimreise vorbereiten müsse, und sie sei sehr traurig, ihn nicht mehr zu sehen. Da sie nicht wusste, wann er käme, hätte sie ein Taxi gerufen, um ins Hotel zu kommen. Er solle nicht mehr anrufen. Es wäre wunderbar gewesen, und sie würde den Rest ihres Lebens an ihn und dieses Wochenende denken.
Franz Josef Bernrieder nahm den Zettel, lächelte in sich hinein, sah ihn sich noch einmal gut an und warf ihn enttäuscht in den Papierkorb. Dann rief er seinen Freund Gustl Kernbauer, den Herrgottsschnitzer von Gottes Gnaden, an und fragte, ob er schon etwas vorhatte. Er wollte zum Mittagessen gehen und benötigte seine Gesellschaft. Der Gustl verstand. Man musste es ihm nicht erklären. Und er freute sich, wieder einmal von seinem Freund eingeladen zu werden. Natürlich hatte der Gustl immer Zeit, sich mit seinem Freund zu treffen, besonders, wenn es darum ging, ihn zu trösten und wieder aufzubauen. ›Dafür sind Freunde schließlich da‹, war seine Devise. Und das Essen sei auch nicht zu verachten.
»Und? Is wieder weg, deine Flamme?«
»Erloschen, mein Freund. Ausgeblasen. Einfach so. Und ich hab nicht einmal ein Streichholz, dass ich die wieder anzünden könnt. Sie hat mich verlassen. Kannst du des versteh’n, Gustl? Für ein schnödes Leben irgendwo in Norddeutschland. Kannst du dir das vorstellen? Ich mein, da oben zu leben, wo die Leut mit einem Regenschirm auf die Welt kommen. Wo du froh bist, dass amal für eine Stund die Sonne scheint. Wo du nicht einen einzigen Berg siehst. Einer hat mir mal erzählt, er war da oben, und man hat ihm g’sagt, wie er g’fragt hat, wo des Hotel is, nach dem Berg soll er links abbiegen. Der is nur immer im Kreis g’fahrn und hat den Berg g’sucht und nie des Hotel g’funden. Dann is er wieder heim.«
»Darüber muss ich mir keine Gedanken machen, Franz, weil des für mich nie infrage käm. Ich geh nicht weg von hier. Aber b’sonders traurig bist ja nicht grad. Ich mein, wenn ich dich so anschau, seh ich keine dicken Tränen auf deine Backen.«
»Was hilft’s, alter Hufladen. So is des Leben. Manchmal gewinnt man, manchmal eben nicht.«
»Und genau auf des trink ma jetz.«
Sie waren beim Wirt gegenüber der Schnitzerei gelandet. Der Stammwirtschaft vom Gustl. Dort konnte er trinken, soviel er wollte, und ganz einfach nach Hause gehen. Ohne von der Polizei aufgehalten zu werden oder ein Taxi zu bestellen.
»Und was is bei dir los, mein Freund?«
»Franz, nach der Webseiten-Episode hab ich nix mehr in der Richtung g’macht. Obwohl … muss ich sagen, sich jemand gemeldet hat, der eine Figur von mir haben wollt. Dem hab ich dann Bilder g’schickt und den Preis.«
»Ja und dann?«
»Hat er g’meint, des wär ihm dann doch ein wenig zu viel. Er hätt so mehr an die Hälfte gedacht. Dann hab ich ihm g’sagt, er könnt ja die halbe Figur ham, er sollt mir nur sagen, wo genau ich die auseinandersägen soll. Von oben nach unten oder quer in der Mitten.«
»Und wie wollt er die ham?«
»Des entzieht sich meiner Kenntnis, mein Freund, weil ich dann nix mehr von dem g’hört hab. Aber red, habt’s einen neuen Fall?«
»Wieso fragst?«
»Weil ich was g’hört hab.«
»Die Nachrichten verbreiten sich ja rasend schnell hier im Ort.«
»Franz, nicht jeden Tag erleben wir was Aufregendes hier. Da klammert man sich an so was.«
»War’s die Fanny?«
»Ja, aber ich hab ihr versprochen, des nicht weiterzusagen. Also frag’s nicht, sonst is bös mit mir. Erzähl, um was geht’s?«
»Des kann ich dir nicht sagen, des weißt doch. Laufende Ermittlungen und so. Und je weniger du weißt, umso besser.«
»Na ja, wenn’st mich wieder amal brauchst, lass mich des wissen. Ich kenn übrigens den Hof, wo des passiert is. Der Schinder-Bauer war ein alter Freund von meinem Vater. Die ham einen kleinen Forst g’habt, oben am Berg, und in dem hat’s des beste Holz geben zum Schnitzen. Mei Vater hat g’meint, dass jeder Baum anders is und eine Seele hat. Wie alle Lebewesen auf unserer Erden. Es gibt keine zwei Bäum, die gleich sind. Und dann hat er immer an einen Baum klopft, mit dem Finger, und hat seine Ohren drang’halten. Dann hat er g’sagt: ›Bub, hör genau hin. Des is der Ton, den der Baum haben muss. Wenn’st des hörst und nur des, is des ein gutes Holz für eine Maria.‹
Und immer wenn der Schinder wieder amal einen Baum umg’sägt hat, hat er dem Vater geben, was er wollen hat. Unter einer Bedingung, dass er den Baum würdigt und ihm nicht wehtut. Auch der Schinder hat g’meint, die Bäum sind Lebewesen so wie wir. Er war sogar davon überzeugt, dass die mitanader in Verbindung steh’n. So über die Wurzeln und so. Wenn ein Baum nicht genug zum Leben hat, dann geben ihm die andern was ab. Damals, wie der Schinder uns des hat weismachen wollen, ham viele g’meint, der spinnt. Vor nicht langer Zeit hab ich g’lesen, ham sogar die Großkopferten des rausg’funden. Die zwei waren ihrer Zeit also weit voraus.«
»Ja, des hab ich auch amal g’lesen, mit den Verbindungen unter dem Boden und so. Und dass Bäum leben, sieht man auch daran, dass die alt werden. So wie wir. Ich mein, ein junger Baum schaut doch ganz anders aus als wie ein alter.«
»Genau. Auch meine Figur’n werden immer älter mit der Zeit. Des nennt man Patina. Wie bei uns zwei auch. Nur, wir werden immer weiser und schaun jeden Tag besser aus.«
»Sowieso, Gustl. Und Patina find ich gut. Des werd ich mir merken. Wir war’n ja auch manchmal da, auf dem Schinderhof, wenn wir was Ruhiges g’sucht ham.«
»Ja, aber des war lang nach der Zeit vom Schinder. Und von wegen was Ruhiges g’sucht. Ihr seid’s ja nur raus wegen die Madeln.«
»Das ist eine glatte Unterstellung, Gustl. Wir wollten nur in der Natur sein.«
»Des kannst deiner Großmutter erzählen. Der ganze Ort hat g’wusst, was ihr da macht’s.«
Dann kam das Essen, auf das sich die beiden schon gefreut hatten. Wie meist am Sonntag, Schweinebraten mit Kartoffelknödeln und Kraut. Was kann es Besseres geben an einem Sonntag in Bayern? Na ja, vielleicht den Apfelstrudel danach. Der ist auch nicht zu verachten.
6
Den Rest des Tages verbrachte Franz Josef Bernrieder an der Isar. Er machte einen langen Spaziergang und genoss die frische Luft, die feucht mit dem Wind vom Wasser herübergetragen wurde. Er war nicht der Einzige, der noch einmal die Gelegenheit ergriff, das Wetter zu genießen. Bald würde es unangenehm werden, und dann blieb man lieber zu Hause.
Seine Episode mit der Iris war immer noch bis zu einem gewissen Grad lebendig, verschwand aber langsam aus seinem Gedächtnis. Mit jedem Schritt wurde es weniger. Bald würde es nur noch ein Traum sein, aus dem er aufgewacht war. Die Ablenkung durch die erfrischende kühle Natur tat das Ihre.
Wolken rasten über den blauen Himmel, als wollten sie sich gegenseitig überholen. Es war gegen Ende des Sommers. Die Tage waren noch schön warm, wenn auch nicht heiß, eben angenehm. Nicht mehr lange, und die Blätter würden sich verfärben, nach und nach abfallen und einen bunten Teppich bilden.
Franz Josef Bernrieder wollte darüber nachdenken, was als Nächstes zu tun war. Da es, wie erwähnt, ein sonniger Tag war, setzte er sich auf eine Bank, richtete sein Gesicht gegen die Sonne und genoss die Wärme auf seiner Haut. Einfach seine Ruhe haben, den Gedanken nachhängen. Manchmal braucht man das. Ausschalten und dem lieben Gott den Tag stehlen. In diesem Moment hatte er seinen Verlust bereits vergessen und machte sich darüber keine Gedanken mehr. Vielleicht war es auch gut so, dachte er sich. Eine zu starke Bindung kann nur Probleme bringen.
Es ging ihm auch durch den Kopf, dass sie bis jetzt nicht einmal wussten, ob es überhaupt ein Verbrechen war, dort auf dem ehemaligen Schinder-Hof. Wenn nicht, wäre der Fall schnell abgeschlossen. Das würde er herausfinden. Morgen, gleich als Erstes.
Die Fanny wartete bereits mit dem Kaffee und der Butterbrezel, die Franz Josef Bernrieder an den meisten Morgen dort im Café Zuckmeier zu sich nahm. Es war einfacher, als sich Kaffee zu kochen, den Tisch zu decken und dann noch das Geschirr abzuwaschen. Aber er kam nicht nur wegen des Essens, keinesfalls, obwohl die Brezen nirgendwo besser schmeckten, sondern auch wegen seiner großen Liebe, der Fanny. Die allerdings bei ihr nicht so heiß war, wie er sich das gewünscht hätte. Sie war lieb zu ihm, aber nicht so erregt, wenn sie ihn sah, wie er sich das immer vorstellte.
»Einen neuen Fall habt’s, hab ich g’hört«, sagte sie, als sie sich neben ihn setzte.