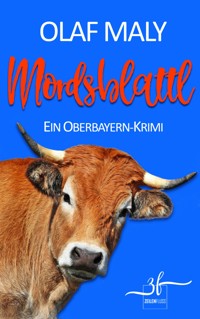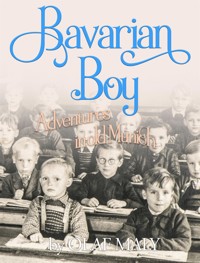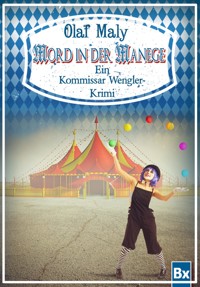5,99 €
Mehr erfahren.
Ein Clan treibt sein Unwesen in München. Das ist in den großen Städten nichts Besonderes, solange nichts passiert, was die Ruhe der anständigen Bürger stört. In diesem Fall geht unserem unermüdlich für die Gerechtigkeit und Sicherheit der Münchener zuständigen Kommissar Herbert Wengler die Sache ein wenig zu sehr unter die Haut. Vielleicht ist es auch sein Alter, das ihn weniger kompromissbereit erscheinen lässt als in früheren Jahren. Auch sein Assistent, Armin Staller, wird auf eine Art und Weise tief in diese Angelegenheit hineingezogen, die er mit Sicherheit so nicht wollte. Es gelingt gerade noch, ihn aus dem Strudel der Machenschaften unbeschadet herauszuholen. Es war die letzte Minute. Sowohl für den Kommissar als auch für Armin wird diese Geschichte weitreichende Konsequenzen haben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Der Agron Clan
Eine Kommissar Wengler Geschichte
Impressum
Texte: © Olaf Maly
Umschlag: © Vivian Tan Ai Hua
http://facebook.com/aihua.art
Bildmaterial:
© LucyJ: (1078672619) – A group of young people or teens wearing hoodies in an urban area, there is a sense of menace, gang crime
©f11photo: (283579144) – Munich skyline with Marienplatz town hall © picoStudio: (59883196) – Hintergrund OktoberfestVerlag: Olaf Maly
olafmalyautor.com
Der Agron Clan, 1. Auflage 2025
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Das wertvollste Geschenk an uns Menschen ist, dass wir lesen können.
Lesen bedeuted leben.
Kapitel 1
Karl Josef Vierlinger war ein Mann von gewaltiger Statur. Seine Oberarme waren so massiv wie die Beine eines Jugendlichen. Wenn er ging, musste man sich unwillkürlich an die Filme mit John Wayne erinnern, wie er breitbeinig durch die Gegend schlurfte. Es sah immer so aus, als wäre ein Pferd unter ihm, auch wenn man keines sah. Bei Karl Josef Vierlinger waren es ganz einfach die O-Beine, die er von Kindesalter her ertragen musste. Besonders in der Schule hatte er damit nicht immer nur gute Freunde, ganz im Gegenteil. Dann kam es eben manchmal zu kleinen Reibereien, die den anderen oft für ein paar Tage außer Gefecht setzte. Sogar die Mädchen kicherten hinter vorgehaltener Hand, wenn er an ihnen vorbeiging. Warum blieb ihm immer verschlossen, da er es, wie man heute sagt, ziemlich cool fand. Das Ergebnis war, dass es ihn zu dem machte, der er dann den Rest seines Lebens sein sollte. Er beklagte sich nicht. Stoisch nahm er hin, was er nicht ändern konnte.
Sein Gesicht trug er wie eine Trophäe auf seinen gewaltigen Schultern. Er hatte im Laufe der Jahre immer wieder eines auf die Nase bekommen, was diese immer platter machte. Bis man sie nur noch als flaches, breites Stück Haut mit zwei kleinen Öffnungen sah, das in der Mitte unter seinen Augen hing. Die beiden Nasenlöcher waren fast verdeckt, man konnte sie nur noch ahnen. Auch seinen Ohren hatte man oft eines verpasst und sie ähnelten deshalb mehr einem Gemüse als wohlgeformten Lappen. Im Großen und Ganzen war er also kein Bild von Schönheit, wie man sich das allgemein vorstellte. Besonders in der heutigen Zeit, in der scheinbar überwiegend immer das eine gilt, schön und einmalig zu sein. Tausende versuchen auf dieser Linie reich zu werden und sehen erst nach vielen Versuchen ein, dass sie doch nur eine von denen sind, für die sich niemand interessiert. Karl Josef Vierlinger war nie einer gewesen, der andere beeindrucken wollte. Ganz im Gegenteil. Seine Ruhe war ihm heilig.
Er war allerdings, wie man in Bayern sagt, ein Hader Lump, was seinem wirklichen Ruf eigentlich nicht gerecht wird. Einer, der immer eine Lösung hatte, auch wenn sie nicht immer legal war. Er hatte eben das Talent, Sachen besorgen zu können, wenn man etwas brauchte, was man nicht unbedingt in Geschäften bekommen konnte. Oder dort zu teuer war. Ansonsten war er ein netter, freundlicher Mensch, dem man allerdings nicht unbedingt zu nahe kommen sollte, sollte man etwas gegen ihn haben. Und wie sein Dasein es so mit sich brachte, hatten einige etwas gegen ihn. Das war Teil des Unternehmens. Man konnte ihn einfach nicht in Ruhe lassen, sosehr er sich das auch wünschte.
Sein Fahrzeug, das er behütete wie seinen Augapfel, war ein neunzehnhundert-sechsundsechziger Ford Mustang. Metallic blau, mit Weißwandreifen. Und schwarzen Ledersitzen. Am Rückspiegel hingen zwei weiße Würfel aus Flanell, wie man es eben so hatte in dieser Zeit, als der Wagen noch neu war. Daneben ein Traumfänger, ein kleines geflochtenes Netz mit einer Feder daran. Ganz nach Indianerart. Es war immer sein großer Wunsch gewesen, einmal die Route 66 von Chicago nach Kalifornien zu fahren. Im Sommer. Einfach so die Zeit an sich vorbeigleiten lassen, die Landschaft genießen, in alten, einfachen Roadhäusern zu übernachten und sich abends mit anderen Träumern am Lagerfeuer zu treffen und kaltes Bier zu trinken. Dazu ein Steak auf dem Grill, das so groß war wie seine zwei Hände zusammen. Und die waren riesig. Das war sein Traum, der sich jedoch nie verwirklichen sollte. Was er aber nicht wusste. Träume haben eben manchmal die Eigenschaft, das zu bleiben, was sie sind. Eben nichts als Träume. Wenn sie sich erfüllen, sind sie es nicht mehr. Und manchmal wünscht man sich dann, es wären Träume geblieben, da die Wirklichkeit nicht annähernd mithalten konnte.
Hauptgeschäft und Ankerplatz seines Daseins war ein Fitnessstudio im Hasenbergl, einem Stadtteil in München, aus dem man lieber ausziehen will, als dort einzuziehen. Dort angekommen, hieß, man hatte den Zug verpasst. Es hat nicht sollen sein, mit dem besseren Leben. Ganz im Gegenteil. Es war sehr einfach, dort zu landen und fast unmöglich, aus dieser anheimelnden Gegend wieder zu verschwinden. Das schafften nur wenige. Und viele, die von dort gingen, mussten in einem Metallsarg weggetragen werden.
In einer Ladenzeile, die seit Jahren schon keine Läden mehr hatte, mietete er sich ein paar Räume. Eigentlich nicht direkt mieten gegen Geld, mehr als Hausbesetzung. Er hatte ganz einfach die Räumlichkeiten an sich genommen und als man ihm sagte, dass er wieder ausziehen sollte, wehrte er sich mit allem, was möglich war. Er konnte sogar Leute davon überzeugen, dass er den jungen Leuten in der Gegend ein Zuhause geben kann, um sie von anderen Dingen, die sie in Probleme verwickeln könnten, abzuhalten. Mit der Zeit gaben sie dann auf, ihn hinauszukomplimentieren. Man akzeptierte ihn.
Dort stellte er Geräte auf, die er auf Auktionen kaufte, von Fitnessstudios, die pleitegingen. Und deren gab es immer wieder viele, besonders Anfang des Jahres. Die Leute, die sich an Silvester vornahmen, endlich was für die Figur zu tun, hatten die guten Vorsätze spätestens im Februar wieder vergessen. Die Studios jedoch blieben, bis sie so leer waren wie die Wüste Gobi. Kein Mensch mehr zu sehen, außer ein paar junge Mädchen, die fleißig den Staub von den Geräten abwischten. Auch noch so viele Versprechungen und Vergünstigungen halfen nichts. Es wurde eben wieder geschlossen. So kursierten die immer selben Maschinen von einem Versuch zum anderen und landeten dann oft bei Karl Josef Vierlinger.
In einem Raum ohne Fenster, hinter dem offiziellen Studio, hatte er einen Boxring aufgebaut. Ein paar Bretter vom Baumarkt, ein paar dicke Seile in einem Viereck gespannt, fertig war die Arena. Daneben hingen große, schwere Säcke, an denen man sich gnadenlos austoben konnte. Die jungen Leute aus dem Viertel liebten diesen Sandsack. Jungen oder Mädchen, das spielte keine Rolle. Jeder konnte zuschlagen. Manche stellten sich jemanden, den man nicht mochte, vor, dass er dort hinge, und schlugen enthusiastisch stundenlang darauf ein. Es machte sie frei. Am Ende waren sie erschöpft und mit sich zufrieden.
Große Bilder und Plakate hingen an der Wand von den Großen des Sports. Angefangen mit Muhamed Ali bis Max Schmeling. Dem wohl größten deutschen Boxer aller Zeiten. Dort, im Hinterzimmer, trainierte er die Jugendlichen vom Hasenbergl, die er auf den Spielplätzen ansprach, wo sie ihre Tage vergammelten. Es gab nichts zu tun für sie. Niemand wollte sie haben, keiner bot ihnen eine Chance. Alleine die Adresse, die sie angaben, wenn sie sich für eine Stelle bewarben, ließ das Papier in den Schredder fließen. Alle wussten es, also ließen sie es bleiben. Nur bei Karl Josef Vierlinger stießen sie nicht auf taube Ohren. Er kümmerte sich um sie. Und es sprach sich herum. Einer sagte es dem anderen. Sie kamen, erst langsam, dann immer mehr, bis er nicht mehr herumlaufen musste, um sie einzufangen. Sie kamen von selbst. Und Karl Josef Vierlinger wurde zu einer Art Institution.
Kapitel 2
Anfang November war immer und ist immer eine triste Zeit in München. Da gibt es nichts zu beschönigen. Das Oktoberfest ist lange vorbei, der bunte Herbst hat sich in ein graues Nebelmeer verabschiedet. Das Wasser tropft von den Bäumen, sammelt sich auf den Wegen und steht dort, bis es wieder Sommer wird. Es gibt die nächsten Monate keine trockene Phase. Alles ist nass und kalt. Die Füße werden jeden Tag fast erfrieren, weil es keine Möglichkeit gibt, das zu verhindern. Stiefel mit Pelz, ob innen oder außen, sind nur eine Notlösung. Irgendwann kommt unvermeidbar die Nässe durch. Die Wolken hängen tief, Tag und Nacht, und die Menschen sind so grau und ausdruckslos wie der Himmel. Sie schlurfen an einem vorbei, ohne den Kopf zu heben, da sie versuchen, dem Wasser aus dem Weg zu gehen, das ihnen ins Gesicht sprüht. Vergeblich, wie sie realisieren müssen. Nur die festliche Weihnachtszeit bringt etwas Wärme in die unvermeidliche, triste Realität. Dann leuchten die Kerzen in den Ständen am Weihnachtsmarkt, der Maroniverkäufer bietet lauthals seine Ware an, und der Jägertee fließt in Strömen. Bis man vollkommen vergessen hat, dass es einem einmal ungemütlich kalt war. Dazu fällt leicht weißer, unschuldiger Schnee, der sich überall festsetzt, bis er sich auf allen Wegen zu einem grauen Matsch zusammengeballt hat. Die herrlichen Winterbilder mit weißen Tannen gibt es nur in Prospekten. Sobald der Mensch damit in Berührung kommt, ist die weiße Pracht vorbei.
Nur diese Zeit ließ noch auf sich warten. Es war erst Allerheiligen. Anfang November. Ein Feiertag, der an die Heiligen erinnern sollte, und an dem man an das Familiengrab geht, das man das ganze Jahr über geflissentlich vernachlässigt hat. Manche stellen dann auf einmal fest, dass niemand mehr die Pacht bezahlt hat und das Stück Land der Großeltern auf einmal jemand anderem gehört. Dann laufen sie herum, weil sie denken, sich in der Reihe geirrt zu haben. Letztlich fragen sie den Friedhofswärter, der jedes Grab wie seine Westentasche kennt. Erst dann, als man ihnen sagt, dass sie sich eben hätten kümmern sollen, tappen sie mit gesenktem Haupt und schuldbewusst von dannen. Vielleicht gehen sie noch kurz in die Kirche und spenden eine Kerze für einen Euro, sagen ein Vaterunser und schämen sich für ein paar Minuten.
‚ Dann eben kein Friedhofsbesuch mehr. War ohnehin nicht mein Fall‘, sagt man sich leise und ist eigentlich froh, dass es vorbei ist.
Herbert Wengler hatte kein Grab, das er besuchen konnte. Er hatte Freunde, die vor ihm gegangen waren, aber die wurden alle verbrannt. Seine Eltern waren schon so lange tot, dass er sich nicht mehr erinnern wollte. Er hatte auch die Einstellung, dass alles einmal sein Ende haben musste. Auch das Begraben sein. Schließlich hat niemand was davon, zwei Meter unter der Erde zu liegen, am wenigsten die, die dort liegen. Und die, die noch oben herumlaufen, auch nicht.
In Bayern durfte an diesem Feiertag nicht gefeiert werden, was an sich ja ein Oxymoron ist. Man sollte es einfach Gedenktag nennen, da der Sinn des Tages ist, eben an die Heiligen zu denken. Musik war jedenfalls beschränkt auf Klassik und Blasmusik, was allerdings absolut niemanden davon abhielt, das zu hören, was einem gefiel. Niemand scherte sich darum, was die Regierung wollte. Nur öffentlich tanzen durfte man nicht. Da Herbert Wengler auch unabhängig davon nie tanzte oder getanzt hatte, war ihm das ziemlich egal.
An diesem Sonntag lag er verträumt auf seinem Sofa und hörte sich die fünfte Symphonie von Beethoven an. Nur die kleine Lampe auf der schmalen Kommode war angeschaltet und sendete einen schwachen Lichtkegel in das überheizte Zimmer. Er liebte es warm. Und da er alleine wohnte, gab es auch niemanden, der sich daran störte. Wenn seine Freunde zu Besuch waren, um Schafkopf zu spielen, beneideten sie ihn darum. Nicht, dass er alleine lebte, dass manchmal auch, aber meist darum, dass er niemanden fragen musste, was er warum machen wollte. Und dass er das Recht hatte, die Temperatur in seiner Wohnung zu bestimmen. Neben anderen entscheidenden Dingen des Lebens, wie den Inhalt des Kühlschrankes. Zum Beispiel.
„Herbert“, hieß es dann, „du hast des im Griff, gratuliere.“
„Wir können dich nur beneiden.“
Dann lächelte Herbert Wengler in sich hinein und bedauerte seine Kartenfreunde für ein paar Minuten. Ohne es ihnen jedoch unter die Nase zu reiben.
Als der zweite Satz der fünften Symphonie gerade angefangen hatte, klingelte das Telefon. Er ahnte, dass es etwas Berufliches sein konnte, obwohl er an diesem Wochenende keinen Dienst hatte. Sein Mitarbeiter, Armin Staller, musste die Stellung halten. Es traf immer die, die keine Familie hatten zuerst, wenn es um Wochenend- oder Feiertagsdienst ging. Nur Herbert Wengler war davon größtenteils ausgenommen, auch wenn er der beste Kandidat für diesen Dienst wäre. Erstens wegen seiner Kontakte und zweitens wegen seines Alters. Er wurde geflissentlich ganz einfach vergessen, was er nicht als Beleidigung, sondern eher als Glücksfall sah.
Langsam schälte er sich aus seiner Stellung auf dem Sofa und stand auf, um das Gespräch anzunehmen. Er hatte kein Handy, das immer neben ihm lag oder, wie bei den meisten, am Gürtel hing. Dieses neumodische Zeug war nichts für ihn. Ein Telefon hatte eine Schnur zu haben, also musste man eben dorthin laufen, wo diese in die Wand eingelassen war. Das war immer so und wird immer so bleiben.
Es war Armin Staller, sein Assistent, wie er das schon geahnt hatte.
„Hab’ ich mir des gedacht, Armin, dass du des bist. Hast nix anders zum Tun, als mich an diesem schönen Tag aus meiner Ruhe rauszureißen? Hab grad die Fünfte auf’glegt.“
„Ich weiß nicht, was an diesem verregneten, grauen und misslichen Tag schön sein kann, aber da wir wieder einmal einen Fall haben, passt dieser absolut perfekt zur Stimmung, die sich um mich herum breit gemacht hat. Und das mit der Fünften tut mir unheimlich leid. Da es aber, wie ich annehme, eine Schallplatte ist, können sie diese nach unserem Ausflug ja auch wieder auflegen. Beethoven wird es ihnen danken.“
„Des hast aber jetz schön g’sagt, Armin. Du weißt, wie man jemand Honig ums Maul schmiert. Was is los, was nicht bis morgen warten kann?“
„In einem Boxclub, da irgendwo im Hasenbergl, wie man mir gesagt hat, ist jemand tot aufgefunden worden.“
„Ich kenn’ nur einen Boxclub im Hasenbergl, und der is vom Vierlinger. Hat der was mit dem zum Tun?“
„Das weiß ich nicht. Man hat mir keinen Namen genannt. Der einzige Weg, den herauszufinden ist, einfach dorthin zu fahren. Ich hole sie in einer halben Stunde ab. Wie immer, unten, wo die Straßenbahn ihre Runde dreht und die anderen Autofahrer fluchen, weil sie nicht weiterkommen.“
„Des machst, Armin. Ich werd da sein, wenn ich auch was anders geplant hab.“
„Herr Kommissar, die Tanzlokale sind heute geschlossen, das haben sie wohl vergessen. Auch Rockmusik darf nicht gespielt werden, falls sie daran gedacht haben.“
Herbert Wengler ignorierte diese Spitze seines Assistenten und legte ganz einfach auf. Dann schaltete er seinen Plattenspieler aus, zog sich seine hohen Stiefel sowie den Parka der Bundeswehr an und machte sich langsam auf den Weg nach unten. Die kleine Lampe auf der Kommode ließ er an, damit er ohne Probleme den Weg auf sein Sofa finden würde, wenn er zurückkam. Es würde hoffentlich nicht lange dauern.
Kapitel 3
Dr. Brunner, von der Gerichtsmedizin, war bereits an der Arbeit. In seinem weißen Overall sah man ihn schon von weitem leuchten wie eine Lampe, noch dazu es im Boxstudio nicht gerade strahlend hell war. Nur ein paar alte Neonlampen, die unentwegt flackerten und summten, erhellten den Raum ein wenig. Vielleicht gerade deswegen strahlte er wie eine Leuchtsäule. Dazu kommandierte er einige Personen herum, die neben ihm standen. Auch das ließ darauf schließen, dass man voll bei der Sache war.
„Sind’s auch schon da, Herr Kommissar. Ich hab schon Angst g’habt, dass sie den Weg nicht finden. Oder dass sie so viele Friedhöf besuchen müssen, dass man sie nicht findet. Und Friedhöfe gibt es ja wirklich genug in unserer Stadt.“
„Wenn ich nicht g’funden werden will, dann werd ich auch nicht g’funden, Herr Doktor. Weil ich kein Sklave bin von einer Maschin, die jede Minute weiß, wo ich bin. Ham’s mir was zum Erzählen, oder sind’s hier nur, damit’s nicht auch auf'n Friedhof müssen. Apropos Friedhof. Ich hab amal g’hört, dass bei die Architekten die Fehler über der Erden zum Finden sind, und die von die Doktoren, unter derselben.“
„Was, Herr Kommissar, auf mich nicht unbedingt zutrifft, weil ich nur Tote auf’n Tisch bekomme. Und da kann man nicht mehr viel verderben. Lebensmäßig mein ich. Aber wegen dem armen Typ hier. Wie sie seh’n schaut der nicht grad g’sund aus. Da muss ich mir noch ein bisschen was einfallen lassen, wie ich des G’sicht wieder hinbekomme, damit man den erkennt.“
„Ja, des schaut wirklich nicht grad gut aus. Da hat jemand aber eine gewaltige Wut g’habt.“
„Des können’s wohl sagen.“
Der Tote war ein junger Mann. Er war bekleidet mit einer dunklen Trainingshose und einem grauen Kapuzenpullover. Bekleidung, die man heutzutage an fast neunzig Prozent der jungen Leute findet. Dazu trug er hohe, rote Turnschuhe oder Sneakers, wie man heute sagt. Das Einzige, was nicht bedeckt war, war sein Gesicht. Das jedoch war von den Schlägen, die er abbekommen hatte, blutig und vollkommen zerstört. Man konnte weder Augen noch Mund oder Nase ausmachen. Da hatte jemand volle Arbeit geleistet, den Toten unkenntlich zu machen.
„Is er an die Schläg g’storben, Herr Doktor?“
„Das kann ich bis jetzt nicht sagen, aber es hat zumindest geholfen. Wenn ich was...“
„Ja, versteh schon. Hab ja nur g’fragt.“
Nach seiner kurzen Unterredung mit der Gerichtsmedizin sah sich der Kommissar im Raum um, in dem sie standen. In einer Ecke, zusammengesunken in sich selbst, sah er den Karl Josef Vierlinger auf einer Bank sitzen. Er kannte ihn gut, wenn er auch nie etwas mit ihm direkt zu tun hatte. Die Blicke der beiden trafen sich, was Kommissar Wengler dazu brachte, zu ihm zu gehen und sich neben ihn zu setzen.
„Tscharlie, was is passiert?“
Es gab nicht viele, die ihn so nennen durften. Herbert Wengler war einer der wenigen. Sie kannten sich seit ewigen Zeiten. Schon als Herbert Wengler noch Streife fuhr, begegneten sie sich immer wieder. Nicht unbedingt, dass einer den anderen eingeladen hätte. Das ganz bestimmt nicht. Eigentlich hatten sie nur beruflich miteinander zu tun. Herbert Wengler als Polizist und Karl Josef Vierlinger als Delinquenten. Allerdings nur für kleine Sachen, die ihm meist nur ein paar Monate auf Bewehrung einbrachten. Mord, oder Gewalttaten an sich, waren nie in seinen Akten. Daraus wurde über die Jahre so etwas wie eine Art Freundschaft. Nicht unbedingt so, wie man sich das vorstellt, wenn man befreundet ist und zusammen ein Bier trinken geht. Oder sich zu Hause auf der Couch zusammen ein Fußballspiel ansieht. Vielleicht auch Trauzeuge wird oder Pate der Kinder. Mehr so wie gegenseitiger Respekt für das, was der andere machte, ohne sich wirklich dafür zu interessieren. Manchmal bekam Kommissar Wengler von ihm Hinweise aus dem Milieu. Anonym, nie direkt, aber immer in einer Art, dass er sehr wohl wusste, wer es war.
„Woher soll ich des wissen, Herbert? Ich bin kommen und hab des g’sehn. Dann hab’ ich euch ang’rufen und jetz bist du da. Wie geht’s dir eigentlich? Hab dich ja Jahre nicht g’sehn.“
„Weil ich in der Mordkommission bin und du Gott sei Dank nie einer von meine Kunden warst. Ich hoff, des bleibt auch so. Wenn du was mit dem da zum Tun hast, sag mir des gleich, weil da könnt ma uns an Haufen Arbeit spar’n.“
Karl Josef Vierlinger sah Herbert Wengler eingehend an.
„Herbert, jetz bin ich aber schon total enttäuscht von dir. Du glaubst doch nicht...“
„Tscharlie, ich muss dich des fragen. Berufsmäßig, verstehst? Ich glaub gar nix. Wenn ich was glauben will, is des in der Kirch, und da geh ich nicht hin. Ich brauch Fakten, damit ich den, der des g’macht hat, von der Straßen holen kann. Und wenn wir dich ausschließen können, umso besser.“
„Da hamma was gemeinsam. Ich mein des mit dem Glauben und der Kirch. Aber wer des war, da hab’ ich keine Ahnung.“
„Aber du kennst den, der da liegt?“
„Herbert, ich kenn an jeden, der hier wohnt und vor allem, der hier trainiert. Ich hab des zu meiner Lebensaufgabe g’macht, dass ich dene Burschen helf. Rausholen will ich sie, aus dem Sumpf, in dem die stecken und für den die nix können. Die ham sich des nicht ausg’sucht, wo die wohnen und wie die leben müssen, des kannst mir glauben. Und wenn man dene nicht hilft, versaufen die da drin. Dann hast wieder a paar Kunden mehr.“
Beide sahen sich an und sagten für eine Weile kein Wort. Kommissar Wengler wusste, was Karl Josef Vierlinger machte, und er beneidete ihn nicht. Und er hatte Respekt vor ihm. Er wusste, wie diese Menschen, die keine Heimat mehr hatten, leben müssen. Sie waren gestrandet, ohne dass sie etwas dafür konnten. Man hatte sie aus ihrer Umgebung herausgerissen und in ein fremdes Land gebracht, in dem sie nicht die Sprache verstanden und auch nicht verstanden wurden. Keiner kümmerte sich um sie, außer dass man ihnen Geld gab, um zu überleben. Ansonsten überließ man sie ihrem Schicksal, für das sie nichts konnten.
Nach einer Weile stand Herbert Wengler auf und sah auf Karl Josef Vierlinger herunter, der in sich versunken auf der Bank sitzen blieb.
„Und, wer is des, Tscharlie? Red mit mir.“
Karl Josef Vierlinger holte tief Luft und fing an zu reden, ohne den Kommissar anzusehen. Sein Blick war auf den blanken Betonboden gerichtet, seine Hände stützten den Kopf. Er war sichtlich erschrocken und vielleicht sogar ein wenig verzweifelt. Vielleicht dachte er daran, versagt zu haben, da er genau das, was jetzt eingetreten war, eben nicht wollte. Die letzten Jahre waren schwierig, sehr schwierig. Viele kamen aus dem Osten, sprachen kein Wort Deutsch und sahen nur Verachtung in den Gesichtern der Menschen, denen sie begegneten. Alles, was sie wollten, war ein neues, anderes Leben. Eines, in dem man sich auch einmal etwas außer dem Nötigsten zum Leben leisten konnte. Es wurde ihnen nicht gegönnt. Dann sah er nach oben, ins Gesicht von Kommissar Wengler, der immer noch vor ihm stand.
„Luca heißt er. Luca Kovac. Wir nennen ihn Lukas, des klingt mehr deutsch und des hat er so wollen.“
Dann lehnte er sich mit dem Rücken gegen die Wand und sah sich in seinem Reich um.
„Wohnen tut er im Bau vierunddreißig, grad über den Rasenplatz, wenn‘st aus der Tür rauskommst und nach rechts gehst. Wunder dich nicht, dass du da keinen Rasen nicht siehst. Der is lang schon weg, aber wir nennen des noch so. Nostalgie oder so ähnlich. Den Bau kannst nicht überseh’n. Die Nummern stehn riesengroß auf dene Betonplatten, wie in einem G’fängnis. Dann gehst im Aufgang A rauf in den sechsten Stock. Musst halt nach dem Namensschild schau‘n. Lass dir Zeit, weil der Aufzug sicher wieder kaputt is und in unserm Alter sechs Stockwerke kein Spaziergang sind. Da triffst dann nur noch die Mutter, die schwer Arthritis hat und vielleicht seine Schwester, die a paar Jahr jünger is. Der Luka war bei mir seit fast zwei Jahr. Guter Bub, Herbert. Nie aggressiv, immer nett. Ich versteh des nicht, was hier passiert is. Der is der Letzte, wo ich des geahnt hätt.“
„Da kannst nix dafür, Tscharlie. Meistens weiß man nicht, was die Leut denken. Die ham ihr Leben, des die nicht hergeben, an niemanden. Nur, wie des ausschaut, muss da jemand einen ziemlich großen Hass g'schoben haben. So was macht ma nur, wenn man seine Wut auslässt. Weißt du, was der g’macht hat, wenn er nicht hier war, bei dir?“
„Soviel ich weiß, hat der beim Schoberl g’arbeitet.“
„Dieter Schoberl. Der Schrotthändler? Wo du dein Auto versenken kannst, wenn’st es nicht mehr brauchst und dann sagst, des hat jemand g’stohlen.“
„Genau der.“
Dabei sahen sich Karl Josef Vierlinger und Herbert Wengler an und lächelten ein wenig. Nur so eine Spur, da man wusste, was gemeint war. Beide kannten ihn und wussten, womit er sein Geld verdiente.
Inzwischen war Armin dazu gekommen. Der Kommissar stellte ihm Karl Josef Vierlinger vor und meinte zu ihm, dass Armin irgendwann einmal seine Stelle übernehmen werde. Er sich also den Namen merken solle. Nur weil er einmal in Rente gehen würde, müsse man deswegen das Kommissariat ja nicht unbedingt schließen.
Karl Josef Vierlinger sagte nichts dazu, als nur ein kurzes Grüß Gott. Dann stand er auf, schlug leicht auf die Schulter von Herbert Wengler und meinte noch, er solle den, der das gemacht hat, bitte unbedingt finden. Hoffentlich, bevor er ihn selbst findet.
„Tscharlie, mach kein Scheiß, bleib sauber. Des lohnt sich nicht.“
„Was sich lohnt oder nicht, Herbert, hab ich schon lang vergessen. Des muss irgendwo auf meiner Reise durchs Leben liegen geblieben sein. Zurück gehn kann ich nicht, sonst würd ich vielleicht drüber stolpern.“
„Ich will nur nicht, dass du einer von meine Kunden wirst. Nicht in deinem Alter.“
„Des wird nicht passier’n, Herbert. Eher geb ich den Löffel ab.“
Damit ging Karl Josef Vierlinger aus seinem Studio. Der Kommissar setzte sich noch einmal auf die Bank und sah sich im Raum um. Vielleicht, dachte er, bekommt man ein Gefühl für die Verhältnisse in solch einem Umfeld. Einen Eindruck über die Lebensweise solcher Leute. Es tat sich nichts in dieser Richtung. Vielleicht wollte er es auch nicht erfahren. Es war ein Kreis, in den er nicht unbedingt eintreten wollte. Nicht mehr in seinem Alter. Nur Tscharlie musste er davor bewahren, Dummheiten zu machen. Er war es ihm schuldig.
„Und, haben sie etwas herausgefunden?“
„Ja, Armin. Einiges. Und nicht nur Gutes. Wir müssen den finden, der des g’macht hat. Ich will nicht, dass der Tscharlie den Rest seines Lebens hinter Gitter verbringt. Des hat er nicht verdient. Sein ganzes versautes Leben hat er versucht, anständig zu bleiben. Ich wüsst nicht, was ich machen würd, wenn der auf unserer Listen auftaucht.“
Armin setzte sich neben den Kommissar und sah Karl Josef Vierlinger nach, der langsam aus seinem Studio verschwand.
„Und morgen fahr’n wir zu einem Dieter Schoberl.“
„Und wer ist das? Ein anderer Freund aus der Vergangenheit?“
„Ein Saukopf, wie das des hier viele gibt. Da hat der Tote g’arbeitet. Und mit dem unterhalten wir uns amal. Wird nix werden, aber schaden tut’s auch nicht.“
Armin sah den Kommissar nachdenklich an. Er hatte ihn nicht oft so in sich versunken gesehen.
„Aber heut geh’n wir nur noch zu der Mutter. So was muss man so schnell wie möglich hinter uns bringen. Des is, was ich meisten hass an meinem Beruf.“
Kapitel 4
Der Weg war kurz und schmutzig. Wie Karl Josef Vierlinger prophezeit hatte. Das Gras, sollte es einmal eines gegeben haben, war nicht mehr vorhanden. Nur noch dunkle, braune Erde, die durch das nasse Wetter zu Schlamm geworden war. Es gab noch einen betonierten Fußweg um den Platz herum, aber der wäre doppelt so lange gewesen. In seinen Stiefeln der Bundeswehr hatte der Kommissar keine Probleme, durch die weiche Masse Dreck zu waten. Ganz im Gegenteil. Armin ging es da schon ein wenig schlechter.
„Hätts’t g’scheite Stiefel an, Armin, würd dir des nix machen. Mit deine Tanztreter hast halt ein Problem. Schau mich an. Da kannst noch was lernen.“
„Ich wusste nicht, dass wir durch einen Acker laufen müssen, in dem man bis zum Knöchel versinkt. Hätte ich das gewusst, wäre ich in Gummistiefeln gekommen.“
„Gras hat der Vierlinger g’sagt. Wir sollen übers Gras geh'n. Aber man muss auf alles vorbereitet sein, Armin. Nimm des als guten Rat von einem, der des alles schon erlebt hat. Der Wiener Franz, ein Kollege von früher, Gott sei seiner Seele gnädig, der hat immer zwei oder drei Paar Schuh im Auto g’habt. Für jeden Anlass. Ein Paar Stiefel aus Gummi, ein Paar mit Fell und Sommerlatschen. Dem is des nie nass reingangen.“
Als man die Schlammwiese überquert hatte, stand man am Eingang der Nummer vierunddreißig. Der Aufzug war, wie Tscharlie richtig vorausgesagt hatte, außer Betrieb. Ein Schild war angebracht, das allen, die ihn eventuell benutzen wollten, ebendieses mitzuteilen. Es war kein neues Schild, ganz im Gegenteil. Es musste dort schon seit Monaten hängen. Die Eindrücke derer, die den Lift benutzen wollten und nicht konnten, waren auf diesem Schild verewigt. Diese hier wiederzugeben, wäre nicht gut.
„Dann geh’n wir halt amal nach oben, Armin.“
Für Herbert Wengler, kein angenehmes Unterfangen. In jedem Stockwerk blieb er für ein paar Minuten stehen, um auszuruhen. Auch er wohnte oben in einem alten Haus, aber der Aufzug, dort, wo er wohnte, war bisher immer noch in Betrieb.
„Ich hab amal einen Besuch g’habt von einem Neffen, der oben im Norden wohnt“, fing der Kommissar an zu erzählen, als sie wieder einmal Pause machen mussten.
„Dann sind wir am Wochenende amal zum Neuschwanstein rauf. Zum Schloss halt, des, wie du weißt, auf einem Berg liegt. Der Gunter, so hat der g’heißen, war a bisser’l auf der vollen Seite. Weißt schon, was ich mein. Doppelt so schwer wie ich damals. Dann sind wir da den Weg raufg‘laufen. An jeder Kurve hat der stehn bleiben müssen und mir immer erzählt, dass er des nicht überleben würd. Des hat ewig dauert, bis wir oben war’n. Dann hat er mich g’fragt, ob des da nicht einen Weg gäb, der einfacher wär. Eine Tortur wär des g’wesen. Logisch, sag ich, du kannst auch mit der Kutsche hochfahr’n. Des G'sicht hätt’st sehen sollen, Armin. Wenn Blicke töten könnten, wär ich in dem Moment da glatt umg’fallen.“
„Das war aber nicht nett von ihnen.“
„Hat’s auch nicht sein sollen, weil ich den nicht g’mocht hab.“
„Dann war das aus mit den Besuchen, nehm ich an.“
„Gott sei Dank, Armin. Ja, des hat sich rumg’sprochen in meiner Verwandtschaft. Aber heut würd ich des nicht mehr jeden Tag schaffen, Armin“, sagte er, als sie endlich im sechsten Stock waren.
Es war ein langer, breiter Gang, angestrichen in einem aufregenden Dunkelgrau. Die Wände waren mit allen möglichen Graffitis verziert. Auch arabische Schriftzeichen konnte man ausmachen. Den Kommissar hätte interessiert, was dort stand. Er empfand die Schrift als schön, auch wenn er nicht wusste, was es bedeutete.
Links und rechts gingen Türen ab, jede in einer anderen Farbe. Langsam liefen sie den Gang entlang und schauten sich jedes Klingelschild an, um den Namen zu finden. Nach vier Türen hatten sie gefunden, wonach sie gesucht hatten. Armin drückte den Knopf. Es dauerte ein paar Minuten, und eine ältere Frau öffnete die Tür. Nur einen kleinen Spalt, damit sie sehen konnte, wer dort stand, sagte aber nichts. Man sah die Kette, die verhinderte, dass man sie weiter öffnen konnte. Der Kommissar ging davon aus, dass sie sehr wohl wusste, wer dort wartete, da er annahm, dass sie vorher durch den Spion geschaut hatte.
„Frau Kovac?“
„Ja, wer sind sie?“
Kommissar Wengler nahm seinen Ausweis und zeigte ihn der Frau, die nun die Tür ein wenig weiter geöffnet hatte, bis die Kette spannte.
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Epilog
Anmerkungen
Danksagung