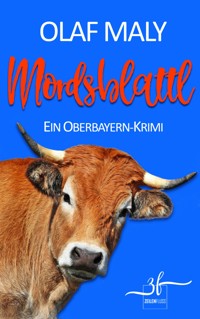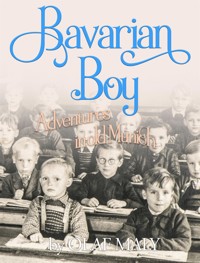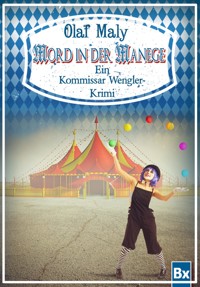0,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Zeilenfluss
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Kirchenglocken, gutes Essen und Messwein – Kommissar Bernrieder könnte es bei Pfarrer Kolb nicht besser gehen, bis die Pflicht ausgerechnet am Sonntag wieder einmal ruft … Der Einbruch, zu dem Bernrieder gerufen wird, entpuppt sich als ein brutaler Mord mit einer schrecklich entstellten Leiche. Der Fall hat es in sich: Die einzigen Hinweise führen zu der ahnungslosen Freundin der Toten und einem leeren Schrank, und jede Spur, der Bernrieder folgt, endet in einer Sackgasse. Als eine zweite Leiche gefunden wird, weiß der Tölzer Kommissar, dass Eile geboten ist. Doch mit dem Auftauchen der Familie des ersten Opfers scheint nichts mehr einen Sinn zu ergeben. Besteht überhaupt eine Verbindung zwischen den beiden Opfern? Und wieso muss sich Bernrieder plötzlich so viel mit Antiquitäten auseinandersetzen? "Schindermatz" ist der vierte Band der Serie "Bernrieder ermittelt". Dieser Roman ist in sich abgeschlossen. Alle Teile der Reihe können unabhängig voneinander gelesen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Sammlungen
Ähnliche
Schindermatz
Bernrieder ermittelt - Band 4
_______________________________________________________________
Olaf Maly
1
Es war ein schöner, ruhiger später Nachmittag, dort bei Pfarrer Lothar Kolb in Birkenstein. Ein Sonntag, den man sich nur wünschen kann. Und der Tag, an dem Pfarrer Kolb am Nachmittag frei hatte. Der Gottesdienst war abgehalten, die wenigen Gläubigen waren zu Hause, und der nächste liturgische Dienst war eine Woche entfernt. Selbstverständlich hatte er auch Aufgaben die Woche über, wie Tote begraben, Beichten abnehmen oder ein paar Worte des Trostes im Altersheim spenden. Aber der Sonntagnachmittag gehörte ihm.
Sie genossen einen der letzten lauen Abende, bevor der berüchtigte, klare Herbst in den Bergen die noch verbliebenen Wärmestrahlen mit in den weiten Himmel nahm, um dort in der Unendlichkeit mit dem Universum zu verschmelzen. Franz Josef Bernrieder und sein guter Freund Pfarrer Kolb saßen in der geräumigen Küche und hatten gerade ihr fulminantes Essen beendet. Kommissar Bernrieder konnte ihn nicht besser loben für seine Kochkünste und den glücklichen Umstand, dass er so einen exzellenten Koch als Freund hatte.
»Des hat dein Chef gut eing'richtet, Lothar, dass wir uns kennen.«
»Und ich hab gedacht, du glaubst nicht an die Obrigkeit.«
»Wenn des sein muss, kann man schon amal Ausnahmen machen, meinst nicht? Man muss ja nicht gleich übertreiben und am Sonntag auch noch in die Kirch gehen. In die Küch allerdings schon. Da hab ich überhaupt kein Problem nicht.«
»Nein, des wär sicher nicht angeraten, auch einmal die Kirchenbank zu drücken. Das würde ja nur deiner Seele guttun. Aber wer braucht schon eine gute Seele? Außer man kommt ins Fegefeuer, dann wär des natürlich schon von Vorteil, wenn man die Last, die man auf sich geladen hat, nicht mitbringen würde. Schließlich reden wir da von Unendlichkeit und nicht ein paar Stunden.«
»Da geh ich amal davon aus, dass du ein gutes Wort für mich einlegst, wenn des so weit is.«
»Das wird nicht gehen, weil ich oben sein werde und du unten.«
»Dann komm ich dich besuchen. Ganz einfach. Lädst mich halt amal ein, und dann geh ich nicht mehr.«
Der Förster der Gemeinde, ein gewisser Anton Bichler, hatte dem Pfarrer, aus Dankbarkeit für die so rührende Rede bei der Begräbnisfeier seiner Frau, eine Rehschulter gebracht. Alle, die bei der Totenweihe dabei gewesen waren, hatten ihm dankbar gratuliert, die richtigen Worte gefunden zu haben. Und das musste irgendwie belohnt werden, dachte sich der Förster. Und was war besser als ein gutes Stück Fleisch vom Wild.
Das Rehfleisch war bereits abgehangen und dunkelrot, als der Forstbeamte in seiner grünen Uniform vor ihm in der Tür stand. Neben ihm sein Hund, der immer leicht mit dem Schwanz wedelte, wenn ihn jemand sah. Oder er jemanden sah. Das spielte keine Rolle, Hauptsache, es war ein Mensch, der ihm Aufmerksamkeit schenkte. Manchmal reichte auch ein Eichkätzchen oder ein anderer Hund, aber Menschen mochte er besonders gerne. Nur mit Katzen hatte er seine Probleme. Rolf war sein Name.
Lothar Kolb war, wie jedem, der dort im Ort oder in der Nähe wohnte, bekannt war, ein ausgezeichneter Koch. Und er wusste so ein Geschenk sehr zu würdigen. Es hätte keinen Besseren in der ganzen Umgebung geben können, so ein Geschenk auch nur annähernd entsprechend genießen zu können.
»Des war noch ein junger Hirsch, Herr Pfarrer«, meinte der Förster schüchtern zu ihm, als er des Pfarrers erstaunten Blick sah, der erst auf ihn, dann auf den Hund und zum Schluss auf das rote Stück Fleisch in seiner Hand wanderte. Dann nahm er es dem Überbringer ab und bat ihn, einzutreten. Man trank noch ein paar Stamperl Selbstgebrannten, den der Klobinger Rudi immer vor die Tür stellte. Man darf ja nicht selbst brennen, das weiß jeder. Es ist also eine Sünde, da es verboten ist. Keine große zwar, besonders in Bayern, wo man so etwas mehr als Medizin sieht denn als Alkohol. Wo auch ein Bier nur Grundnahrungsmittel ist und nicht etwas, womit man sich sinnlos betrinkt. Aber die Weltlichkeit sah es so. Und der musste man sich fügen. Auch Pfarrer Kolb. Also war es eine Sünde.
Um nun Buße zu tun, stellte der Klobinger Rudi eben immer eine Flasche nur vor die Tür des Pfarrhauses. Er klingelte ganz kurz und verschwand. Das hatte ihm seine Frau geraten, die in diesen Sachen weit mehr bewandert war als er selbst. Natürlich wusste Pfarrer Kolb absolut nicht, wer diese Flasche dort immer platzierte. Das würde für ewig und immer ein Geheimnis bleiben. Jedenfalls, wenn ihn jemand von der weltlichen Obrigkeit danach fragte. Nur ging das schon Jahre, und niemand hatte sich je dafür interessiert. Das mochte daran liegen, dass die Lieferung immer nachts kam, der Überbringer auf die Klingel drückte und dann im Nebel oder der Finsternis entkam. Bevor der Hausherr die Gelegenheit hatte, die Tür aufzumachen. Das Corpus Delicti stand also nur Minuten vor der Tür und wurde von keinem anderen gesehen als dem Empfänger. Aber er war gut, dieser Schnaps. Keine Frage.
Diese Schulter gab es nun an diesem besagten Sonntagabend im Hause des Pfarrers Kolb. Mit Knödeln und Blaukraut. Gekocht mit französischem Rotwein. Beaujolais, um genau zu sein. Neuem Beaujolais, der jedes Jahr als Sonderlieferung ins Pfarrhaus geschickt wurde.
Franz Josef Bernrieder wohnte derzeit dort für ein paar Tage. Der Striebinger Gerhard, der den größten Heizungsfachbetrieb im Ort führte, hatte ihn angerufen. Das war vor einigen Wochen gewesen. Ein Kunde hätte aus finanziellen Gründen den Einbau seiner Heizung verschieben müssen. Er war, wie man sagt, ›am Sand‹. Was im restlichen Land ganz einfach ›pleite‹ bedeutet. Da der Kessel nun zufälligerweise genau die Größe hatte, die der Franz Josef Bernrieder für sein Haus brauchte, schlug er ihm vor, den eben bei ihm einzubauen, da er ja wusste, dass er keine Heizung in seinem alten Bauernhaus hatte. Damit würde er endlich nicht mehr sein Bett im Winter vom ersten Stock in die Küche im Erdgeschoss verfrachten müssen. Das war sein nicht zu widerlegendes und einschlagendes Argument. Als er das dann am Stammtisch zur Sprache brachte, waren alle seine Freunde, die in der Vergangenheit immer hatten helfen müssen umzuziehen, natürlich voll Feuer und Flamme. Sie überzeugten ihn, dass das einem Wunder gleichkäme, die Vorsehung ihre Hand mit im Spiel hätte und er es eben nicht ablehnen sollte. So eine Gelegenheit käme so schnell nicht wieder.
Deswegen also lebte er zeitweise im Pfarrhaus, das genug Räume hatte, die nur, wenn überhaupt, sporadisch belegt waren.
2
Es war bereits später Abend. Der Mond stand voll am Himmel und erleuchtete den kleinen Rasenplatz hinter dem Haus und die Spitzen der Kapelle. Die sonst so grünen Bäume standen wie schwarze Mahnmale neben dem Gebäude. Sie waren schon da gewesen, als noch nicht einmal das erste Fundament gegossen war. Zeugen der Vergangenheit, die sie nie preisgeben würden. Wir glauben zwar alles zu wissen, nur kommunizieren können wir mit der Natur nicht.
Beide standen vor der Tür zum Garten und genossen die kühle, frische Luft, die leicht von den Bergen hinunter ins Tal geblasen wurde. Der Geruch nassen Grases wehte herüber und weckte Erinnerungen. Besonders bei Franz Josef Bernrieder, der auf dem Hof seiner Großeltern aufgewachsen war. Und jetzt auch dort wohnte. Sie redeten nichts. Sahen nur in den Himmel und genossen die absolute Stille. Alles, was zu hören war, war das Rascheln der Blätter auf den Bäumen. Manchmal auch ein Kauz, der seine Anwesenheit kund machte. Und die Vögel, die nie aufhörten ihr Lied zu singen. Jeder dachte für sich, was ihn in diesem Moment berührte. Keiner wusste von den Gedanken des anderen. Und doch waren sie miteinander verbunden. Man muss nicht immer reden, nur um sich zu unterhalten. Sich anzusehen war genug für die Verständigung. Die schönsten Zeiten sind manchmal die, in denen man nur stumm sich der Gesellschaft des anderen erfreut.
Plötzlich, ohne Vorwarnung, wurden sie von der Melodie eines Blasorchesters unterbrochen, brutal aus ihren Gedanken gerissen. Es war das Handy des Franz Josef Bernrieder.
»Geh nur dran, Franz. Könnt ja wichtig sein«, sagte Lothar Kolb, als der Kommissar ihn fragend ansah.
»Es is Sonntag.«
»Auch Sonntag passieren Dinge, auf die wir keinen Einfluss haben. Allein der liebe Gott weiß, was geschieht. Wir handeln nur.«
»Dann red amal mit ihm, dass ich auch meine Ruh haben will. Mindestens am Sonntag.«
»Franz, ich bin ein Diener Gottes, nicht sein guter Freund.«
Dann drückte er auf die entsprechende Taste und auf Lautsprecher. Er wusste, wer es war. Kannte die Nummer. Es war die Dienststelle.
»Ferdl, was is?«
Es war Ferdinand Hintermeier, der wachhabende Polizist an diesem Abend.
»Einen Anruf hamma, dass in einem Haus eingebrochen worden is.«
»Und was hab ich damit zum Tun? Ich bin die Mordkommission, Ferdl, des weißt doch. Einbruch macht der Toni.«
Toni Schwarzer war sein Name. Er war die zweite Autorität im Präsidium. Alles, was nicht Mord war, machte der Toni. Dazwischen gab es nichts.
»Ja, der Toni hat eben ang'rufen, dass er da bei einem Einbruch war, und wie er da hinkommen is, war da eine Frau im Zimmer g'legen, die sich nicht mehr g'rührt hat.«
»Auch des kommt vor, Ferdl. Die is halt g'storben. Is sehr populär. Machen viele. Eigentlich früher oder später alle.«
»Ja, aber der Toni hat g'meint, dass die nicht eines natürlichen Todes g'storben is und ich dich anrufen soll, dass du da hinfahr'st und dir des anschaust. Er macht nix, hat er g'sagt, bis dass du kommst.«
Franz Josef Bernrieder dachte nach. Es war wohl nicht zu vermeiden, dass er sich das ansah. Er wollte nicht, dass sein Kollege dort tagelang saß und auf ihn wartete. Das wäre dann doch unmenschlich.
»Ferdl, gib mir die Adress durch. Lothar, hast es eh g'hört. Unser plauschiger Abend is für heut vorbei.«
Dann legte er auf. Keine Minute später kam die Textmeldung mit der Adresse des Hauses. Er kannte die Gegend. Wie er eigentlich alle Gegenden kannte, in denen er sich normalerweise bewegte. Schließlich war das seine Heimat.
3
Es war ein großes, flaches Gebäude, das ihn erwartete. Eine Villa, wenn man so wollte, war es einmal gewesen. Das ganze Anwesen war in totalem Zerfall. Das Dach eingesunken und überwachsen mit Moos. Der Garten, wenn es denn einmal einen gegeben hatte, war voll überwuchert mit allen möglichen Pflanzen und Gras, das einen halben Meter hoch stand. Jemand sagte einmal, alles, was grün ist, Pflanzen sind, da spielt es keine Rolle, wie die heißen. Man sollte sie so nehmen, wie sie sind, und sich daran erfreuen. Mag sein, aber ein bisschen gepflegt und manikürt hat der Schönheit noch keinen Abbruch getan. Auch bei Pflanzen nicht.
Der Polizeiwagen stand vor der Einfahrt. Das ehemals schwere Eisengitter, das einmal das Tor zum Grundstück gewesen war, lag am Boden. Es war das einzige Haus weit und breit. Der nächste Nachbar konnte es nicht sehen, und auch von diesem Platz aus gab es keinen Blick zu einem anderen Anwesen. Einsam und verlassen stand es in der Landschaft. Als hätte es jemand nur dahin gestellt und vergessen. Vernachlässigt. Der Natur überlassen. Sicher war es einmal ein Zuhause gewesen. Menschen hatten darin gelebt, gelacht, gestritten, sich geliebt. Dann waren es immer weniger Menschen geworden, bis sich niemand mehr darum kümmerte.
Toni Schwarzer also, der Kollege, den er zwar kannte, zu dem er aber nicht sehr viel Kontakt hatte, stand an seinem Wagen und ging ihm ein paar Schritte entgegen. Meistens gab es bei Einbrüchen keine Toten und wenn, dann war es sowieso Mord, mit dem der Toni nichts zu tun haben wollte. Dass beide sich am selben Platz trafen, war eher die Ausnahme.
»Franz, mach dich auf was g'fasst. Des siehst du nicht jeden Tag.«
»Wieso, was is?«
»Der armen Frau hat jemand des ganze G'sicht zertrümmert. Des is nur noch Brei.«
Franz Josef Bernrieder schüttelte nur leicht den Kopf in Unverständnis, dass jemand so etwas tun konnte.
»A bisser'l Pietät, Toni. Und ruf bitte die Amelie an, dass die sofort herkommt. Und den Mittler brauch ma.«
»Den Doktor?«
»Genau den.«
»Aber des sieht man doch, dass die tot is. Des sieht a Blinder. Und außerdem is des –«
»Ja, ich weiß, dass des nicht deine Arbeit is. Toni, mach's einfach. Die Nummern hat der Ferdl im Büro. Ich wart hier auf die zwei mit ihrer Truppe.«
Dann ging er ins Haus. Alleine. Er musste keine Tür öffnen. Alles, was man irgendwie brauchen konnte, war bereits abgeschraubt, ausgebrochen, abgeschlagen, mitgenommen. Er zog seine Taschenlampe heraus, da es bereits dämmrig war, und tastete sich in einem gelben, schwachen Lichtkegel vorwärts. Dort lag sie, in dem großen Raum, in dem nur noch ein paar Stühle und ein kaputter Tisch waren. Und ein alter Teppich, von dem man nicht mehr sehen konnte, welche Farben er einmal gehabt hatte. Das musste das Wohnzimmer gewesen sein, ging es dem Franz durch den Kopf, da breite Türöffnungen auf den verwilderten Garten zeigten.
Der Toni hatte recht. Vom Gesicht war nichts mehr zu erkennen. Jemand musste mit blinder Wut auf die junge Frau eingeschlagen haben. Nur noch ein nicht zu übersehender, blutiger Fleck, der mittlerweile braun geworden war. Auch wenn er kein Arzt war, wusste er, dass es schon eine Zeitlang her war, als man sie umgebracht hatte. Fliegen in Massen hatten sich an der Leiche versammelt. Es summte wie in einem Bienenhaus. Kein schönes, leichtes Summen. Eher eines vom Ende. Einem traurigen Ende eines kurzen Lebens.
Ein alter Stuhl mit samtenem Polster stand in der Ecke des Raumes. Verstaubt, halb zerfleddert. Er holte ihn sich, setzte sich ein paar Meter vom Opfer entfernt hin und betrachtete sie. Er wusste, dass er das nicht machen sollte, aber in seiner langjährigen Zeit als Kommissar hatte er bereits viele Tote gesehen. Aber noch nie jemanden, der so zugerichtet worden war. Unglaublich, ging es ihm durch den Kopf.
»Den muss ich finden, und wenn des des Letzte is, was ich in meinem Leben mach«, sagte er leise zu sich selbst. Es war niemand außer ihm im Raum, nur die Leere, die ihn umgab. Und der Geruch von Verwesung. Gerade noch hatte er sich an seine Jugend erinnert, an den Duft von frisch gemähtem Gras. Und nun das hier.
Dann stützte er seinen Kopf in seine Hände und fing leicht an zu weinen. Nur kurz. Es war ganz einfach zu überwältigend.
Mit dem Ärmel seines Hemdes wischte er sich die kleinen Tränen aus dem Gesicht. Danach rief er seinen Kollegen Ferdl an und sagte ihm, er solle doch einmal herausfinden, wer in diesem Haus wohnte. Oder besser gewohnt hatte. Nach wenigen Minuten hatte er einen Namen. Martin Zeiler. Dieser war bereits seit Monaten verstorben.
Es dauerte nicht lange, und Amelie kam ins Zimmer. Er hatte das Auto gehört und ging ihr ein bisschen entgegen. Bevor sie den Raum betreten konnte, fasste er sie an den Schultern und sagte, sie solle sich auf etwas gefasst machen. Es sei kein schöner Anblick. Sie nickte, ging an ihm vorbei, und ein kurzer, hochoktaviger Schrei entfuhr ihr. Franz Josef Bernrieder hatte so etwas noch nie von ihr gehört.
»Nein, Franz, des is was b'sonders Brutales. Da hast recht. Wie kann ein Mensch des mit einem anderen Menschen machen?«
»Des müssen wir rausfinden, Amelie. Und ich geb nicht auf, bis ich des Monster hab.«
»Dann lass mich amal meine Arbeit machen. Wie ich seh, war jemand da auf dem Stuhl g'sessen. Warst des du?«
»Ich hab mich setzen müssen, des verstehst doch, oder? Der is da in der Ecken g'standen, nicht da, wo der jetz is. Ich kann ihn wieder da hinstellen.«
»Man sitzt nicht auf einem Stuhl am Tatort, Franz. Des solltest eigentlich wissen. Bist lang genug dabei. Aber jetz is eh schon egal.«
Sie nahm den Koffer, den sie in der Hand hatte, und legte ihn auf den Stuhl, auf dem der Kommissar bis vor ein paar Minuten noch gesessen hatte. Mittlerweile kamen auch die Kollegen in ihren weißen Anzügen, mit ihren Kappen und Handschuhen. Sie stellten Scheinwerfer auf, Tische, legten Tüten zurecht und fingen an, Bilder vom Tatort zu machen. Alles sah so professionell aus, so kalt, so automatisch. Niemand zeigte seine Gefühle. Wie Roboter verrichteten sie ihre Arbeit. Das musste wohl so sein, ging es dem Franz durch den Kopf. Und das war auch gut so. Sonst würde man wahrscheinlich nicht mehr schlafen können vor lauter Wut.
Amelie zog einen Ausweis aus der Tasche der Jeans, die die junge Frau anhatte, und gab ihn Franz Josef Bernrieder.
»Angelika Schrader heißt sie also«, sagte der Kommissar zu Amelie, als er den Ausweis eingehend betrachtete. Nicht, dass er noch nie einen Ausweis gesehen hätte, aber dieser Fall machte ihm zu denken. An die Schlechtigkeit der Menschen. Er musste sich noch an alles gewöhnen. Der erste Eindruck hatte ihn noch nicht verlassen.
»Schaut so aus. Jedenfalls wissen wir, wer sie is. Des hilft.«
»Und wir wissen, wie sie amal ausg'schaut hat.«
»Des auch.«
»Und einen Schlüssel hamma auch g'funden. Vielleicht is des der von ihrer Wohnung. Die Adresse is die Siedlung vor der Stadt.«
»Ja, die Gegend kenn ich. Ob der passt, werden wir rausfinden. Ich nehm den amal mit. Morgen fahr ich dahin und schau mich um.«
Kommissar Bernrieder ging wieder ein paar Schritte nach draußen. Dort stand er, angelehnt an einen alten, wuchtigen Baum. Er holte tief Luft, machte seine Lungen frei von dem unerträglichen Geruch im Haus. Er sah in den Himmel, wie vor ein paar Stunden mit seinem Freund Lothar Kolb. Dieses Mal war es kein entspannter Augenblick, den man festhalten wollte. Ganz und gar nicht.
Ein paar Minuten später kam Amelie mit einem abgebrochenen Stuhlbein. An einem Ende hatte es eine klobige Verdickung, an der der Sitzrahmen einmal festgemacht war. Sie zeigte es dem Kommissar.
»Franz, die Tatwaffe hamma auch schon. Hier, des Stuhlbein is voller Blut. Ob sie allerdings daran g'storben is, müss ma erst noch rausfinden. Kann ja sein, dass die schon vorher tot war. Ich würd mir des wünschen. Will mir gar nicht vorstellen, dass die lebendig so zug'richtet worden is. Und noch was hamma g'funden. Neben ihr und auf dem Boden, neben dem Stuhlbein. Mehrere Tüten Crystal Meth. So schaut's jedenfalls aus. Aber auch das werden wir bald wissen.«
»Du glaubst, des is ein Drogenmord? Ein paar Dealer, die sich nicht verstanden ham?«
»Weiß man's? Der erste Eindruck is jedenfalls eindeutig. Vielleicht finden wir ja Fingerabdrücke auf dem Stuhlbein, dann sind wir schon ein paar Schritte weiter.«
»So blöd wird der oder die nicht g'wesen sein, da Spuren zu hinterlassen.«
»Franz, wenn die voll sind, schalt des Hirn aus. Und wie des ausschaut, war des kein Mord im Affekt. Des war geplant und strategisch ausgeführt. Nur, wenn ich jemand unkenntlich machen will, lass ich nicht den Ausweis in der Taschen.«
»Da hast du wieder recht. Also wollt der oder die, dass wir wissen, wer die is.«
»Ja, vielleicht ein Zeichen setzen. Für alle andern, die den Scheiß vertreiben. Mao hat einmal g'sagt: ›Bestrafe einen, und du erziehst hunderte.‹ Und so arbeiten die.«
»Dann lass ich euch hier amal arbeiten. Ich bin morgen im Büro. Vielleicht hast ja dann schon was für mich.«
»Ich werd da sein. Ich hab übrigens g'hört, du bist jetz richtig gläubig g'worden. Wohnst sogar im Kloster.«
»Amelie, erstens is des kein Kloster sondern des Pfarrhaus von Birkenstein. Und da wohn ich nur so lang, bis meine Heizung in meinem Haus fertig is. Und zweitens bin ich heilfroh, dass mich der Lothar aufg'nommen hat.«
»Der soll ja auch nicht schlecht kochen, hört man.«
Er hatte angesichts der Situation keine große Lust, sich mit irgendjemandem über seine derzeitige Lebenslage zu unterhalten. Was er hatte sehen müssen, an diesem Abend, machte ihm einfach zu schaffen. Alles. Das alte, verfallene Haus, der Schrott, der herumlag, der Gestank von Verwesung, der sich langsam ausgebreitet hatte, die Fliegen, die immer mehr wurden, einfach alles. Er wollte nur noch gehen, sich noch ein paar Gläser des Selbstgebrannten gönnen und dann schlafen. Ob ihm eine gute Nacht gelingen würde, war fraglich. Wenn es sein musste, würde er Lothar noch wecken und mit ihm reden. Pfarrer sind da, dass man mit ihnen redet. Besonders über solche Probleme, die die Seele beschweren. Oder wie immer man das nennen will, was uns lenkt und wir nicht erklären können. Eines der vielen Dinge, die wir nie begreifen werden und ihnen nur Namen geben, weil wir wissen, dass es sie gibt. Ob wir das nun verstehen oder nicht.
»Ja, des kann er, der Lothar. Kochen mein ich. Hab dich gut, Amelie. Ich seh dich morgen.«
Damit verließ er langsam das Grundstück und ging zum Auto. Das Haus war in den letzten Minuten ein Schauplatz von unbändiger Tätigkeit geworden. Er war dort nur ein Störfaktor. Das wusste er, ohne dass es ihm jemand sagen musste.
4
Lothar Kolb saß noch wach auf dem Stuhl in der Küche, obwohl es fast Mitternacht geworden war. Er hatte sich an den Tisch gesetzt, an dem sie vor ein paar Stunden so schön gegessen hatten. Ein Glas Bier vor sich und zwei Gläser Schnaps. Daneben lag ein kleines Buch, in dem er las. Es war ein uraltes Buch, in kräftigem Leder gebunden. Wie es viele gab in diesem Pfarrhaus. Schöne Bücher waren es, die von anderen Zeiten berichteten. In einer blumenvollen Sprache, die es zu einer Zeit gegeben hatte, als man nur Bücher gehabt hatte, um träumen zu können.
»Setz dich, Franz, trink noch einen, und dann red. Ich seh dir an, dass dein Herz schwer is. Lass es raus, sonst frisst es sich bei dir ein, und du wirst es nie mehr los.«
Franz Josef Bernrieder tat wie geheißen. Langsam erzählte er, was in diesem Haus los war. Und wie schockiert er war. Und wie er es nicht verstehen konnte, dass Menschen so waren.
»Wie willst du denn, dass Menschen sind, Franz? Da du das nicht verstehst, was dort passiert ist, musst du ja eine Vorstellung haben, wie sie sein sollen.«
»Sie sollen die anderen respektier'n. Des würd schon reichen. Des wär doch schon amal ein Anfang.«
»So einfach ist das Leben nicht, Franz, das solltest du wissen. Der Mensch ist in seinem Verhalten durch sein Umfeld geprägt. Das macht ihn zu dem, was er ist. Schau dir die Leut an, die grad noch so rumkommen. Die Frauen kommen zu mir und erzählen mir, wie die Männer verzweifeln, weil sie zu stolz sind, einzusehen, was wirklich mit ihnen los ist. Oder die Jungen, die nicht wissen, was sie machen sollen, und immer tiefer in den Strudel versinken, der sich Leben nennt. Aber es kommen nicht mehr viele zu uns und suchen Hilfe. Alle denken, mit Geld kann man alle Probleme lösen. Also versuchen sie, so viel wie möglich davon zu anzuhäufen. Aber es hilft nicht. Was da drinnen los ist«, und damit zeigte er mit seinen Fingern auf seine Brust, »das wissen wir nicht und verstehen wir nicht. Und wir werden es nie erfahren. Auch mit dem ganzen Geld der Welt nicht.«
»Lothar, deswegen muss man nicht jemanden umbringen und so kaputtmachen wie die junge Frau.«
»Natürlich nicht, aber ich wett mit dir, dass es hier um Geld gangen is. Nichts anderes.«
»Oder um Liebe und Hass.«
»Ja, das kann auch sein. Man sagt, Hass ist die Stiefschwester der Liebe. Vielleicht ist das so. Auch der Hass ist oft mit Geld begründet. Man will nicht, dass der andere mehr hat als man selbst. Ein größeres Auto, eine schönere Wohnung, eine tolle Familie. Nur wenn man seinen Hass kontrollieren kann, ist man frei. Dieser Mensch konnte das nicht und wird den Rest seines Lebens darunter leiden. Und wenn du ihn findest, dann frag ihn, warum er das gemacht hat. Er wird es nicht wissen.«
»Die meisten wissen es nicht, da hast du recht. Manche können sich nicht erklären, was passiert ist.«
Es war Schweigen für einige Zeit. Jeder trank in Ruhe sein Bier. Lothar Kolb schenkte noch ein kleines Glas Schnaps nach. Man sah sich verständnisvoll an. Dann legten sie sich ins Bett. Der Abend war nicht so ausgegangen, wie man sich das erhofft hatte. Die Schwerelosigkeit war weg, hatte sich aufgelöst und wurde durch die Last der Schwermütigkeit ersetzt. Für Franz Josef Bernrieder war sie nur zu bändigen, wenn er den Fall lösen konnte.
5
Franz Josef Bernrieder fing den Tag an, wie er die meisten Tage begann. Er setzte sich ins Café Zuckmeier, trank seinen Kaffee und aß eine Butterbrezen. Und er wollte mit Fanny reden. Wie immer. Die Unterhaltungen drehten sich normalerweise nur darum, dass er sie nicht heiraten durfte. Er es aber wollte. Die Hoffnung stirbt zuletzt, sagte er zu sich selbst und der Fanny. Nein, meinte Fanny dann immer. Er hatte eben den falschen Beruf. Da gab es keine Hoffnung. Ihr zukünftiger Mann musste Konditor sein.
Die letzten Tage hatte er Frühstück bei Lothar Kolb, seinem vorüberziehenden Exil, gehabt. Große Frühstücke, die mehr als ein kleines Festmal ausarteten. Nur an diesem Tag, nachdem er die Tote gesehen hatte, musste er noch mit jemand anderem reden. Jemandem, der ihn verstand wie kein zweiter Mensch. Und Fanny war immer ein guter Gesprächspartner. Egal was er mit ihr diskutierte. Ja, es waren unbeschwerliche Jahre, die sie dort miteinander verbracht hatten. Er mit seinem Kaffee, sie mit ihrem reizenden Lächeln. Und das würde auch wieder werden. Wenn dieser Fall vorbei war.
Sie sah sofort, dass er nicht bester Laune war. Alle im Ort, die sich dafür interessierten, hatten es schon gehört, was über Nacht los gewesen war, also musste sie gar nicht erst fragen.
»Mach dir nicht so viel draus, Franz. Den wirst schon finden. Hast alle g'funden bisher.«
»Fanny, die hätt'st seh'n sollen, wie die ausg'schaut hat. Des muss ich erst amal verdauen. Und des dauert.«
»Ihr wisst's doch, wer des war, oder? Ich mein des Opfer.«
»Ja, des wissen wir. Und die Adress hamma auch. Und da werd ich jetz amal hinfahr'n und mir des anschau’n. Wenn ich den Kaffee fertig hab. Die Brezen is heut b'sonders gut, Fanny. Tut mir leid, dass ich selber nicht so gut drauf bin.«
»Franz, auch du bist nur ein Mensch. Auch wenn'st manchmal so tust, als wärst ein Superheld. Mir reicht des, wenn du ein Mensch bist, glaub mir. Helden haben immer so was von Abenteuer und Ferne und so. Die sind so schnell weg, wie's kommen. Wir brauchen dich hier, Franz. Und ich brauch dich hier.«
»Des is schön, dass du des sagst, Fanny. Wenn des vorbei is, dann …«
»Nix, Franz. Wenn des vorbei is, dann trinken wir einen, und des Leben geht weiter. So wie's immer weitergeht, auch wenn wir manchmal denken, des wird nix mehr.«
»Wahrscheinlich hast recht. Ich bin halt a bisser'l malad, aber des gibt sich. So, und jetz fahr ich zu der Adress. Vielleicht erfahr ich da ja was.«
Sie verabschiedeten sich wie immer. Mit einem kleinen Küsschen auf die Wange. Nicht mehr. Obwohl Franz Josef Bernrieder schon mehr gewollt hätte.
Die Adresse war in der Siedlung, wie man die Gegend nannte. Dort, wo nur einmal die Woche die Straßenreinigung durchfährt. Nicht wie im Ort, wo man jeden Tag so eine Besenmaschine sieht. Eine Gegend, die nicht im farbenfrohen Stadtprospekt abgedruckt ist. Und auch nicht im Reiseführer oder auf der Webseite des Reisebüros gefunden werden kann. Es gibt nämlich nichts zu sehen. Außer grauen Häusern mit kleinen Fenstern. Alles könnte mal wieder einen Anstrich vertragen, aber die Leute, die hier wohnten, beschwerten sich nicht. Sie waren froh, überhaupt eine Bleibe zu haben. Und die, die was zu sagen hatten, ließen sich nicht blicken. Außer es war wieder einmal Wahl, und der Bezirksvorstand ließ sich für ein paar Fotos sehen. Dann nahm er ein kleines Kind in den Arm, alle waren gerührt, und die Presse konnte nicht genug Fotos machen. Weiter redete er von Unterstützung und Vernachlässigung und Besserung. Die nie kommen würde, weil er es schon vergessen hatte, bevor er ins Auto stieg, um zu seinem nächsten Termin zu fahren, wo er dieselben auswendig gelernten Sprüche verlauten ließ.
In der Siedlung waren Parkplätze an jedem Ende der Häuserreihen. Mit einem Schild: ›Nur für Anwohner‹. Die Straße, die an die Eingänge führt, ist zu schmal, um dort zu parken. Es ist mehr ein breiter Fußweg. Als die Gebäude erstellt wurden, gab es nicht viele Autos. Also dachte man nicht daran. Was heute sogar wieder als Vorteil gesehen wird.
Der Platz zwischen den Gebäuden war genauso verkommen wie die Häuser selbst. Der Sandkasten in der Mitte, in dem vielleicht einmal die Kinder gespielt hatten, war nur noch ein Ort für die Hunde, um dort ihr Geschäft zu machen.
Franz Josef Bernrieder ging eine Häuserzeile entlang. Eine von mehreren nebeneinander. Dazwischen immer diese Fläche, die einmal grün gewesen sein mochte. Das wenige Gras, das dort gewachsen war, war fast komplett zertrampelt. Nun war es nur noch festgetretene Erde, hart wie Beton, mit Abfall verziert, die sich bei Nässe in Schlamm verwandeln würde. Ein Windstoß wehte Papiertücher in die Luft, die sich an einem alten Baum verfingen, der fast keine Blätter hatte.
Er suchte die Nummer fünfundfünfzig. Das Haus fing mit Nummer siebenundvierzig an, also noch vier Türen. Es gab insgesamt sechs. Die ungeraden Nummern also. Alte Frauen hingen am Fenster, auf abgenutzte Kissen gestützt, und schauten auf den Hof, durch den er ging. Er galt sicher als eine Abwechslung, die man genau beobachtete. Dann hatte man was zum Reden. Alle wussten, wer er war und wohin er ging. Wenn sie es auch nicht wussten.
Er zog langsam an Mülltonnen vorbei, die überquollen und einmal geleert werden sollten. Es roch dementsprechend. Ein paar Jugendliche hingen um eine Parkbank herum und rauchten. Einer spielte mit einem Messer, das er immer wieder auf den Boden warf. Dort blieb es stecken, er zog es heraus. Das Spiel begann von Neuem. Andere überholten ihn mit kleinen Fahrrädern oder Skateboards. Was Jugendliche eben machen, wenn sie nichts Besseres zu tun haben.
An der Tür angekommen, las der Kommissar die Namen auf einem Schild, an dem Klingelknöpfe angebracht waren. Die meisten waren auf einfache Papierstreifen geschrieben und dort mit Klebeband festgemacht. Scheinbar richtete man sich nicht für die Ewigkeit hier ein. A. Schrader und M. Söller standen auf blauem Aufkleber neben einer Klingel. Sie hatte also einen Mitbewohner. Oder eine Mitbewohnerin. Wenn er oder sie zu Hause war, sollte er klingeln und nicht den Schlüssel benutzen, den er aus der Tasche gezogen hatte. Wer weiß, wer die Person war und wie diese reagierte, wenn er einfach so eintrat.
Die Wohnung lag im ersten Stock. Es gab noch ein Stockwerk darüber. Dann kam nur noch der Dachboden. Die Tür war offen, der Hausgang eng und dunkel. Nirgendwo konnte Licht eindringen. Alles war zu, wie in einer Höhle. Man musste einen roten Knopf an der Wand drücken, damit das Licht anging, wie er herausfand. Man konnte ihn nicht übersehen. Es ist immer besser, Licht zu haben, wenn es auch sehr schwach ist.
Die Natursteintreppen waren so grau wie die Wände, die mit allen möglichen Graffitis vollgemalt waren. Meist sexueller Natur. Oder Liebesbekundungen für ein Mädchen, das vielleicht einmal hier gewohnt hatte. Die Liebe hatte nicht gehalten, da der Name mehrmals ausgestrichen und mit einem anderen ersetzt worden war. Immer wieder.
Eine Frau wusch mit einem nassen Mopp gerade die Treppe. Sie brauchte kein Licht. Wahrscheinlich konnte sie das blind.
»Guten Morgen Frau Faber.«
Die Frau sah den Kommissar an wie einen Geist, der aus einem Erdloch aufgestiegen war und sie jetzt gleich mitnahm. Vielleicht wünschte sie sich das. Ganz im Inneren ihres Herzens. Alles wäre vielleicht besser, als hier die Treppen zu waschen.
»Woher wissen Sie, wie ich heiß? Und wer sind denn Sie?«
»Verzeihung, Frau Faber. Ich bin Kommissar Bernrieder von der Polizei, und den Namen hab ich auf dem Schild g'lesen, wie ich des Licht ang'macht hab. Da steht, dass heut die Frau Faber den Treppendienst hat. Und da bin ich davon aus'gangen, dass Sie des sind. Hätt natürlich auch nicht sein können.«
Aufgestützt auf ihren Mopp, sah sie den Kommissar mit halb offenem Mund entgeistert an.
»So, von der Polizei sind's. Ich seh aber nicht, dass Sie von der Polizei sind. Die Polizei, die ich kenn, schaut auch aus wie Polizei.«
»Nicht alle haben eine Uniform, Frau Faber.«
Damit schlängelte er sich an ihr vorbei in den ersten Stock. Sie stand immer noch regungslos da und sah ihm angestrengt nach.
»Ham's was ang'stellt, die zwei?«, rief sie ihm nach.
»Welche zwei?«, wollte der Kommissar wissen und blieb auf halber Treppe stehen.
»Ja, die zwei Frauen, die da einzogen sind. Des hamma grad noch braucht, dass da zwei Frauen wohnen. Zusammen, mein ich. Die Ingrid sagt des auch. Des hats früher nicht geben, Herr Kommissar. Eine Sünde is des. Des sagt auch der Pfarrer. Des wundert mich ja jetz überhaupt nicht, dass Sie da sind. Des war nur eine Frage der Zeit. Hat auch die Ingrid g'sagt.«
»Ja, Frau Faber, des is schon schlimm, aber es gibt Schlimmeres, glauben's mir.«
Dann nahm er den Rest der Stufen. Er wollte sich nun doch nicht mit Frau Faber unterhalten. Schon gar nicht darüber.
Franz Josef Bernrieder drückte die Klingel neben der Tür. Es war ein einfacher Klingelton, wie man ihn auf einem Fahrrad hatte. Keine Melodie oder kleines Konzert, wie es heute üblich und modern war. Nur eben elektrisch war er. Er hörte Schritte, und dann fragte eine Frauenstimme aus der verschlossenen Wohnung, wer er sei und was er wolle.
»Kommissar Bernrieder von der Polizei in Bad Tölz. Sind Sie Frau Söller? Ich müsste in die Wohnung, bitte.«
»Und warum wollen's in die Wohnung?«
»Sind Sie Frau Söller oder nicht?«
»Ja, warum? Was is denn?«
»Dann machen's bitte auf, sonst sperr ich selber auf. Ich hab nämlich einen Schlüssel. Und wenn ich drin bin, dann reden wir, und ich sag Ihnen, was los is. Hier draußen is des keine gute Idee. Oder Sie wollen, dass des, was ich Ihnen zum Sagen hab, in zehn Minuten die ganze Straß weiß.«
Frau Faber, die immer noch auf ihren Mopp gestützt dem Treiben zugesehen hatte, drehte sich plötzlich um und fing wieder an zu putzen. So, als würde sie das alles nichts angehen. Der Kommissar sah sie an und wusste es besser.
Zwei Schlösser wurden von innen entriegelt, dann die Tür geöffnet. Frau Söller machte Platz, dass der Kommissar eintreten konnte.
Frau Söller war etwa Mitte dreißig, schlank, hatte volle, dunkle Haare, die sie locker über die Schulter hängen ließ. Ihr Gesicht war etwas aufgedunsen, aber nicht unhübsch. Zwei kleine, wache, blaue Augen musterten ihn. Bekleidet war sie mit einer dunklen Hose und einem weiten, viel zu großen, roten Pullover. Man konnte keine Figur ausmachen. Ihre Füße steckten in schwarzen Sandalen. Die Zehennägel waren in einem leuchtenden Grün bemalt.
Es war eine winzige Wohnung. Alles war eng und klein. Es roch nach abgestandenem Kaffee und Mottenpulver. Und nach altem Bohnerwachs. Ein Geruch, der nie mehr zu verschwinden scheint, hat man ihm einmal die Chance gegeben, sich breitzumachen. Der Linoleumboden im Flur war abgetreten und an manchen Stellen aufgebogen, aber sauber. Zwei Türen zweigten von dem kleinen Gang nach rechts ab. Nach vorne ging es in die Wohnküche. Links waren das Bad und die Toilette. Man sah es, da alle Türen offen waren. Der restliche Raum, in dem sie standen, war eine Art Garderobe. Kommissar Bernrieder dachte daran, dass seine Garage größer war als diese Wohnung.
»Können wir uns irgendwo setzen, Frau Söller?«
Franz Josef Bernrieder hatte seinen Ausweis aus der Jacke gezogen und ihn der Frau gezeigt. Sie schaute nur kurz darauf, als wollte sie sagen: ›Wird schon stimmen.‹
»Sagen's mir doch endlich, was los is und warum's kommen sind. Is was mit der Angelika?«
»Wieso denken Sie, dass was mit ihr is?«
»Weil's nicht daheim is und dafür Sie da sind. Ich mein, die Polizei kommt doch nicht nur so, oder? Ich bin grad vom Dienst kommen und hab sie nicht g'sehn. Erst hab ich g'rufen und dann ins Zimmer g'schaut. Dann hab ich sie schon ang'rufen, wo's bleibt, aber irgendwie is ihr Telefon tot. Vielleicht der Akku leer. Sie hat nie drauf g'achtet, wenn der hätt laden müssen.«
Beide standen immer noch im schmalen Flur. Ungemütlich schmal.
»Sie wird nicht mehr heimkommen, Frau Söller. Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass Angelika Schrader eines unnatürlichen Todes g'storben is. Wie und warum des passiert is, is meine Aufgabe, rauszufinden, und deswegen müssen wir jetz reden.«
Frau Söller geriet leicht ins Schwanken. Mit einer Hand an den Wänden schaffte sie es, sich in die Küche zu balancieren und auf die Eckbank zu setzen. Es war das einzige Möbelstück dort. Ein kleiner Tisch stand davor. Dann gab es noch einen Gasherd und einen schmalen Schrank. Das war alles. Ein Fenster ging hinaus in den Hof und auf das gegenüberliegende Haus.
Nach wenigen Minuten hatte sich Frau Söller beruhigt. Es trat wieder Farbe in ihr fahl gewordenes Gesicht. Sie stand auf, ging zur Spüle, ließ ein Glas Wasser einlaufen und trank es in einem Zug aus. Dann setzte sie sich wieder.
»Jetz reden's, bitte. Was is los?«
»Wir haben sie in einem alten Haus gefunden. Das Haus gehört einem gewissen Martin Zeiler. Sagt Ihnen des was? Kennen Sie des Haus?«
»Aber ja, nur der Herr Zeiler is doch tot. Des Haus is doch schon lang leer, soviel wie ich weiß.«
»Wieso kennen Sie des Haus?«
»Weil die Angelika da g'arbeitet hat, bevor sie im Krankenhaus ang'fangen hat.«
»Was hat sie da g'arbeitet?«
»Sie war Krankenpflegerin. So ambulant, wissen's. Is von einem Haus zum andern g'fahren und hat die alten Leut g'holfen beim Anziehen und Duschen und so. Dann hat's noch was zum Essen g'macht und is zum Nächsten. Und der Herr Zeiler war einer von ihre Kunden. Wie der dann kurz vor Weihnachten g'storben is, hat's aufg'hört mit dem Rumfahren und is zu uns ins Krankenhaus kommen. War ihr einfach zu viel, hat's g'meint. Jetz pflegts da in der Klinik die alten Leut, die nicht mehr lang zum Leben ham.«
»Sie meinen, hat gepflegt.«
»Ja, logisch.«
»Frau Schrader hat ihn also gepflegt, den Herrn Zeiler.«
»Ja, richtig. Ja mei, des is aber schlimm. Wie is sie denn g'storben? Ich mein, was is denn passiert?«
»Des kann ich Ihnen leider nicht sagen. Laufende Ermittlung und so. Des müssen's versteh'n. Sagen's, Frau Söller, wissen Sie, ob die Frau Schrader Drogen g'nommen hat?«
Frau Söller sah den Kommissar mit weit geöffneten Augen entgeistert an und musste erst einmal tief Luft holen. Diese Frage hatte sie nicht erwartet. Dann antwortete sie, vielleicht etwas lauter, als sie sollte. »Drogen? Die Angelika? Nie, Herr Kommissar, niemals. Die war so gegen Drogen, des können's gar nicht glauben.«
»Und des wissen Sie so genau?«
»Des weiß ich, weil ich erstens mit ihr g'lebt hab, und zweitens is ihr kleiner Bruder vor zwei Jahren an Drogen kaputtgangen. Des Zeug hat sie nicht einmal angefasst, geschweige den g'nommen. Des können's mir glauben. Des is so sicher wie des Amen in der Kirch.«
Irgendwie kam es dem Kommissar vor, als wäre sie ein bisschen schockiert gewesen, dass er diese Frage überhaupt gestellt hatte. Vielleicht sogar etwas zu sehr echauffiert.
»Wir müssen des fragen, Frau Söller, weil wir an dem Tatort Drogen g'funden ham. Ich wollt nur wissen, ob die von ihr waren. Haben Sie eine Vorstellung, was die Frau Schrader da in dem Haus g'wollt hat?«
»Nein, keine Ahnung. Die war, seitdem der Zeiler g'storben is, nur ein paarmal da g'wesen. Vorbeifahren hats wollen, weil die den scheinbar ganz gern g'habt hat. Des muss ein netter Mensch g'wesen sein. Soviel ich weiß, des hat sie mir amal erzählt, hat der keine Erben g'habt, und des Haus is, wie's ausschaut, jetzt a bisser'l verfallen. Ich weiß des nicht so genau, weil ich nie da war. Des hat sie mir nur erzählt. Und des hat sie auch a bisser'l traurig g'macht, glaub ich.«
»Was hat sie traurig g'macht?«
»Dass der so allein war. So ohne Familie und so. Ich glaub, der hat sie ganz gern mögen, die Angelika.«
Franz Josef Bernrieder schrieb sich das alles in Stichworten in sein kleines Telefon, damit er es nicht vergessen konnte. Nur Stichpunkte. Er hatte sich das vor Kurzem angewöhnt. Zur Erinnerung. Irgendwie musste er das alles niederschreiben. Auch wenn das Tastenfeld nicht viel größer war als eine Briefmarke.