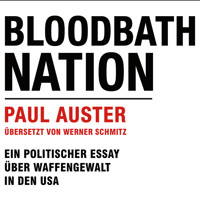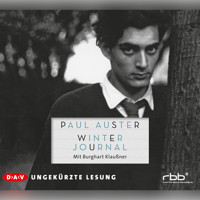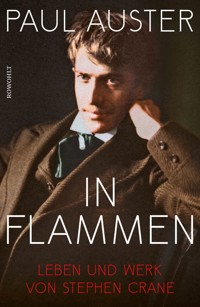9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Paul Auster führt uns in seine frühe Kindheit, in eine Zeit, in der die Uhren noch Gesichter, die Stifte noch Flugzeuge, die Äste von Bäumen noch Arme sein konnten und auch der Mann im Mond, obgleich ohne Gestalt, noch ein echter Mann war. Auster beschreibt diese phantastische Welt vor den Begriffen mit großer Wärme und leichter Hand. Aber die Fragen, die sich ihm und uns darin stellen, haben Gewicht: Wann werden einem Menschen die Koordinaten seiner Lebenssituation bewusst? Wann begreift sich der kleine Junge aus New Jersey als Amerikaner? Wann als amerikanischer Jude? Gemeinsam mit seinen Lesern lernt Auster jenen Paul neu kennen, der ihm viele Jahre später nur noch schemenhaft vor Augen steht, der allmählich zum Künstler heranwächst, rastlos in winzigen Pariser Zimmern ausharrt, Drehbücher und Liebesbriefe schreibt, Ideen verfolgt und verwirft, die Studentenrevolte in New York erlebt und sich zunehmend professionell dem Schreiben widmet. Dieses Buch ist ein stimmiges Gegenstück zum «Winterjournal». Nach der Geschichte seines Körpers erzählt Auster ebenso unverstellt und poetisch die Geschichte seiner Bewusstwerdung: «Die Welt ist in meinem Kopf. Mein Körper ist in der Welt.»
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 357
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Paul Auster
Bericht aus dem Inneren
Über dieses Buch
Paul Auster führt uns in seine frühe Kindheit, in eine Zeit, in der die Uhren noch Gesichter, die Stifte noch Flugzeuge, die Äste von Bäumen noch Arme sein konnten und auch der Mann im Mond, obgleich ohne Gestalt, noch ein echter Mann war. Auster beschreibt diese phantastische Welt vor den Begriffen mit großer Wärme und leichter Hand. Aber die Fragen, die sich ihm und uns darin stellen, haben Gewicht: Wann werden einem Menschen die Koordinaten seiner Lebenssituation bewusst? Wann begreift sich der kleine Junge aus New Jersey als Amerikaner? Wann als amerikanischer Jude?
Gemeinsam mit seinen Lesern lernt Auster jenen Paul neu kennen, der ihm viele Jahre später nur noch schemenhaft vor Augen steht, der allmählich zum Künstler heranwächst, rastlos in winzigen Pariser Zimmern ausharrt, Drehbücher und Liebesbriefe schreibt, Ideen verfolgt und verwirft, die Studentenrevolte in New York erlebt und sich zunehmend professionell dem Schreiben widmet. Dieses Buch ist ein stimmiges Gegenstück zum «Winterjournal». Nach der Geschichte seines Körpers erzählt Auster ebenso unverstellt und poetisch die Geschichte seiner Bewusstwerdung: «Die Welt ist in meinem Kopf. Mein Körper ist in der Welt.»
Vita
Paul Auster wurde 1947 in Newark, New Jersey, geboren. Er studierte Anglistik und vergleichende Literaturwissenschaften an der Columbia University und verbrachte einige Jahre in Frankreich. Heute lebt er in Brooklyn. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder. Sein umfangreiches, vielfach preisgekröntes Werk umfasst neben 16 Romanen auch Essays und Lyrik.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Oktober 2014
Covergestaltung ANZINGER WÜSCHNER RASP, München,
nach der Originalausgabe von Faber & Faber, UK
Coverabbildung Umschlagfoto: privat
ISBN 978-3-644-02841-8
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Bericht aus dem Inneren
Zwei Schläge an den Kopf
1
2
Zeitkapsel
Album
Bildnachweis
Bericht aus dem Inneren
Am Anfang war alles lebendig. Die kleinsten Gegenstände waren mit pochenden Herzen ausgestattet, und selbst die Wolken hatten Namen. Scheren konnten gehen, Telefone und Teekessel waren Cousins, Augen und Brillen waren Brüder. Das Zifferblatt der Uhr war ein Gesicht, jede Erbse in deinem Napf hatte eine eigene Persönlichkeit, und der Kühlergrill vorn am Auto deiner Eltern war ein grinsendes Maul mit vielen Zähnen. Bleistifte waren Luftschiffe. Münzen waren fliegende Untertassen. Die Äste der Bäume waren Arme. Steine konnten denken, und Gott war überall.
Es war nicht schwer zu glauben, dass der Mann im Mond wirklich ein Mann war. Du konntest sein Gesicht vom Nachthimmel auf dich hinabblicken sehen, und zweifellos war es das Gesicht eines Menschen. Nebensächlich, dass dieser Mann keinen Körper hatte – was dich betraf, war er dennoch ein Mann, und die Möglichkeit, dass in alldem ein Widerspruch stecken könnte, ist dir nie in den Sinn gekommen. Zugleich schien es vollkommen glaubhaft, dass eine Kuh über den Mond springen konnte. Und dass Teller und Löffel miteinander Reißaus nahmen.
Deine frühesten Gedanken, Überbleibsel dessen, wie du als kleiner Junge in dir selbst gelebt hast. Du kannst dich nur an weniges davon erinnern, einzelne Fetzen und Bruchstücke, hin und wieder ein kurzes Aufblitzen von Bildern, willkürlich und unerwartet – hervorgerufen von einem Geruch, von einer Berührung, von einem Lichtstrahl, wie er im Hier und Jetzt des Erwachsenenlebens auf einen Gegenstand fällt. Zumindest denkst du, dass du dich erinnerst, du glaubst dich zu erinnern, aber vielleicht erinnerst du dich gar nicht oder erinnerst dich an eine spätere Erinnerung dessen, was du in jener fernen Zeit, die jetzt für dich so gut wie verloren ist, gedacht zu haben glaubst.
Es ist der 3. Januar 2012, auf den Tag genau ein Jahr nachdem du dein letztes Buch angefangen hast, dein mittlerweile fertiges Winterjournal. Über deinen Körper zu schreiben, die mannigfachen Schläge und Freuden aufzuzählen, die dein physisches Ich erlebt hat, war das eine; etwas ganz anderes, eine vielleicht unlösbare Aufgabe dürfte es sein, deine Gedanken zu durchforschen, wie du sie aus deiner Kindheit in Erinnerung hast. Dennoch fühlst du dich getrieben, es zu versuchen. Nicht weil du ein rares und außergewöhnliches Untersuchungsobjekt zu sein glaubst, sondern ganz im Gegenteil, weil du dich für alltäglich hältst, für einen Menschen wie alle anderen.
Dass deine Erinnerungen nicht ganz und gar trügerisch sind, beweist dir allein die Tatsache, dass du immer noch gelegentlich in alte Denkmuster verfällst. Spuren davon sind dir bis übers sechzigste Lebensjahr hinaus geblieben, der Animismus der frühen Kindheit ist nicht vollständig aus deinem Kopf verbannt, und jeden Sommer liegst du auf dem Rücken im Gras, siehst zu den vorbeitreibenden Wolken hinauf und beobachtest, wie sie zu Gesichtern werden, zu Vögeln und anderen Tieren, zu Staaten und Ländern und imaginären Königreichen. Immer noch erinnert dich der Kühlergrill eines Autos an Zähne, und der Korkenzieher ist immer noch eine tanzende Ballerina. Ungeachtet deiner äußeren Erscheinung bist du immer noch, wer du warst, auch wenn du nicht mehr derselbe bist.
Beim Nachdenken darüber, worauf du mit alldem hinauswillst, bist du zu dem Entschluss gekommen, die Grenze von zwölf nicht zu überschreiten, denn nach dem zwölften Lebensjahr warst du kein Kind mehr, die Pubertät lauerte, erste Schimmer erwachsenen Denkens glommen in deinem Gehirn, du wurdest ein anderer Mensch als das kleine Wesen, dessen Leben ein immerwährendes Eintauchen ins Neue war, das täglich etwas zum ersten Mal tat, mehrmals täglich, und was dich jetzt beschäftigt, ist dieses langsame Fortschreiten von ahnungslos zu nicht mehr ganz so ahnungslos. Wer warst du, kleiner Mann? Wie bist du zu einem Menschen geworden, der denken konnte, und wohin hat dein Denken dich geführt, als du denken konntest? Grabe die alten Geschichten aus, scharre nach allem, was du finden kannst, dann halte die Scherben ans Licht und sieh sie dir an. Tu das. Versuch es.
Natürlich war die Welt eine Scheibe. Wenn jemand dir zu erklären versuchte, die Erde sei eine Kugel, ein Planet, der um die Sonne kreise und mit acht anderen Planeten ein sogenanntes Sonnensystem bilde, konntest du nicht verstehen, was der ältere Junge da sagte. Wenn die Erde rund wäre, müssten die Menschen jenseits des Äquators doch herunterfallen; undenkbar, dass man sein ganzes Leben auf dem Kopf stehend verbringen konnte. Der ältere Junge versuchte dir die Schwerkraft begreiflich zu machen, aber auch das ging über deine Fassungskraft. In deiner Vorstellung stürzten Millionen von Menschen kopfüber durch die Finsternis einer ewigen, alles verschlingenden Nacht. Wenn die Erde wirklich rund ist, sagtest du dir, dann wäre der einzig sichere Ort zum Leben der Nordpol.
Zweifellos beeinflusst von den Zeichentrickfilmen, die du so gern gesehen hast, dachtest du, aus dem Nordpol rage eine Stange heraus. So etwas wie diese gestreiften, rotierenden Säulen, die damals noch vor den Friseurläden standen.
Sterne hingegen waren ein unlösbares Rätsel. Keine Löcher im Himmel, keine Kerzen, keine Glühbirnen, nichts, was mit irgendetwas, das du kanntest, Ähnlichkeit hatte. Die ungeheure Masse der schwarzen Luft über dir, der unermessliche Raum zwischen dir und diesen winzigen Lichtpunkten war einfach nicht zu begreifen. Gütig und schön schwebten sie in der Nacht und waren nur da, weil sie da waren, einen anderen Grund gab es nicht. Von Gottes Hand geschaffen, ja, aber was um alles in der Welt hatte er sich dabei gedacht?
Deine damaligen Lebensverhältnisse: Amerika um die Jahrhundertmitte; Mutter und Vater; Dreiräder, Fahrräder und Handwagen; Radios und Schwarzweißfernseher; Autos mit Gangschaltung; zwei kleine Wohnungen, dann ein Haus in der Vorstadt; anfangs schwacher Gesundheitszustand, dann normale Jungenstärke; staatliche Schule; eine Familie aus der strebsamen Mittelschicht; ein Städtchen mit fünfzehntausend Einwohnern: Protestanten, Katholiken und Juden, fast alle weiß, nur sehr wenige Schwarze, aber keine Buddhisten, Hindus oder Moslems; eine kleine Schwester und acht Cousins und Kusinen; Comichefte; Rootie Kazootie und Pinky Lee; «I Saw Mommy Kissing Santa Claus»; Campbell-Suppe, Wonder Bread und Dosenerbsen; frisierte Autos, Zigaretten für dreiundzwanzig Cent die Packung; eine kleine Welt innerhalb einer großen Welt, damals für dich die ganze Welt, da die große Welt noch nicht sichtbar war.
Bewaffnet mit einer Mistgabel, rennt der wütende Farmer Gray quer durch ein Kornfeld Felix dem Kater nach. Beide können nicht sprechen, rasend schnelle Musik begleitet ihre Taten, und während die zwei sich den nächsten Kampf ihres niemals endenden Krieges liefern, bist du fest davon überzeugt, dass sie wirklich sind, dass diese grob gezeichneten Schwarzweißfiguren nicht weniger lebendig sind als du selbst. Sie kommen jeden Nachmittag in einer Fernsehsendung namens Junior Frolics, präsentiert von einem Fred Sales, der dir nur als Onkel Fred bekannt ist, der weißhaarige Hüter dieses Wunderlands, und weil du keine Ahnung hast, wie Zeichentrickfilme hergestellt werden, keinen Schimmer, wie man Gezeichnetes dazu bringt, sich zu bewegen, nimmst du an, es müsse eine Art Alternativuniversum geben, in dem Figuren wie Farmer Gray und Felix der Kater existieren können – nicht als Bleistiftstriche, die über den Bildschirm tanzen, sondern als dreidimensionale, echte Lebewesen, groß wie Erwachsene. Dass sie groß sind, verlangt die Logik, denn die Leute, die im Fernsehen zu sehen sind, sind in Wirklichkeit immer größer als ihre Abbilder auf dem Bildschirm, und die Logik verlangt auch, dass sie in ein Alternativuniversum gehören, da das Universum, in dem du selber lebst, nicht von Zeichentrickfiguren bevölkert ist, sosehr du dir das auch wünschen magst. Du bist fünf Jahre alt, als deine Mutter eines Tages verkündet, sie wolle mit dir und deinem Freund Billy das Studio in Newark besuchen, von wo aus Junior Frolics gesendet wird. Du wirst Onkel Fred persönlich kennenlernen, sagt sie, und bei der Sendung mitmachen. Das ist aufregend für dich, sehr aufregend, aber noch aufregender ist die Vorstellung, dass du nun endlich, nach monatelangem Kopfzerbrechen, Farmer Gray und Felix den Kater mit eigenen Augen sehen wirst. Endlich wirst du erfahren, wie sie wirklich aussehen. Schon malst du dir eine riesige Bühne aus, auf der das Geschehen sich entfaltet, eine Bühne, so groß wie ein Footballfeld, auf der der griesgrämige alte Farmer und die schlaue schwarze Katze einander bei einem ihrer epischen Scharmützel hin und her jagen. Am ausgemachten Tag jedoch spielt sich nichts so ab, wie du es dir vorgestellt hast. Das Studio ist klein, Onkel Fred hat Schminke im Gesicht, man gibt dir eine Tüte Pfefferminzbonbons, damit du während der Sendung was zu knabbern hast, und du nimmst mit Billy und den anderen Kindern auf der Tribüne Platz. Du schaust auf das hinab, was die Bühne sein sollte, was aber tatsächlich nur der Betonboden des Studios ist, und erblickst dort einen Fernsehapparat. Nicht einmal einen besonderen Apparat, sondern einen, der weder größer noch kleiner ist als der bei euch zu Hause. Von Farmer und Kater weit und breit keine Spur. Onkel Fred begrüßt die Zuschauer und sagt den ersten Zeichentrickfilm an. Und auf dem Bildschirm erscheinen Farmer Gray und Felix der Kater und springen nicht anders herum, als sie es immer tun, immer noch in diesem Kasten gefangen, immer noch so klein wie eh und je. Das bringt dich völlig durcheinander. Du überlegst, worin dein Irrtum bestanden hat, welchem Denkfehler du aufgesessen bist. Das Wirkliche steht so trotzig im Widerspruch zum Vorgestellten, dass du nur denken kannst, man habe dir einen bösen Streich gespielt. Maßlos enttäuscht, bringst du es kaum über dich, dir die Filme anzusehen. Als du hinterher mit Billy und deiner Mutter zum Auto gehst, schmeißt du die Bonbons angewidert weg.
Gras und Bäume, Insekten und Vögel, kleine Tiere und die Geräusche dieser Tiere, wenn sie unsichtbar durch die Büsche preschten. Du warst fünfeinhalb, als deine Familie die beengte Gartenwohnung in Union verließ und sich in dem alten weißen Haus an der Irving Avenue in South Orange niederließ. Kein großes Haus, aber das erste Haus, das deine Eltern bewohnten, und damit auch dein erstes Haus, und mochte es drinnen auch nicht sehr geräumig sein, erschien der Garten hinterm Haus dir riesengroß, denn eigentlich waren es zwei Gärten, der erste eine kleine Grasfläche unmittelbar hinter dem Haus, begrenzt vom halbmondförmigen Blumenbeet deiner Mutter, und weil jenseits der Blumen eine weiße Holzgarage das Grundstück in zwei eigenständige Gebiete aufteilte, gab es dahinter einen zweiten Garten, den hinteren Garten, wilder und größer als der vordere, ein abgeschiedenes Reich, dein neues Reich, in dem du intensive Forschungen an Flora und Fauna betriebst. Das einzige Anzeichen menschlichen Wirkens dort hinten war der Gemüsegarten deines Vaters, genau genommen ein Tomatengarten, den er bald nach dem Einzug 1952 angelegt hatte; und in den sechsundzwanzigeinhalb Jahren, die ihm von seinem Leben noch blieben, verbrachte dein Vater jeden einzelnen Sommer mit der Pflege seiner Tomaten, der saftigsten und rötesten New-Jersey-Tomaten, die man je gesehen hatte, jeden August große Körbe voller Tomaten, so viele Tomaten, dass er sie verschenken musste, bevor sie schlecht wurden. Der Garten deines Vaters an der Garage im hinteren Garten. Sein Stückchen Erde, aber deine Welt – wo du lebtest, bis du zwölf warst.
Wanderdrosseln, Finken, Blauhäher, Pirole, Scharlachtangaren, Krähen, Spatzen, Zaunkönige, Kardinäle, Amseln und gelegentlich ein Hüttensänger. Vögel kamen dir nicht weniger merkwürdig als Sterne vor, und weil ihr wahres Zuhause die Luft war, gehörten Vögel und Sterne für dich zur selben Familie. Die unbegreifliche Gabe zu fliegen, ganz zu schweigen von der Vielfalt leuchtender und matter Farben, das alles war eifriger Beobachtung wert, doch was dich an ihnen am meisten faszinierte, waren die Laute, die sie von sich gaben, jede Vogelart in ihrer eigenen Sprache, ob melodische Lieder oder schroffes, zanksüchtiges Geschrei, und früh schon glaubtest du, dass sie miteinander sprachen, dass diese Laute artikulierte Wörter einer besonderen Vogelsprache waren, und so wie es Menschen verschiedener Hautfarben gab, die sich in zahllosen Sprachen verständigten, war es auch mit den fliegenden Kreaturen, die manchmal in deinem hinteren Garten auf dem Gras herumhüpften, und die Wanderdrosseln unterhielten sich in einer Sprache, die ihr eigenes Vokabular und eigene grammatische Regeln hatte und ihnen so verständlich war wie das Englische dir.
Im Sommer: einen Grashalm der Länge nach spalten und darauf blasen; abends Glühwürmchen fangen und mit deinem magisch leuchtenden Glas umhergehen. Im Herbst: dir die geflügelten Früchte, die von den Ahornbäumen fielen, auf die Nase stecken; Eicheln vom Boden auflesen und so weit werfen, wie du konntest – tief in die Büsche hinein und außer Sicht. Eicheln waren von Eichhörnchen begehrte Delikatessen, und da Eichhörnchen die Tiere waren, die du am meisten bewundertest – ihre Flinkheit! ihre todesverachtenden Sprünge hoch oben im Gezweig der Eichen! –, hast du genau beobachtet, wie sie kleine Löcher ins Erdreich gruben und dort Eicheln versteckten. Deine Mutter erklärte dir, sie sparten sich die Eicheln für die mageren Wintermonate auf, tatsächlich aber hast du nicht ein einziges Mal beobachtet, dass ein Eichhörnchen im Winter eine Eichel ausgrub. Weshalb du zu dem Schluss kamst, dass sie nur aus Spaß am Graben ihre Löcher aushoben, dass sie aufs Graben versessen waren und einfach nicht darauf verzichten konnten.
Bis zu deinem fünften, sechsten, vielleicht sogar siebten Lebensjahr glaubtest du, human being werde wie human bean ausgesprochen. Es war dir ein Rätsel, warum die Menschen durch ein so kleines, gewöhnliches Gemüse repräsentiert werden sollten, aber nach einigen geistigen Verrenkungen glaubtest du dein Missverständnis ausgeräumt zu haben und nahmst an, gerade die Kleinheit der Bohne mache sie bedeutsam, da wir alle schließlich im Mutterleib nicht größer als Bohnen anfingen und die Bohne folglich das ideale, das treffendste Symbol für das Leben sei.
Der Gott, der überall war und über alles herrschte, war keine gütige oder liebende Macht, sondern eine des Schreckens. Gott war Schuldgefühl. Gott war der Chef der himmlischen Gedankenpolizei, der unsichtbare Allmächtige, der in deinen Kopf eindringen und deine Gedanken belauschen konnte, der dich mit dir selbst reden hören und die Stille in Worte übersetzen konnte. Gott sah immer zu, hörte immer zu, und folglich musstest du dich allezeit von deiner besten Seite zeigen. Wenn nicht, drohten entsetzliche Strafen, furchtbare Qualen, Gefangenschaft im finstersten Verlies, ein Leben bei Wasser und Brot bis ans Ende deiner Tage. Als du alt genug warst, zur Schule zu gehen, erfuhrst du, wie jeder Akt des Widerstands niedergeschlagen wurde. Du sahst deine Freunde mit List und Tücke die Regeln untergraben, hinter dem Rücken der Lehrer neue und immer abgefeimtere Missetaten aushecken und ein ums andere Mal damit davonkommen, wohingegen du, wann immer du der Versuchung nachgabst und an diesen Streichen teilnahmst, unweigerlich erwischt und bestraft wurdest. Garantiert. Kein Talent für Unfug, leider, dein zorniger Gott hatte nur höhnisches Gelächter für dich übrig, und so wurde dir klar, dass du brav sein musstest – sonst setzte es was.
Sechs Jahre alt. Ein Samstagmorgen in deinem Zimmer, du hast dich gerade angezogen und dir die Schuhe zugebunden (so ein großer Junge schon, so ein tüchtiger Junge), du bist bereit, nach unten zu gehen und den Tag zu beginnen, du stehst da im Licht des Frühlingsmorgens und empfindest nichts als reines Glück, ein ekstatisches, ungezügeltes Hochgefühl, und im nächsten Augenblick sagst du dir: Es gibt nichts Besseres, als sechs Jahre alt zu sein, sechs ist mit Abstand das beste Alter. Du erinnerst dich, das gedacht zu haben, so deutlich, wie du dich erinnerst, was vor drei Sekunden war, der Gedanke lodert noch neunundfünfzig Jahre nach diesem Morgen in dir, unvermindert in seiner Klarheit, so hell wie irgendeine andere der tausend oder Millionen oder zehn Millionen Erinnerungen, die du dir bewahren konntest. Was war da geschehen, was hatte dieses überwältigende Gefühl ausgelöst? Unmöglich zu wissen, aber du vermutest, es hatte mit der Geburt des Selbstbewusstseins zu tun, mit jener Erfahrung, die Kinder um das sechste Lebensjahr herum machen, wenn die innere Stimme erwacht und mit ihr das Vermögen, einen Gedanken zu denken und sich zu sagen, dass man diesen Gedanken denkt. Unser Leben tritt an dieser Stelle in eine neue Dimension ein, denn dies ist der Moment, in dem wir die Fähigkeit erwerben, uns selbst unsere Geschichten zu erzählen, die ununterbrochene Erzählung zu beginnen, die erst mit unserem Tod endet. Bis zu diesem Morgen warst du nur da. Jetzt wusstest du, dass du da warst. Du konntest darüber nachdenken, dass du am Leben warst, und sobald du das konntest, konntest du die Tatsache deiner Existenz in vollen Zügen genießen, oder anders ausgedrückt, du konntest dir sagen, wie gut es war, am Leben zu sein.
1953. Noch immer sechs Jahre alt, ein paar Tage oder Wochen nach jener überirdischen Erleuchtung, folgt ein weiterer Wendepunkt in deiner inneren Entwicklung, zu dem es in einem Filmtheater irgendwo in New Jersey kam. Bis dahin warst du erst zwei- oder dreimal im Kino gewesen, in Zeichentrickfilmen für Kinder (Pinocchio und Cinderella fallen dir ein), doch Filme mit richtigen Menschen kanntest du nur aus dem Fernsehen, hauptsächlich billige Western aus den Dreißigern und Vierzigern, Hopalong Cassidy, Gabby Hayes, Buster Crabbe und Al «Fuzzy» St. John, plumpe Ballerfilme, wo die Helden weiße Hüte und die Schurken schwarze Schnauzbärte trugen, Filme, an denen du großes Vergnügen hattest und an die du leidenschaftlich glaubtest. Und dann, irgendwann nach deinem sechsten Geburtstag, wurdest du – zweifellos von deinen Eltern, auch wenn du dich nicht daran erinnerst, dass sie dabei waren – in einen Film mitgenommen, der abends gezeigt wurde. Es war dein erstes Filmerlebnis, das keine Samstagsmatinee war, kein Disney-Zeichentrickfilm, kein verstaubter Schwarzweißwestern – sondern ein Film in Farbe und für Erwachsene produziert. Du erinnerst dich an die enorme Größe des überfüllten Saals, das unheimliche Gefühl, im Dunkeln zu sitzen, als das Licht ausging, eine Mischung aus Vorfreude und Unbehagen, als seist du zugleich da und nicht da, nicht mehr in deinem Körper, so wie man gefangen in einem Traum vor sich selbst verschwindet. Gezeigt wurde Krieg der Welten nach dem Roman von H.G. Wells, damals als bahnbrechend auf dem Gebiet der Spezialeffekte gefeiert – raffinierter, überzeugender, revolutionärer als alles, was bis dahin auf der Leinwand zu sehen war. So hast du es später gelesen, aber 1953 wusstest du davon nichts, da warst du bloß ein Sechsjähriger, der ein Heer von Marsmenschen die Erde erobern sah, und auf der größten aller großen Leinwände vor dir leuchteten die Farben intensiver als alle Farben, die du jemals gesehen hattest, so funkelnd, so klar, so grell, dass dir die Augen wehtaten. Steinrunde, metallisch glänzende Raumschiffe schwebten aus dem Nachthimmel herab, einer nach dem anderen klappten die Deckel dieser Flugmaschinen auf, und langsam stieg aus dem Innern ein Marsianer empor, ein übernatürlich großes, insektenhaftes Wesen mit dünnen Ärmchen und gruselig langen Fingern. Es richtete den Blick auf einen Erdling, fixierte ihn mit seinen grotesk vorquellenden Augen, und plötzlich flammte ein helles Licht auf. Sekunden danach war der Erdling verschwunden. Ausgelöscht, entmaterialisiert, nur mehr ein Schatten auf dem Erdboden, und dann schwand auch noch dieser Schatten, als sei dieser Mensch nie da gewesen, als habe er nie gelebt. Seltsamerweise erinnerst du dich nicht daran, Angst gehabt zu haben. Faszination, das bezeichnet vielleicht am ehesten, was du empfandest, heilige Scheu, als habe der Anblick dich in einen Zustand dumpfer Verzückung versetzt. Dann geschah etwas Schreckliches, etwas viel Schrecklicheres als der Tod oder die Auslöschung all der Soldaten, die versucht hatten, die Marsianer mit ihren nutzlosen Waffen zu töten. Vielleicht hatten diese Kämpfer sich geirrt, und die Invasoren waren gar nicht mit feindlichen Absichten gekommen; vielleicht verteidigten sich die Marsianer nur, wie alle anderen Lebewesen es tun, wenn sie angegriffen werden. Auf jeden Fall warst du bereit, im Zweifel zu ihren Gunsten zu entscheiden, denn es schien dir unrecht, dass die Menschen ihre Angst vor dem Unbekannten so schnell in Gewalt umschlagen ließen. Dann kam der Mann des Friedens. Er war der Vater der Hauptdarstellerin, der schönen jungen Freundin oder Frau des Hauptdarstellers, und dieser Vater war Pastor oder Pfarrer oder etwas Ähnliches, ein Mann Gottes, der den Umstehenden mit ruhiger, besänftigender Stimme riet, sich den Fremden in Freundschaft zu nähern, ihnen mit der Liebe zu Gott im Herzen zu begegnen. Mit gutem Beispiel schritt der tapfere Pastor-Vater, eine Bibel in der einen Hand und ein Kreuz in der anderen, auf eins der Raumschiffe zu und sagte den Marsianern, dass sie nichts zu fürchten hätten, dass wir Erdenbewohner mit allen im Universum in Eintracht leben wollten. Seine Lippen bebten vor Erregung, seine Augen leuchteten von der Kraft seines Glaubens, und als er nur noch wenige Schritte von dem Schiff entfernt war, tat sich die Klappe auf, ein stockdünner Marsianer erschien, und ehe der Pastor noch einen Schritt weiter machen konnte, flammte ein Blitz auf, und der Überbringer der frohen Botschaft war nur noch ein Schatten. Und gleich darauf nicht einmal mehr ein Schatten – restlos verschwunden. Gott, der Allmächtige, besaß keine Macht. Im Angesicht des Bösen war Gott so hilflos wie die hilflosesten Menschen, und jene, die an ihn glaubten, waren dem Untergang geweiht. Das war die Lektion, die dich der Krieg der Welten an jenem Abend lehrte. Ein Schock, von dem du dich nie mehr ganz erholt hast.
Andern verzeihen, andern immer verzeihen – aber nie dir selbst. Bitte und Danke sagen. Die Ellbogen nicht auf den Tisch stützen. Nicht angeben. Nie hinter jemandes Rücken etwas Unfreundliches über ihn sagen. Nicht vergessen, die schmutzigen Sachen in den Wäschekorb zu legen. Licht ausmachen, bevor du aus dem Zimmer gehst. Den Leuten in die Augen sehen, wenn du mit ihnen sprichst. Deinen Eltern nicht widersprechen. Die Hände mit Seife waschen und die Fingernägel schrubben. Nicht lügen, nicht stehlen, nicht deine kleine Schwester schlagen. Auf festen Händedruck achten. Um fünf zu Hause sein. Vor dem Schlafengehen die Zähne putzen. Und auf keinen Fall vergessen: nicht unter Leitern durchgehen, schwarze Katzen meiden und nie auf die Risse im Bürgersteig treten.
Du hast dich um die Unglücklichen gesorgt, die Unterdrückten, die Armen, und auch wenn du zu jung warst und nichts von Politik und Wirtschaft wissen konntest, nicht erfassen konntest, wie die Kräfte des Kapitalismus diejenigen erdrücken, die wenig oder nichts besitzen, brauchtest du nur den Kopf zu heben und dich umzuschauen, um zu erkennen, dass die Welt ungerecht war, dass manche Menschen mehr litten als andere, dass das Wort gleich in Wirklichkeit ein relativer Ausdruck war. Wahrscheinlich kam das von deinem früh erlangten Einblick in die von Schwarzen bewohnten Slums von Newark und Jersey City: die Freitagabende, an denen du mit deinem Vater die Runde machtest, wenn er bei seinen Mietern die Miete kassierte, der Junge aus der Mittelschicht, der die seltene Chance hatte, die Wohnungen der Armen und der hoffnungslos Armen zu betreten, die Umstände der Armut zu sehen, zu riechen, die müden Frauen und ihre Kinder, nur ab und zu mal ein Mann in Sicht, und weil die schwarzen Mieter deines Vaters immer außerordentlich nett zu dir waren, hast du dich gefragt, warum diese guten Leute so wenig zum Leben hatten, so viel weniger als du, du in deinem behaglichen Vorstadthaus und sie in ihren kahlen Zimmern mit kaputten oder gar keinen Möbeln. Für dich war das keine Frage der Rasse, damals jedenfalls nicht, denn du hast dich unter den schwarzen Mietern deines Vaters wohl gefühlt und dich nicht dafür interessiert, ob ihre Haut schwarz oder weiß war, nein, am Ende war es nur eine Frage des Geldes, nicht genug Geld zu haben, nicht die Art von Arbeit zu haben, die genug einbrachte, um in einem Haus wie unserem wohnen zu können. Später, als du ein wenig älter warst und anfingst, Bücher über die Geschichte Amerikas zu lesen, in einem Augenblick der Geschichte, der mit dem Aufkeimen der Bürgerrechtsbewegung zusammenfiel, konntest du wesentlich besser verstehen, was du als Kind mit sechs oder sieben gesehen hattest, aber damals, in den dunklen Tagen deines erwachenden Bewusstseins, hast du nichts verstanden. Zu manchen war das Leben freundlich, zu anderen grausam, und das tat dir im Innersten weh.
Es gab auch die hungernden Kinder in Indien. Das war abstrakter für dich, schwieriger zu begreifen, weil weiter weg und fremd, regte aber gleichwohl deine Phantasie mächtig an. Halbnackte Kinder, die nichts zu essen hatten; stockdünne Gliedmaßen, ohne Schuhe, gekleidet in Lumpen, irrten sie durch riesige übervölkerte Städte und bettelten um ein Stückchen Brot. So sahst du es vor dir, wenn deine Mutter von diesen Kindern sprach, was sie ausschließlich beim Essen tat; der Hinweis auf die armen unterernährten indischen Kinder war in den 1950ern gängiger Trick aller amerikanischen Mütter, die eigenen Kinder dazu zu bringen, ihren Teller leerzuessen, und wie oft hast du dir gewünscht, du könntest ein indisches Kind zu euch nach Hause zum Essen einladen, denn du selbst warst als Kind ein sehr wählerischer Esser, zweifellos Folge einer gestörten Verdauung, mit der du dich bis zum Alter von dreieinhalb oder vier zu plagen hattest, und manche Sachen bekamst du einfach nicht hinunter, dir wurde schon von ihrem Anblick schlecht, und jedes Mal, wenn du nicht aufessen konntest, was man dir hingestellt hatte, dachtest du voller Schuldgefühle an die Jungen und Mädchen in Indien.
Du kannst dich nicht erinnern, dass man dir vorgelesen hat, du kannst dich auch nicht erinnern, wie du lesen gelernt hast. Bestenfalls weißt du noch, wie du mit deiner Mutter über einige deiner Lieblingsfiguren gesprochen hast, Figuren aus Büchern, Büchern, die sie dir also vorgelesen haben muss, aber du hast keine Erinnerung daran, diese Bücher in der Hand gehalten zu haben, keine Erinnerung daran, neben deiner Mutter zu sitzen oder zu liegen, während sie auf die Bilder zeigte und die Geschichten vorlas. Du kannst ihre Stimme nicht hören, du kannst ihren Körper nicht neben deinem spüren. Wenn du dich sehr anstrengst, wenn du die Augen lange genug zumachst und dich in eine Art Halbtrance versetzt, kannst du immerhin einen Hauch der Wirkung heraufbeschwören, die gewisse Märchen auf dich ausübten, vor allem Hänsel und Gretel, was dir am meisten Angst machte, aber auch Rumpelstilzchen und Rapunzel, dazu ein paar vage Erinnerungen an Bilder von Dumbo, Pu dem Bären und einem kleinen Dalmatiner namens Peewee. Aber die Geschichte, die dich am meisten faszinierte, die du heute noch mehr oder weniger auswendig kennst, was bedeutet, dass sie dir viele Dutzend Mal vorgelesen worden sein muss, war Peter Hase, das Märchen vom armen übermütigen Peter, dem ungezogenen Sohn der alten Frau Hase, und seinen Missgeschicken in Herrn Gregersens Gemüsegarten. Während du jetzt in dem Buch herumblätterst, staunst du, wie vertraut es dir ist, jedes Detail jeder Zeichnung, fast jedes einzelne Wort der Erzählung, insbesondere die schaurigen Worte der alten Frau Hase auf Seite zwei: «‹Passt auf, meine Lieben›, sagte die alte Frau Hase eines Morgens, ‹ihr könnt aufs Feld gehen oder den Weg hinunter. Aber geht nicht in Herrn Gregersens Garten, wo eurem Vater das Unglück passiert ist. Frau Gregersen hat Fleischpastete aus ihm gemacht.›» Kein Wunder, dass die Geschichte eine solche Wirkung auf dich hatte. So charmant und idyllisch die Szenerie sein mag, Peter hat sich nicht zu einem unbeschwerten Nachmittagsspaziergang aufgemacht. Er schleicht sich in Herrn Gregersens Garten und riskiert damit wagemutig seinen Tod, riskiert einfältig seinen Tod, und während du das Buch jetzt genauer liest, kannst du dir vorstellen, wie sehr du um Peters Leben gefürchtet haben musst – und wie ungeheuer erleichtert du warst, dass er entkommen konnte. Eine Erinnerung, die keine Erinnerung ist und doch in dir weiterlebt. Als vor vierundzwanzig Jahren deine Tochter geboren wurde, bekam sie unter anderem eine Porzellantasse mit zwei Abbildungen aus Beatrix-Potter-Büchern geschenkt. Irgendwie hat diese Tasse die Gefahren ihrer Kindheit überlebt, und nun trinkst du seit fünfzehn Jahren morgens deinen Tee daraus. Nur noch ein Monat bis zu deinem fünfundsechzigsten Geburtstag, und jeden Morgen trinkst du aus einer Kindertasse, einer Peter-Hase-Tasse. Du sagst dir, du ziehst diese Tasse allen anderen im Haus vor, weil sie die perfekte Größe hat. Kleiner als ein Becher, größer als eine herkömmliche Teetasse, mit schön geschwungenem Rand, der sich angenehm an deine Lippen schmiegt und den Tee, ohne zu kleckern, in deinen Mund befördert. Eine praktische Tasse, eine unentbehrliche Tasse, dennoch wäre es nicht die Wahrheit, wenn du behaupten würdest, die Bilder darauf seien dir gleichgültig. Es macht dir Spaß, den Tag mit Peter Hase zu beginnen, mit deinem alten Freund aus frühester Kindheit, aus einer Zeit, die so fern ist, dass keine bewussten Erinnerungen damit verbunden sind, und dir graut vor dem Morgen, wo dir die Tasse aus der Hand gleiten und zerbrechen wird.
Irgendwann in der Pubertät hat deine Mutter dir erzählt, dass du bereits mit drei oder vier Jahren die Buchstaben des Alphabets unterscheiden konntest. Du weißt nicht, ob man dieser Behauptung glauben kann, da deine Mutter häufig übertrieb, wenn sie von deinen kindlichen Fertigkeiten sprach, und die Tatsache, dass du zu Beginn des ersten Schuljahres in die mittlere Lesegruppe kamst, scheint darauf hinzudeuten, dass du nicht so frühreif gewesen bist, wie deine Mutter sich einbildete. Da läuft Dick. Da läuft Jane. Du warst sechs Jahre alt, und in deiner lebhaftesten Erinnerung aus dieser Zeit sitzt du an einem Pult, das abseits von denen der anderen Kinder stand, einem Einzelpult ganz hinten im Klassenzimmer, wohin man dich wegen schlechten Betragens zeitweilig verbannt hatte (entweder hattest du, statt still zu sein, mit jemandem geschwätzt, oder es war eine der vielen Strafen, die dir dein mangelndes Talent für Unfug eingebracht hatte), und während du an deinem einsamen Pult in einem Buch blättertest, das in den 1920ern gedruckt worden sein musste (die Jungen auf den Zeichnungen trugen Kniebundhosen), kam die Lehrerin zu dir, Miss Dorsey oder Dorsi oder vielleicht Mrs. Dorsey oder Dorsi, eine freundliche junge Frau mit dicken, sommersprossigen Armen, und legte dir eine Hand auf die Schulter, eine sanfte, geradezu zärtliche Berührung, die dich erst überraschte, sich dann aber ganz wunderbar anfühlte, beugte sich herunter und flüsterte dir ins Ohr, sie sei mit deinen Fortschritten zufrieden, deine Leistungen hätten sich enorm gesteigert und deshalb habe sie beschlossen, dich in die obere Lesegruppe zu versetzen. Offenbar bist du also besser geworden. Welche Probleme auch immer du in den ersten Wochen des Schuljahres hattest, sie lagen jetzt hinter dir, und dennoch kannst du, wenn du die einzige andere deutliche Erinnerung aus jenen Tagen des Lesen- und Schreibenlernens heraufholst, im Grunde nur verblüfft den Kopf schütteln. Du weißt nicht, ob dieser Vorfall sich vor oder nach deiner Beförderung in die höchste Lesegruppe zutrug, aber du weißt noch genau, dass du an jenem Morgen ein wenig zu spät zur Schule kamst, weil du beim Arzt gewesen warst, und dass die erste Stunde bereits angefangen hatte. Du schlüpftest auf deinen angestammten Platz neben Malcolm Franklin, einen großen, schwergewichtigen Jungen mit außerordentlich breiten Schultern, der angeblich mit Benjamin Franklin verwandt war, ein Fakt oder Nichtfakt, der dich immer beeindruckt hat. Miss oder Mrs. Dorsey-Dorsi stand vorn an der Tafel und brachte der Klasse bei, wie man den Buchstaben w schreibt. Alle Jungen und Mädchen saßen mit einem Bleistift in der Hand über ihr Pult gebeugt, ahmten aufmerksam die Lehrerin nach und malten eine Reihe von w in ihr Heft. Als du nach links schautest, um zu sehen, wie Benjamin Franklins Verwandter die Aufgabe bewältigte, stelltest du belustigt fest, dass dein Klassenkamerad zwischen seinen w nicht absetzte und sie einzeln schrieb (w w w w), sondern alle miteinander verband (wwww). Der Anblick dieses verwegen verlängerten Buchstabens faszinierte dich, und obwohl du ganz genau wusstest, dass ein richtiges w nur vier Striche hat, befandest du auf der Stelle, dass Malcolms Version viel schöner sei, und statt die Aufgabe korrekt zu erledigen, hast du dich ans Beispiel deines Freundes gehalten, die Übung mutwillig sabotiert und damit ein für alle Mal und trotz aller bisherigen Fortschritte bewiesen, dass du immer noch ein Schwachkopf sondergleichen warst.
Es gab eine Zeit in deinem Leben, vielleicht vor sechs, vielleicht nach sechs – die Chronologie ist verschwommen –, da hast du geglaubt, das Alphabet enthalte zwei zusätzliche Buchstaben, zwei geheime Buchstaben, die nur dir allein bekannt seien. Ein seitenverkehrtes L: . Und ein auf dem Kopf stehendes A: .
Das Beste an deiner Grundschule, die vom Kindergarten bis zum Ende der sechsten Klasse dauerte, war, dass es niemals Hausaufgaben gab. Die Leiter der örtlichen Schulbehörde waren Anhänger von John Dewey, dem Philosophen, dessen liberale, humane Einstellung zur kindlichen Entwicklung die in Amerika herrschenden Lehrmethoden verändert hatte, und du warst ein Nutznießer von Deweys Lebensweisheit, ein Junge, der nach der letzten Klingel bis zum Abend tun und lassen konnte, was er wollte, mit Freunden spielen, nach Hause gehen und lesen, gar nichts tun. Du bist diesen namenlosen Herrschaften unendlich dankbar, dass sie deine Kindheit unversehrt gelassen und dich nicht mit sinnlosen Aufgaben überhäuft haben, dass sie so klug waren zu begreifen, dass Kindern nicht zu viel zugemutet werden darf, dass man sie auch einmal sich selbst überlassen muss. Sie haben bewiesen, dass alles, was zu lernen ist, auf dem Schulgelände gelernt werden kann, denn dir und deinen Klassenkameraden wurde unter diesem System eine gute Grundschulausbildung zuteil, und wenn die Lehrer vielleicht nicht immer die phantasievollsten waren, waren sie doch kompetent und brachten euch Lesen, Schreiben und Rechnen fürs ganze Leben bei, und wenn du an deine eigenen zwei Kinder denkst, die in einer, was die Pädagogik betraf, wirren und unruhigen Epoche aufwuchsen, erinnerst du dich daran, wie sie sich Abend für Abend mit zermürbenden, unerträglich langweiligen Hausaufgaben herumschlagen mussten, wobei sie nicht selten, um überhaupt fertig zu werden, die Hilfe ihrer Eltern brauchten, und ein Jahr ums andere hattest du, wenn sie mit hängenden Schultern dasaßen und die Augen kaum noch offen halten konnten, Mitleid mit ihnen und fandest es traurig, dass so viele Stunden ihres jungen Lebens einer zum Scheitern verurteilten Idee zum Opfer fielen.
Es gab nur wenige Bücher in deinem Haus. Die Schulbildung deiner Eltern war mit dem Abschluss der Highschool zu Ende gewesen, und beide hatten kein Interesse am Lesen. Jedoch gab es in deiner Stadt eine ordentliche Bücherei, und Woche für Woche gingst du hin, um zwei, drei oder vier Bücher auszuleihen. Mit acht fingst du an, Romane zu lesen, größtenteils mittelmäßige, Geschichten, wie sie in den frühen fünfziger Jahren für junge Leute geschrieben wurden, zahllose Bände der Hardy-Boys-Reihe zum Beispiel, die, wie du später erfuhrst, von einem Mann erfunden wurde, der in Maplewood lebte, deiner Nachbarstadt, am besten aber gefielen dir Romane, in denen es um Sport ging, insbesondere Clair Bees Chip-Hilton-Reihe mit den Highschool-Abenteuern des heldenhaften Chip und seines Freundes Biggie Cohen, die einen knappen Wettstreit nach dem anderen gewannen, Spiele, die immer durch einen Touchdown in letzter Sekunde, einen Korbwurf übers halbe Feld mit der Schlusssirene oder einen Homerun am Ende des elften Innings entschieden wurden. Du erinnerst dich auch an Flying Spikes, einen spannenden Roman über einen alternden, abgehalfterten ehemaligen Major-League-Spieler, der es in der Minor League noch einmal wissen will, und unzählige Sachbücher über deinen Lieblingssport, zum Beispiel My Greatest Day in Baseball und Bücher über Babe Ruth, Lou Gehrig, Jackie Robinson und den jungen Willie Mays. Fast ebenso viel Freude wie Romane vermittelten dir Biographien, die du mit leidenschaftlichem Interesse gelesen hast, besonders welche über Gestalten der fernen Vergangenheit, Abraham Lincoln, Jeanne d’Arc, Louis Pasteur und Benjamin Franklin, den auf vielen Feldern talentierten Vorfahren oder Nichtvorfahren deines ehemaligen Klassenkameraden. Landmark Books – auch an die erinnerst du dich gut, eure Grundschulbücherei war voll davon –, aber noch fesselnder waren die Bücher von Bobbs Merrill mit den orangefarbenen Einbänden, eine riesige Sammlung von Biographien, nüchtern illustriert mit scherenschnittartigen Silhouetten. Du hast Dutzende davon gelesen, wenn nicht Hunderte. Und dann das Buch, das die Mutter deiner Mutter dir geschenkt hatte und das bald zu deinem kostbarsten Besitz wurde, ein dicker Band mit dem Titel Of Courage and Valor (geschrieben von einem Autor namens Strong und erschienen 1955 bei der Hart Book Company), eine Sammlung von über fünfzig Kurzbiographien edler, tugendhafter Toter, unter anderem David (wie er Goliath besiegt), Königin Esther, Horatius an der Brücke, Androklus und der Löwe, Wilhelm Tell, John Smith und Pocahontas, Sir Walter Raleigh, Nathan Hale, Sacajawea, Simón Bolívar, Florence Nightingale, Harriet Tubman, Susan B. Anthony, Booker T. Washington und Emma Lazarus. Zum achten Geburtstag schenkte dir dieselbe heißgeliebte Großmutter eine vielbändige Ausgabe der Werke von Robert Louis Stevenson. Die Sprache von Entführt und Die Schatzinsel war zu schwierig für dich in diesem Alter (du erinnerst dich zum Beispiel, wie du bei der Lektüre über das Wort fatigue gestolpert bist und es fat-a-gew ausgesprochen hast), aber du kämpftest dich mannhaft durch das nicht so umfangreiche Dr. Jekyll und Mr. Hyde, auch wenn das meiste davon weit über deinen Verstand ging. Das viel einfachere Im Versgarten hingegen hast du geliebt, und weil du wusstest, dass Stevenson diese Gedichte als erwachsener Mann geschrieben hatte, beeindruckte es dich, wie geschickt und überzeugend er sich das ganze Buch hindurch der ersten Person bediente und so tat, als schreibe er aus dem Blickwinkel eines kleinen Kindes, und jetzt begreifst du plötzlich, dass dies dein erster Blick ins verborgene Räderwerk der literarischen Schöpfung war, jenen geheimnisvollen Prozess, der es einem ermöglicht, sich in die Gedankenwelt eines anderen zu versetzen. Im Jahr darauf hast du dein erstes Gedicht geschrieben, direkt inspiriert von Stevenson, denn er war der einzige Dichter, den du gelesen hattest, ein kläglicher Krümel getrockneten Nasenschleims, das mit einem Zweizeiler begann: Frühling ist hier/Jetzt jubeln wir! Den Rest hast du zum Glück vergessen, du weißt nur noch, welch ein Glücksgefühl dich durchströmte, während du das schlechteste Gedicht aller Zeiten schriebst, denn es war in der Tat Frühling, und als du allein über das frisch erwachende Gras im Grove Park gingst und die Wärme der Sonne auf deinem Gesicht spürtest, warst du überschwänglicher Stimmung und verspürtest das Bedürfnis, diesen Überschwang in Worte zu fassen, in Geschriebenes, das sich reimte. Ein Jammer, dass deine Reime so dürftig waren, aber egal, was damals zählte, war der Drang, der Versuch, das gesteigerte Gefühl deiner selbst, und wie tief du empfandest, dass du ein Teil der Welt um dich herum warst, während dein Bleistift übers Papier kroch und du deine elenden Verse von dir gabst. Im selben Frühling hast du dir zum ersten Mal im Leben ein Buch von deinem eigenen Geld gekauft. Du hattest schon seit Wochen oder Monaten ein Auge darauf geworfen, aber es dauerte eine Weile, das nötige Geld zusammenzusparen (3,95 Dollar, wie dir jetzt wieder einfällt), bis du schließlich die dicke Modern-Library-Ausgabe von Edgar Allan Poes sämtlichen Gedichten und Erzählungen nach Hause tragen konntest. Auch Poe war zu schwierig für dich, zu überladen und zu komplex für das Gehirn eines Neunjährigen, und so konntest du zwar nur einen kleinen Bruchteil davon verstehen, liebtest aber den Klang der Worte in deinem Kopf, die Dichtheit der Sprache, die exotische Düsternis, die Poes lange, barocke Sätze durchzog. Nach einem Jahr waren die meisten Schwierigkeiten verschwunden, und mit zehn machtest du deine nächste wichtige Entdeckung: Sherlock Holmes. Holmes und Watson, die teuren Gefährten deiner einsamen Stunden, jene eigenartige Paarung von trägem Menschenverstand und exzentrischem Genie, und so eifrig und aufmerksam du die Einzelheiten ihrer zahlreichen Fälle verfolgtest, entzückten dich doch am meisten ihre Gespräche, das erfrischende Hin und Her so verschiedener Geister, insbesondere ein bestimmter Wortwechsel verblüffte dich so sehr, warf alles, was man dich über die Welt zu denken gelehrt hatte, dermaßen über den Haufen, dass diese Offenbarung dich noch jahrelang beunruhigte und beschäftigte. Watson, der Pragmatiker und Wissenschaftler, erzählt Holmes vom Sonnensystem – von demselben Sonnensystem, das dir als Kind so große Verständnisschwierigkeiten gemacht hatte –, erklärt ihm, dass die Erde und die anderen Planeten in höchst geordneter Form um die Sonne kreisen, und Holmes, der arrogante und unberechenbare Alleswisser, erwidert prompt, er habe kein Interesse daran, derlei zu lernen, solches Wissen sei völlige Zeitverschwendung, er werde alles in seinen Kräften Stehende tun, zu vergessen, was er gerade gehört habe. Du warst ein zehnjähriger Viertklässler, als du diese Stelle gelesen hast, vielleicht auch ein elfjähriger Fünftklässler, und hattest bis dahin noch niemals irgendwen gegen das Lernen argumentieren hören, erst recht niemanden von Holmes’ Format, der als einer der größten Denker des Jahrhunderts galt und hier seinem Freund erklärt, es sei ihm gleichgültig. In deiner Welt erwartete man, dass nichts dir gleichgültig sei, dass du an allen Bereichen menschlichen Wissens Interesse zeigst, Mathematik ebenso wie Schönschreiben lernst, Musik ebenso wie Naturwissenschaften, und dein vielbewunderter Holmes sagte nein, manche Dinge seien wichtiger als andere und die unwichtigen Dinge sollte man wegwerfen und vergessen, da ihr einziger Zweck darin bestehe, einem den Kopf mit sinnlosen Nichtigkeiten zu verstopfen. Als du einige Jahre später das Interesse an Naturwissenschaften und Mathematik verlorst, musstest du an Holmes’ Worte denken – und benutztest sie, um dein mangelndes Interesse an diesen Gegenständen zu rechtfertigen. Zweifellos eine idiotische Haltung, aber du hast sie dir zu eigen gemacht. Vielleicht ein weiterer Beweis dafür, dass Literatur tatsächlich den Verstand vergiften kann.