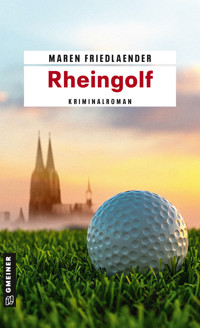Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kriminalromane im GMEINER-Verlag
- Sprache: Deutsch
Hauptstadt Berlin nach der Wiedervereinigung. Weibliche Groupies scharen sich um die Politgrößen. Macht macht sexy. Kanzler Uwe Henning, in dritter Ehe verheiratet, scheint besessen von einer Geliebten. Das beängstigt Hennings alten Weggefährten Peter Sengelhoff. Der Präsident des Verfassungsschutzes fürchtet, dass die geheimnisvolle Frau seinem Kanzler gefährlich werden kann. Was riskieren Politstars, um ihre Karrieren zu retten? Ein tiefer Blick ins Innere der jungen Berliner Republik.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 363
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Maren Friedlaender
Berlin.Macht.Männer.
Kriminalroman
Impressum
Bisherige Veröffentlichungen im Gmeiner-Verlag:
Rheingolf (2018)
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2019 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage 2019
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © cameris / fotolia
ISBN 978-3-8392-5918-4
Haftungsausschluss
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Der Kanzler
Der Kanzler verließ das Gebäude Unter den Linden, Ecke Wilhelmstraße in den frühen Morgenstunden. Als der Fahrer die Silhouette seines Chefs erblickte, sprang er aus dem dunkelblauen Mercedes, der direkt vor dem Haus parkte, mitten im absoluten Halteverbot. Der dezent im grauen Anzug gekleidete Chauffeur eilte um das Auto herum und riss die hintere Tür der Limousine auf. Die Sicherheitsleute stiegen indessen zur Straßenseite aus. Mit betont ruhigen Bewegungen checkten sie die Umgebung, wachsam auch zu dieser nächtlichen Zeit. Eine knappe Geste signalisierte dem Kanzler: »Wir haben alles im Griff«. Ob die Bodyguards mit dem ihnen eigenen nervösen Scannerblick wirklich Gefahren voraussahen, spielte keine Rolle. Auf die Wirkung kam es an.
Der Kanzler schien den Wirbel, den sein Erscheinen auslöste, kaum zu registrieren. Ein angedeutetes Kopfnicken zeigte, dass er die Leute, die sich für ihn die Nacht um die Ohren schlugen, überhaupt wahrnahm. Die Straße war fast menschenleer. Selbst Berlin Mitte kam in den Stunden nach Mitternacht zur Ruhe. So blieb dieser Auftritt der Nummer drei im Staat vom Volke unbemerkt. Dem Kanzler war es lieber so. Vorsichtshalber prüfte er die Lage auf beiden Seiten der Straße. Weiter entfernt, am Brandenburger Tor, lungerten ein paar Jugendliche herum. Gegenüber, vor dem Hotel »Adlon«, warteten zwei Taxen mit abgestelltem Motor. Kaum ein Auto war unterwegs. Hektische Betriebsamkeit nur für den Augenblick, in dem der Kanzler auf die Straße trat. Ein kurzer, lokal begrenzter Wirbelsturm, von dem allein der Fahrer und die Bodyguards, die fleischgewordenen Symbole seiner Macht, erfasst wurden. Wäre schön, diese Macht ausüben zu können, irgendwann mal wieder etwas tun, von dem man wirklich überzeugt war – der Gedanke blitzte für den Bruchteil einer Sekunde im führenden Kopf der deutschen Regierung auf. Er begrub ihn fast im selben Moment in den tieferen Schichten seines Unterbewusstseins.
Der Kanzler schloss den Mantel und wickelte den Schal um den Hals. Die Luft war frisch, aber nicht mehr winterlich kalt. Für einen Moment zögerte er, in seinen Wagen einzusteigen. Er wäre gern zu Fuß zum Kanzleramt hinüber gelaufen, entschied sich dann dagegen. Ein paar Leute trieben sich immer am Brandenburger Tor herum. Er hatte keine Lust, erkannt zu werden. Also rutschte er auf den Rücksitz des Wagens. Der Fahrer schloss die Tür, während die Bodyguards sich zu dem dahinter parkenden Auto begaben. Die beiden gepanzerten Limousinen fuhren im Konvoi davon.
Anastasia
Ana ging am 28. März. Sie ging, weil es Zeit war, und sie ging, weil sie mit ihm fertig war. Vielleicht auch, weil ihr Geburtstag bevorstand, der 50ste und sie sich eine kleine Freude gönnen wollte: Schadenfreude, warum denn nicht? 50 also nun. Merkwürdigerweise traf sie der Schock darüber unvorbereitet, aber das war nicht das eigentliche Problem. Die 50 waren nicht so arg. Sie war nicht mehr die Jüngste, sie hatte Falten. Morgens, wenn sie erwachte, schmerzte meist eine Stelle des Körpers.
»Wenn nichts mehr wehtut, bist du tot«, spottete ihre Freundin Irene.
»Sehr komisch!« Sie lachten sich kaputt. Mit manchen Frauen konnte man das Alter weglachen. Tauchte ein Mann auf, war das Thema tabu.
Über ihre Falten hatte sie sich nie große Gedanken gemacht. Irgendwie waren sie ihr lieb geworden. Ohne sie ginge es auch, überlegte sie. Für eine Frau sind die 50 kein gutes Alter. Man ist zu alt für lange Haare, zu alt für kurze Röcke, tiefe Ausschnitte und trägerlose Abendkleider. Zu alt für blonde Haare und zu jung für graue. Der Friseur half, der Arzt half, die Kosmetikerin half, aber sie alle kitteten Defekte nur oberflächlich. Eines Tages war sie aufgewacht: ihr ganzer Körper verspannt, die Gesichtsmuskeln verkrampft, die Zähne fest aufeinandergepresst, die Oberlippe wie mit einem Faden zusammengezogen. Schlagartig war ihr bewusst geworden, dass sie seit geraumer Zeit ihre Nächte so angespannt in die Kissen gedrückt verbrachte. Der Schlaf keine Erquickung mehr, sondern eine achtstündige Tortur im Dämmerland. Sie hatte Sorgen in dieser Zeit. Sie machte sich Sorgen. Seit einiger Zeit machte sie sich Sorgen um so ziemlich alles: um die Gifte in ihrem Essen; um die Mengen von Waffen in der Welt; um die Gesundheit ihrer Kinder; um den zunehmenden Verkehr und die Zerstörung ihrer Umwelt; um das Wasser, in dem sie schwamm und das Wasser, das sie trank; um die wachsende Aggressivität der Menschen; um die zunehmende Bürokratie; um die Schnüffler um sie herum, diese Blockwarttypen an allen Ecken; um die Hundekacke auf der Straße und um die Leute, die sich über die Hundekacke aufregten. Noch merkte sie, dass ihre Haltung verdächtig paranoide Züge zeigte, also machte sie sich auch Sorgen um ihre zunehmende Paranoia. Und, da sie gerade im Schwung war, um die paranoiden Tendenzen in der Gesellschaft. Dabei war Ana früher so sorglos gewesen. Irgendwann hatte sich diese schöne Sorglosigkeit verabschiedet. Wann war das passiert? Sie konnte sich an kein genaues Ereignis oder einen bestimmten Zeitpunkt erinnern. Die Sorglosigkeit hatte sich einfach auf leisen Sohlen davongemacht. Stattdessen hatten sich Falten eingeschlichen. Die Falten gehörten zu ihr. Sie gehörten ihr und ihrem Spiegelbild. Unvorstellbar, sie einfach wegzuoperieren, glatt zu ziehen, ihr und ihrem Spiegel zu stehlen, eigentlich nur dem Spiegel, denn sie selbst besäße sie noch. Schließlich gehen Falten tiefer, weit unter die Haut. Sie waren eingegraben in ihr Leben. Doch, die 50 gingen in Ordnung. Sie weigerte sich nur, den Regeln der Gesellschaft zu entsprechen, den Vorstellungen davon, wie eine 50-Jährige sich zu verhalten hatte. Eigentlich kratzte sie nicht mal, was die Leute dachten und sagten. Eher störten sie die Erwartungen, aber selbst damit ließ sich leben. Weglaufen konnte man vor all dem sowieso nicht. Das war auch nicht der Grund für ihren Entschluss zu gehen, eine spontane Entscheidung, wie es ihre Art war, spontan und ohne Reue. Das wusste sie schon jetzt, kannte sich gut in diesen Dingen – seit fast 50 Jahren.
Ana verschloss die Tür ihres Appartements. Sie freute sich am Zuschlagen der schweren Holztür. Sie hatte den Eindruck, dass die Tür laut zuknallte. Rums! Wieder ein Kapitel des Lebens abgeschlossen. Mit gewisser Freude, sogar Schadenfreude, drehte sie den Schlüssel herum. Sie hatte immer in Bildern gedacht, vertonten Bildern. Also hörte sie das Klacken des Schlosses viel lauter, als es eigentlich war, sah, wie ihre Hand den Schlüssel drehte, in dramatischer Großaufnahme.
Es war wirklich höchste Zeit, genau genommen eine längst überfällige Entscheidung. 100 Stunden in einem Bett mit ihm waren genug. Uwe Henning, Uwe, sie hatte ihn nie bei seinem Namen genannt. Wie sollte man im Augenblick der Ekstase »Uwe« schreien oder in Momenten der Zärtlichkeit »Uwe« flüstern? Einen Spitznamen hatte sie ihm nicht gegeben. 100 Stunden – das war so eine Schätzung. Sie hatte nicht Buch geführt. In Tagen oder Nächten konnte man ihr Zusammensein nicht berechnen. Es waren meist nur Stunden gewesen, manchmal halbe oder Minuten. Sie zog den Schlüssel aus dem Schloss. Ritsch! Dann ihr Abgang. Wie der Abgang eines Schauspielers von der Bühne – Szenenapplaus! Wohin mit dem Schlüssel? Sie hatte nicht einmal eine Handtasche bei sich. Sie konnte Handtaschen nicht leiden. Immer waren sie lästig: Beim Einkaufen störten sie, im Museum musste man sie abgeben, auf dem Bahnhof wurden sie gestohlen. Ihr Geld, Ausweis, Kreditkarten trug sie in der rechten hinteren Hosentasche. Mit Bargeld, Kreditkarten, Ausweis konnte man jederzeit überall hin. Das gab ihr das Gefühl von unendlicher Freiheit. Es war das vielleicht beste Privileg der Reichen, unschätzbar. Die Armen dachten immer, es seien die Villen, die großen Autos, die Jets, die Jachten. Das bedeutete alles nichts. Was zählte, war die Freiheit, die man durch Geld gewann. Alles andere nur Ballast, Klotz am Bein. Vom Ballast des Reichtums hatte sie lange die Nase voll. In ihrer Kindheit hatte sie genug darunter gelitten. Sie hatte sich bedrängt gefühlt, erdrückt von den Besitztümern ihrer Eltern, war zusammengebrochen unter der Last dieses riesigen Hausstands, wo jeder Umzug das Ausmaß eines Großmanövers annahm. Die Eltern störte das nicht, sie liebten ihre Dinge. Ana erinnerte sich an das Haus, in dem sie geboren wurde, eigentlich mehr ein Schlösschen. Wenn man es genau nahm, ein Schloss. Gemälde, Geschirr für 100 Personen, schwere Silberschüsseln, eine Bibliothek mit Tausenden von Bänden, kristallene Gläser und antike Sekretäre, schwere Vorhänge aus Brokat, Perserteppiche, Kandelaber und Lüster, bronzene Skulpturen, barocke Brunnen, Marmor und Gold, alles schwer, Ballast. Für die Übersiedlung nach Hamburg standen zehn Lastzüge vor der Tür. Ihren ersten eigenen Umzug machte Ana mit einem VW-Käfer. Welches Gefühl von Freiheit: sich heute entscheiden, wo man morgen wohnen will.
Den Schlüssel schob sie in die vordere Tasche ihrer Jeans. Schon als sie mit dem Fahrstuhl hinunter ins Erdgeschoss fuhr, drückte er dort. Sie trat hinaus auf die Straße Unter den Linden, ohne Plan, welche Richtung sie einschlagen sollte, wendete sich nach rechts zum Brandenburger Tor hin. Der Tiergarten erschien ihr verlockend. Es war ein warmer Tag. Frühling. Sie sehnte sich nach Grün. Der Schlüssel lag schwer wie Blei in ihrer Tasche. Sie zog ihn hervor, bückte sich und ließ ihn zwischen die Gitterstäbe eines Abflussschachts fallen. Das Plumpsen klang gut in ihren Ohren. Die Geste erschien ihr selbst ein wenig melodramatisch, aber sie fühlte sich danach erleichtert. Er hatte einen Schlüssel. Egal, es störte sie nicht. Ihr Entschluss stand fest, in diesem Moment fasste sie ihn. Sie würde das elegante Domizil Unter den Linden auflösen. Seine Rasiersachen konnte er sich dort herausholen, wenn er denn wollte. Viel mehr hatte er sowieso nicht bei ihr liegen: ein paar frische Hemden zum Wechseln, wenn er nach einem kurzen Zusammensein schnell zum nächsten Termin hetzen musste, einen zweiten Anzug, vielleicht, sie hatte keine Ahnung. Es stand ihm frei, alles abzuholen, wann immer er wollte. Irgendwann würde jemand das Schloss auswechseln, ein neuer Mieter. Es war ihre Wohnung – gewesen. Schon dachte sie in der Vergangenheitsform. 200 Quadratmeter gegenüber vom Hotel »Adlon« mit Blick auf das Brandenburger Tor. Es hatte ihm gefallen. »Meine Berliner Residenz« nannte er es. Seine Berliner Residenz – mit Mätresse. Das Arschloch. Ob er das wirklich glaubte? 200 Quadratmeter teure Eleganz. Kleine Leute messen solchen Dingen immer so viel Bedeutung zu, mehr als Menschen, die in eine Welt des Luxus hineingeboren wurden. Ihr hatte der Blick auf das Brandenburger Tor auch gefallen, irgendwie ganz nett, und die zentrale Lage, der Hauch der Geschichte, der nach der Wiedervereinigung an dieser Schnittstelle zwischen Ost und West wehte. Ach was, das mit dem Hauch war Quatsch. Wer spürt schon den Hauch der Geschichte? Solche Dinge stehen in Zeitungen, werden hinterher erfunden. Tatsächlich ging in den ersten Jahren nach dem Mauerfall in Berlin die Post ab: Es brodelte an allen Ecken der Stadt, Aufregendes entstand, also pflanzte sie sich mitten hinein in das Getümmel. Ihm bedeutete die Eleganz ihrer Adresse ungemein viel. Kein Wunder, schließlich war sein Umzug, ein paar Jahre zuvor, in ein Reihenhaus nach Hamburg-Othmarschen ein sozialer Aufstieg gewesen. Unter den Linden, allein der Gedanke, allein das Gefühl für die schicke Adresse versetzte ihn in Ekstase: der 100 Quadratmeter große Salon, der wilde Jackson Pollock an der Wand, ein Maler, den er zuvor gar nicht gekannt hatte. Leider nannte jemand in seiner Gegenwart den Preis für so einen Pollock. Vor ihm die Dächer des »Adlon«, rechts unter ihm das Brandenburger Tor, symbolträchtiger Bau für Eroberer und Potentaten, aber die demokratisch Gewählten hatten solche Machtdemonstrationen auch gern. Das Kanzleramt war nicht gerade eine bescheidene Hütte.
»Ein gutes Gefühl – auf Augenhöhe mit der Quadriga«, sagte er einmal und prostete den Pferden zu. Es sollte ein Witz sein, aber es klang anders. Von der Dachterrasse aus hätte er auf sein beschissenes Kanzleramt pissen können, aber das tat er nicht. Es bedeutete ihm zu viel, er hatte zu lange dafür gekämpft, seinen Hintern dort hineinzupflanzen. Es war sein Leben. Auf etwas, was einem wichtig ist, pinkelt man nicht. Dabei hätte er wirklich genug Grund gehabt, auf den ganzen verkommenen Laden zu pissen. Er verpasste die Chance. Nun würde ihre Tür für ihn bald verschlossen sein. Sein Pech! Und ihr Pech, wenn sie mehr von ihm erwartet hatte. Wie sollte ein Emporkömmling über die Macht scherzen, die er sich im Schweiße seines Angesichts und unter Aufopferung seiner Ideale erobert hatte? Unter Aufopferung seiner Ideale – das musste man zweimal sagen. Maria Stuart konnte die Krone verachten, sie war die im Kindesalter gesalbte Königin; Elisabeth, ein Bastard der Anna Boleyn, hatte ein Lebtag lang um ihr Königsrecht kämpfen müssen, das ist nicht zum Lachen, das ist ein beschissenes Gefühl. Es macht einen zu allem bereit. Bereit, Köpfe rollen zu lassen.
Sie setzte sich im Tiergarten auf eine Bank. Nur einen Steinwurf entfernt saß er jetzt in seinem Amt, das ihm zwei Nummern zu groß war, in seinem zwei Nummern zu großen Büro, machte einen Job, der ihm über den Kopf wuchs, lebte in einer Haut, die ihm langsam zwei Nummern zu groß geriet. Früher war er ein drahtiger, schlanker Mann gewesen. Mit den Jahren hatte er sich eine Fettschicht, einen Panzer angefressen, der ihn schützen sollte, sein dünner werdendes Nervenkostüm. Es war circa 11.00 Uhr. Die Sonnenstrahlen wärmten ihre Haut, über die seine Hände vor zehn Stunden gestreichelt hatten. Zärtlichkeit, Leidenschaft? Wohl mehr die Freude an einem Besitz. Besitz, sie musste lachen. Erfolgreiche Männer neigten dazu, sich zu überschätzen, besonders, was die Erfolge bei Frauen anging. Natürlich – Macht macht sexy. Ein Politiker mit einem nur halbwegs schillernden Amt konnte in Berlin manche Schönheit abschleppen. Die weiblichen Politgroupies lungerten in Scharen auf den Partys herum, aber Ana war mit der Macht aufgewachsen, der Macht des Geldes. Sie hatte den Sex-Appeal von Macht nie empfunden. Sie war in ihrer Familie schon lange eine Selbstverständlichkeit.
In der letzten Nacht hatte er sie aus dem Auto angerufen, von einer Sitzung kommend. Zehn Minuten später stand er in der Tür zu ihrem Schlafzimmer, in den Augen der Hunger nach Liebe oder eher nach Vergessen. Auf der Flucht vor der Lieblosigkeit seiner Welt stürzte er sich auf sie, nach Liebe verlangend, ohne sie selbst geben zu können. Seine Art zu vögeln langweilte sie am Ende, weil überwiegend er dabei vorkam. Zwischendurch hatte einmal sein Handy geklingelt. Danach beschleunigte er den Liebesakt.
»Entschuldige«, sagte er und überprüfte, von wem der Anruf kam. Sie ließ ihn gewähren und war ziemlich sicher, dass er ihr Gelangweiltsein nicht wahrnahm. Danach lag er mit geöffnetem Hemd und offener Hose neben ihr und bat sie um einen Drink. Er sah grauenvoll aus in seiner Erschöpftheit, die Haut so schlaff, eine ungesunde Rötung auf den Wangen, die auf einen zu hohen Blutdruck schließen ließ, die dunklen Ringe unter den Augen, die müde vor sich hin stierten und nicht einmal mehr durch den Orgasmus Glanz gewannen. Sie goss ihm einen Whisky ein, den er rasch hinunterstürzte, noch einen zweiten, mit dem er eine Tablette hinunterspülte – Herzrhythmusstörungen, zu hoher Cholesterinspiegel, Bluthochdruck? Wahrscheinlich alles zusammen. Es war ihr egal. Erschöpft schlief er ein. Sie betrachtete seine im Schlaf unruhig flackernden Augenlider, seinen dicklicher werdenden Bauch. Einmal stöhnte er kurz und gequält auf. Als er erwachte, schaute er als Erstes auf die Uhr, sprang aus dem Bett, knöpfte das Hemd zu, stopfte es in die Hose, zog den Reißverschluss der Hose zu, schloss den Gürtel. Sie sah das alles, während sie rauchend auf dem Bett lag. Zurückgelehnt in ihren Logensitz betrachtete sie seinen Abgang wie ein Schauspiel, sah den Hauptdarsteller, wie er die Krawatte knüpfte, zu hastig, sodass sie schief unter dem Kragen hing, wie er danach seine Jacke überstreifte, die Geliebte küsste, nur flüchtig auf die Stirn, ihr über die Wange strich, der Schlussakt, das war klar, die letzte Szene.
»Schlaf weiter und auf bald«, flüsterte er. Sie hatte gar nicht geschlafen. Dann verschwand er, kaum zwei Stunden nachdem er ihre Wohnung betreten hatte, verschwand von der Bühne.
Sie genoss für einige Zeit den Müßiggang im Tiergarten, beobachtete ein paar spielende Kinder, einen Schmetterling, zwei Hunde, die umeinander tobten. Sie dachte keine Sekunde darüber nach, was sie als Nächstes unternehmen würde.
»Haste mal ’n paar Piepen«, schnorrte sie ein Penner an.
Sie gab ihm alles Kleingeld, das sie in der Jackentasche fand.
»Bist ein Goldstück«, grinste er sie aus zahnlosem Mund an. Damit ist der Tag doch gerettet, freute sich Ana. Sie stand auf, als sie anfing zu frösteln, schlenderte ein wenig umher, kaufte eine Zeitung und frühstückte im Café »Einstein« – Milchkaffee und Croissants. Am Nebentisch saß ein Abgeordneter, den sie flüchtig kannte, ein Hinterbänkler. Sie erinnerte sich nicht einmal an seine Parteizugehörigkeit, eigentlich erinnerte sie sich nur an ihn wegen seiner großen fleischigen Ohren, die jetzt rot glühten, während er mit seinem Gegenüber debattierte.
»Überlassen Sie das nur mir«, hörte sie ihn flüstern. Aus dem Augenwinkel beobachtete sie, dass der Abgeordnete die Rechnung nicht bezahlte – sie bezahlten nie. Pack, dachte sie und hatte überhaupt kein schlechtes Gewissen deshalb. Ein wenig angeekelt wandte sie sich wieder ihrer Zeitung zu. Sie begann immer mit dem Kulturteil, das Erfreuliche am Anfang. Erst danach machte sie sich an das Aktuelle aus Politik und Wirtschaft. Ana hatte die Fähigkeit verloren, die neuesten Nachrichten mit Distanz oder Gelassenheit zu überschlagen. Sie nahm sich jede Schlagzeile zu Herzen, regte sich über jede negative Meldung auf, als habe man ihr persönlich eine Hiobsbotschaft überbracht.
»Opposition bezichtigt die Regierung der Rentenlüge« – Vor ein paar Jahren hatten sie doch selbst gelogen; es machte Ana wütend, dass man sie für so blöd hielt und erwartete, sie hätte das vergessen.
»Linke fordern mehr Respekt für Ostdeutsche« – Was hatte diese Partei überhaupt zu fordern? Einige ihrer Vertreter waren verantwortlich für einen Staat, in dem jeder Zehnte ein Spitzel war, stimmte das, jeder Zehnte? Egal, jeder Zehnte, jeder 20ste – alles vergessen und verziehen!
»Korruptionsaffäre um Müllverbrennungsanlage« – Eine Müllverbrennungsanlage, die keiner brauchte, war genehmigt worden von ein paar bestechlichen Beamten. Da gingen sie also hin, die Steuergelder! Auch das nahm sie persönlich, denn gegen jeden guten Rat zahlte sie Steuern in diesem Land. Sie nahm es deshalb persönlich, dass man nun von ihr forderte, sie solle endlich ihren Teil zum Gelingen des Projektes Deutschland beitragen: »Reichensteuer zumutbar!« Moment mal, war ihr da etwas entgangen, hatte sie bisher nicht über 60 Prozent ihres Einkommens brüderlich an die Solidargemeinschaft überwiesen: Mehrwertsteuer, Benzinsteuer, Kfz-Steuer, Alkohol- und Tabaksteuer, Grunderwerbs-, Erbschaftssteuer gar nicht eingerechnet?
Ana bestieg ein Taxi, ließ sich zum Bahnhof bringen, kaufte ein Zugticket nach Hamburg. Dort besaß sie ein Haus, ihr Zuhause seit Kindheitstagen, ihr Elternhaus, das sie nach dem Tod ihrer Eltern erbte und bewohnte, eine herrschaftliche Villa mit Blick auf die Alster, ein kleiner Palast, in dem auch ihre Kinder groß geworden waren, in dem sie ein paar glückliche Ehejahre verbracht hatte mit einem Ehemann, der nun nicht mehr ihr Ehemann war. In dem Haus geisterte nur noch ihre alte Tante herum, eine Schwester ihres Vaters, die eines Tages, als sie ihren südamerikanischen Macho-Mann nicht mehr ertrug, vor der Tür von Anas Eltern gestrandet war. Seither bewohnte sie einige Zimmer des weitläufigen Hauses. Manchmal verbrachte Ana ein paar Tage oder Wochen dort, bis sie die alten Geister heimsuchten. Sie saßen in den Winkeln des riesigen Kastens, obwohl Ana nach dem Tod ihrer Eltern den alten Kram hinausgeschmissen hatte, die alten Möbel und die wertvollen Teppiche, die Ölschinken und venezianischen Deckenleuchter, alles von erlesenem Geschmack. Ihre Vorfahren pflegten seit Generationen einen Sinn für das Schöne. Sotheby’s machte eine erfolgreiche Auktion mit dem teuren Krempel. Sie holte danach Licht und Farbe in das Haus, Bilder von wilder Schönheit, Skulpturen von wunderbarer Klarheit, die Darstellung einer Gottheit aus dem Kongo, selbst die vertrieb die Geister nur für eine gewisse Zeit. Sie nisteten sich wieder ein, gehegt und gefüttert mit den Geschichten der alten Tante, die nicht mehr wusste, welche Stunde es war, welcher Wochentag, welcher Monat, die aber jede kleinste Geschichte aus der Vergangenheit in ihrem Hirn gespeichert hielt. Leider lief dieser Speicher andauernd über, und wenn Ana sie besuchte, musste sie anhören, was sie gar nicht hören wollte.
»Weißt du noch, als die Sophie (das war Anas Mutter) Geburtstag hatte und der Ferdi (Anas Vater) die Wiener Philharmoniker engagierte, und der ganze Garten war erleuchtet mit Lampions, und sie spielten den ›Kaiserwalzer‹, und deine Mama und der Papa (die Betonung lag auf dem letzten ›a‹) haben den Tanz eröffnet. Sie trug ein schwarzes Kleid von Coco Chanel, schlicht und elegant. Sie war wirklich eine Schönheit und dein Vater der perfekte Gentleman. So etwas gibt es heutzutage gar nicht mehr. Die Frauen umschwärmten ihn, aber er wollte immer nur deine Mutter.«
Ana mochte das nicht wieder und wieder hören. Sollte die gute Tante doch glücklich werden mit ihren Gespenstern.
Peter Sengelhoff
»Das riecht nach Ärger«, grummelte Sengelhoff. »Verdammt, ich kann den Ärger riechen.« Er haute mit der flachen Hand auf den Schreibtisch. Der Präsident des Verfassungsschutzes saß in seinem Büro und dachte über das Gespräch nach, das er kurz zuvor mit seinem Freund geführt hatte. Sengelhoff und Uwe Henning waren alte Buddies aus Studienzeiten. Sie hatten sich auf dem Weg nach oben begleitet, sich gegenseitig gestützt und geholfen. Man konnte nicht mal sagen, dass sie sich wirklich mochten, früher vielleicht, aber jetzt war die alte Freundschaft eher zu einer Zweckgemeinschaft geworden. Sie wussten, was sie aneinander hatten. Der eine war der Brillantere, immer gewesen, ein großer Rhetoriker und wie die meisten begabten Rhetoriker ein großer Demagoge. In den wilden Jahren, in den Post-68ern, da hatten sie gemeinsam über Resolutionen gehangen, Pamphlete entworfen. Der Freund, der nun oben angelangt war, lieferte die genialen Ideen in großen Zügen, ausgeführt hatte sie Peter Sengelhoff, er war der Mann für die Kleinarbeit, für das Akribische, ins Detail versessen. Es war logisch, dass er nun Präsident des Bundesverfassungsschutzes war, wahrscheinlich die Endstation seiner Karriere – oder auch nicht? Sengelhoff machte sich keine Illusionen über sich selbst. Er war der Arbeiter, der Fleißige, penibel, korrekt, eher unscheinbar, immer zuverlässig. Immerhin, womöglich war noch ein Ministerstuhl drin, Innenminister – vielleicht. Er und der Kanzler ergänzten sich, damals wie heute. Anfangs waren sie eine Truppe von sieben Leuten gewesen, der engere Kreis, Außerparlamentarische Opposition, Sozialistischer Deutscher Studentenbund, Revolutionäre, jedenfalls dachten sie die Revolution. In den Köpfen spukte sie damals herum, aber so wirklich hatten sie nichts unternommen, ein paar Steine geworfen, Steinchen eher, Sitzstreiks, mal nach einem Polizisten getreten, aber nicht so kräftig, ein Schaufenster eingeschlagen und im Kaufhaus geklaut unter dem Motto »Schädigt die Kapitalisten!« und »Macht kaputt, was euch kaputtmacht!« Als sie beschlossen, den langen Marsch durch die Institutionen anzutreten, waren sie nur noch zu viert. Einer wechselte den Kurs, ging in die Wirtschaft und machte heute eine Menge Kohle. Einer wurde Anwalt, Wirtschaftsanwalt, verdiente wahrscheinlich auch eine Stange Geld. Einer hatte sie als Verräter beschimpft, als korrupte Schweine, war abgetaucht, hatte weiter in der linken Szene mitgemischt, wahrscheinlich als Unterstützer der Rote Armee Fraktion, kurz RAF, wurde aber nie geschnappt, lief bis heute mit langen Haaren und Hippieklamotten herum und versuchte es mit Wohngemeinschaften und alternativen Läden. Uwe Henning, Sengelhoff und zwei andere waren in die SPD eingetreten, hatten die Partei revolutionieren und verändern wollen, was teilweise gelungen war. Sie hatten bald Spaß am Erfolg und an der Macht bekommen, auch am Geld, das musste man zugeben, hatten sich gegenseitig gestützt und gefördert. Zwei waren auf der Strecke geblieben, letztlich abserviert von den eigenen alten Freunden, verloren beim Abseitsspiel. Ein gemeines Spiel, besonders, wenn man es gegen die eigenen Mannschaftskameraden einsetzte. Am Ende waren nur sie beide übrig geblieben: der eine, Uwe Henning, Kanzler; der andere, Peter Sengelhoff, oberster Verfassungsschützer. Er war Realist. Auch ihn würde Henning jederzeit fallen lassen, wenn er müsste, aber sein Job beim Verfassungsschutz gab Sengelhoff einen gewissen Rückhalt: Macht durch Wissen, das war seinem alten Kumpel klar. Sengelhoff wusste zu viel, und das war gut so. Die anderen zwei hatten Pech gehabt, damals im Hamburger Senat, verloren beim Abseitsspiel. Ursprünglich hatten sie die Abseitsfalle für die politische Opposition ersonnen, hatten sie anfangs, in der Studentenzeit, auch so eingesetzt. Man ließ die Gegner mit einer Idee vorpreschen, stimmte halbherzig zu, wartete die Reaktionen ab, und wenn die negativ ausfielen, zogen sie sich mit ihrer Truppe plötzlich zurück. Die Gegner standen im Abseits. Mit diesem Spiel versetzten sie mancher Idee und mancher Karriere den Todesstoß. In Hamburg sägten sie mit derselben Methode die eigenen Leute ab. Sengelhoff war Polizeichef, Henning Bildungssenator, einer von ihrer alten Truppe hatte es zum Innenminister gebracht mit Chancen auf das Amt des ersten Bürgermeisters. Henning, der immer der Wortführer ihrer Truppe war, empfand das als Bedrohung. Wenn einer Bürgermeister wurde, dann er.
»Abseitsspiel?«, hatte Uwe gefragt.
Sengelhoff hatte genickt. Er sah in Henning einfach den besseren Kandidaten, also unterstützte er ihn. Es war die Zeit der Hausbesetzungen. Die Regierung fuhr die weiche Taktik: Konfrontationen meiden, keine unschönen Räumungen mit hässlichen Bildern, keine Zusammenstöße, sondern Verhandlungen. Henning und Sengelhoff bestärkten den Innensenator in seiner Linie. Die Hausbesetzer wurden immer frecher, es bildeten sich rechtsfreie Zonen, eine Unterstützerszene für die RAF, Drogenmissbrauch und so weiter, aber der Innenminister bestand auf dem Kuschelkurs, wie es sich für einen 68er gehörte. Sengelhoff und Henning kamen im Vieraugengespräch überein, dass dieser Kurs nicht mehr haltbar sei. Er war den SPD-Wählern nicht zu vermitteln, dem Werftarbeiter, der jeden Morgen brav zur Arbeit ging. Also Abseitstaktik. Sie zogen sich gemeinsam und kurz entschlossen zurück von der Verhandlungslinie. Der Innenminister stand allein und machte jede Menge Fehler: beharrte auf den einmal eingeschlagenen Weg, beruhigte die Öffentlichkeit mit Parolen, die keiner mehr glaubte. Dann gab es eine Razzia, bei der das Ausmaß der illegalen Vorgänge in den besetzten Häusern erschreckend deutlich wurde. Der Innenminister musste gehen, mit ihm der Bürgermeister, der seinen Minister gewähren ließ. Uwe Henning wurde der Nachfolger als erster Bürgermeister und Sengelhoff sein Innenminister. Es war wie bei den zehn kleinen Negerlein. Nun waren sie nur noch zwei. Rücken an Rücken hatten sie sich bis nach Berlin durchgekämpft. Als Henning Kanzler wurde, machte er seinen alten Kumpel zum obersten Verfassungsschützer.
Sengelhoff kannte seinen alten Freund so gut wie einen Bruder. Henning hatte immer eine Schwäche für Frauen gehabt. Irgendwie hatte er da eine Macke, aber unter Männern redete man über solche Dinge nicht gern, und Sengelhoff war kein Psychologe, der Lust hatte, die Marotten seines Freundes zu analysieren. Zwar hatte er nie verstanden, warum jemand, der offensichtlich die Bestätigung von möglichst vielen und immer neuen Frauen brauchte, ganz versessen aufs Heiraten war, aber letztlich ging ihn Uwe Hennings Tick nichts an. Sengelhoff akzeptierte die Schwäche des Freundes und hielt ihm, so gut es ging, den Rücken frei. Beim Verfassungsschutz gab es allerdings seit Willy Brandts Zeiten eine verbreitete Neurose, was Kanzler und Frauengeschichten anging. Letztlich hatte das den Ausschlag für Brandts Rücktritt in der Guillaume-Affäre gegeben. Sengelhoff sah die Sache auf seine eigene Weise. Er war bis heute fest davon überzeugt, dass Günther Nollau, der damalige Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, seinen Hut hätte nehmen müssen, vielleicht auch Genscher als Innenminister oder Ehmke als Kanzleramtsminister. Es gab einen Spionageverdacht gegen Guillaume, trotzdem beließ man ihn in der direkten Umgebung des Kanzlers. Dessen einziges Vergehen war, dass er in dieser Angelegenheit dem Rat seiner Mitarbeiter vertraute. Brandt war kein Kostverächter gewesen, was Frauen anging. Als der Verdacht aufkam, Guillaume, ein DDR-Spion, habe ihm Frauen zugeführt, was Brandt immer als lächerlich abwies, da kochte die Affäre richtig hoch.
Und nun musste sich Sengelhoff mit Frauengeschichten herumschlagen. Selbstverständlich nahm er die Damen, mit denen der Kanzler in näheren Kontakt kam, unter die Lupe. Bei einem One-Night-Stand, wenn er davon überhaupt erfuhr, war das meist nicht nötig, aber wenn es sich um länger andauernde Verhältnisse handelte, hielt Henning ein Auge darauf. Der Kanzler konnte sich auf ihn verlassen, ohne dass sie ein Wort darüber verloren. Nun hatte Uwe Henning seinen alten Freund selbst um Hilfe gebeten.
Natürlich hatte Sengelhoff die neueste Affäre seines Kanzlers prophylaktisch durchleuchtet, ohne Verdachtsmomente zu finden. Sicher, die Dame reiste ziemlich in der Gegend herum, diese Gräfin Anastasia, nach Amerika, Russland, traf viele Leute, internationale Beziehungen, aber man musste sie eher bei den Jetset-Frauen einordnen. Die reisten nun mal viel. Ansonsten war alles in Ordnung. Beste Familie, Banker, feine Hamburger Adresse. Und da entging dem Verfassungsschützer ein Detail. Aber wie hätte er vermuten können, dass sein Freund Uwe Henning, der Arbeitersohn, waschechter Proletarier, damit hatte er damals zu Studentenzeiten immer kokettiert, dass dieser Uwe im feinen Hamburger Stadtteil Harvestehude in der eleganten Nachbarvilla seiner jetzigen Geliebten aufgewachsen war. Hätte Sengelhoff das gewusst, er hätte die Bitte des Kanzlers anders eingeschätzt. Henning verriet aber nichts von der gemeinsamen Vergangenheit mit der Frau. Als der Kanzler ihn um Beschattung seiner derzeitigen Geliebten bat, vermutete Sengelhoff, Henning hege ein Misstrauen, die Dame seines Herzens sei für einen Geheimdienst tätig. Er hatte ihn natürlich danach befragt.
»Hast du einen Hinweis, einen konkreten Verdacht?«
»Nein«, hatte Henning gesagt, »keinen konkreten Verdacht, manchmal so ein Gefühl, sie verheimlicht mir Sachen, – glaube ich.«
»Mann, Uwe, zeig’ mir eine Frau, die keine Geheimnisse hat.«
»Peter, tu mir den Gefallen«, hatte Henning gebeten. Es war keine Bitte, es war ein Befehl. Sengelhoff ordnete also eine Beschattung an. Was blieb ihm übrig. Aber es war ihm unwohl bei der Geschichte. Er wollte nicht zu viel Wirbel im eigenen Amt, reine Gefühlssache, also hatte er einen privaten Ermittler beauftragt. Für solche Fälle gab es einen Sonderetat. Er engagierte den Besten, einen Mann fürs Grobe, dem er vertraute und der ihm direkt berichten musste.
Anastasia
Sie ging zum Schalter und tauschte ihre Fahrkarte nach Hamburg gegen ein Ticket nach München. In der Bahnhofsbuchhandlung kaufte sie sich ein Buch, einen Krimi, er tat seinen Zweck. Sie wollte möglichst unansprechbar wirken, vertieft in ihre Lektüre. Sie genoss die Fahrt im Zug, das Unerreichbarsein. In ihrer Jackentasche steckte ein Handy, aber sie hatte es abgeschaltet. Ana ging in den Speisewagen, aß ein Sandwich, trank einen Kaffee, ganz entspannt. Sie musste nicht einmal Angst um im Abteil zurückgelassenes Gepäck haben, sie hatte kein Gepäck. Man trug genug Ballast mit sich herum. Einmal sprach ein Mann sie an, ein Geschäftsreisender im grauen Anzug. Sie antwortete nur kurz, ziemlich unhöflich, blickte feindselig. Der andere graue Anzug war ihr in zu frischer Erinnerung.
Immer war er korrekt angezogen gewesen, etwas too much. Sein Äußeres sah stets nach der Empfehlung eines übertüchtigen Herrenausstatters aus, dem er sich aus Unsicherheit in die Hände gegeben hatte: das Tüchlein in der Brusttasche passend zur Krawatte, die Krawatte ein Tick zu modisch – der Geschmack des gewandten Verkäufers, die Socken ein wenig zu kurz, sodass bei ungeschicktem Sitzen das blasse, behaarte Bein hervorschaute, was der Verkäufer übersehen hatte. Oder es war ihm nicht bekannt, dass ein Herr kein Bein zeigte, ein Vergehen, das ihr Vater zumindest mit einem niederschmetternden Blick geahndet hätte. Stil erlernt man nicht in ein paar Jahren, nicht mal in einer Generation. Was Stil ist, entscheidet nicht ein Haufen von Emporkömmlingen, die sich in den Schaltzentren der Macht eingenistet haben. Sie mögen über Krieg und Frieden beschließen und über Reformen am Arbeitsmarkt und die Verteilung von Geldern, aber nicht über Stil. Das haben sie nicht geschafft. Über den Stil wachen ein paar alte, degenerierte Aristokraten. Den Stil bestimmen wir, dachte sie, und wir lachen uns kaputt über die Nouveaux riches, die Parvenüs und die tapferen Volksvertreter, die wir mit einem üppigen Abendessen in unseren stilvollen Villen blenden, mit einem alten Rotwein und einer dicken Zigarre einlullen, um sie mit ein paar wohlgesetzten Worten zu korrumpieren. Das ist vielleicht ungerecht, aber es ist so. Ich kann es nicht ändern, und ich will es gar nicht. Ich lache eben auch, wieso nicht, vielleicht ist es unser letzter Triumph, bevor sie uns niedermachen mit ihren »Guten Appetit«- und »Gesundheit«-Rufen, mit ihren Gummibäumen und ihrem »Steak Hawaii«, den Sandalen, Tischläufern und Kissen mit Eselsohren, dem Barmbeker Barock und den im Häkellook verkleideten Klopapierrollen, die man durch die Heckscheiben auf den Hutablagen ihrer Autos liegen sieht.
Sie nahm den Krimi, den sie gerade gekauft hatte, zur Hand. Plötzlich fiel ihr Blick auf das Goldarmband an ihrem Handgelenk. Es war schwer. Er hatte es ihr vor ein paar Wochen geschenkt, hatte es ihr selbst um den Arm gelegt. Als er den Riegel schloss, schauerte es sie ein wenig. Als wenn er mich an die Kette legt, dachte sie, und dann sagte er tatsächlich:
»Damit du mir nicht wegläufst.«
Er lachte dabei, aber es klang trotzdem nicht wie ein Scherz.
»Bitte trag es immer«, bat er sie innig. »Es ist dann, als ob ich ein bisschen bei dir bin.«
Sie litt seit Kindheitstagen unter dem Gefühl, sie müsse Geschenke besonders ehren, weil sie so reich war. Es war die Angst, andere zu kränken. Nun wollte sie das Armband loswerden, es wog so schwer. Sie versuchte den Verschluss zu öffnen. Sie drückte und zerrte daran herum, versuchte, es über den Arm zu streifen, aber es gelang ihr nicht, das Ding zu lösen.
An der nächsten Station stieg ein jugendlicher Freak ein: weite Beuteljeans, deren Schritt zwischen den Knien hing, über dem Hosenbund schaute eine rote Boxershorts mit Che-Guevara-Porträt heraus. Der Junge ließ sich in den Sitz ihr gegenüber plumpsen, fuhr die Beine auf volle Länge aus, sodass sie unter Anas Nebensitz verschwanden. »Turn me on«, forderte die Aufschrift auf seinem Sweatshirt von der Mitwelt. Der Typ hatte sich offensichtlich in die Erste Klasse verirrt. Er störte sie weniger als der graue Anzug. Der Freak schloss die Augen und wippte mit dem ganzen Körper zu den Rhythmen, die er sich über Kopfhörer auf die Ohren dröhnen ließ. Ab und zu sang er eine Halbzeile mit, das störte sie schon mehr. Er sang schlecht. Sie wartete geduldig, bis der Schaffner kam und den Kampf mit ihm aufnehmen würde. Das Gezappel zu der Musik, die sie nicht hören konnte, fing an zu nerven. Diese ganze Generation zappelte andauernd herum. Ihre Söhne waren genauso. Immer wippte ein Fuß, immer hämmerte eine Hand auf der Tischplatte herum. Komisch, dass sie wieder lange Haare trugen. Sie standen ihrem Gegenüber wirr vom Kopf ab, eine künstlich hergestellte Unordnung, die vielleicht bei einem teuren Friseur entstanden war. Die Jugendlichen von heute ließen sich ihre Zerlumptheit etwas kosten. Eine Jeans mit fabrikgefertigten Rissen kam teuer. Das war der Unterschied zu den 60ern und 70ern. Die waren echt verschlampt gewesen, trugen ihre Sachen selbst ab, Haare waren verfilzt, weil sie nicht gewaschen und gekämmt wurden und nicht, weil ein Starfriseur sich daran zu schaffen gemacht hatte. Dreck und Unordnung waren Protest gegen das Establishment, nicht Styling. Für solchen Luxus hatten sie in den 60ern kein Geld gehabt. Was war das heute? Sie schaute sich den Jungen genau an. Das wilde Aussehen, vielleicht immer noch Protest gegen die Eltern, aber nun auf Kosten und sogar mit dem Segen der Eltern – irgendwie zum Kotzen. »Du weißt doch gar nicht, was cool ist«, sagt ein Junge zu seiner Mutter. »Und ob«, sagt sie. »In teuren Klamotten so aussehen, als sei man arm, behindert und hätte gerade eingekackt.« Diese Karikatur kam ihr beim Anblick des Jungen in den Sinn.
Ein Mittvierziger setzte sich in einem schlecht sitzenden Anzug auf den freien Platz neben ihr. Aus seinem Aktenkoffer holte er ein Manuskript, das er sorgfältig durcharbeitete, indem er mit Kugelschreiber Notizen an den Rand schrieb. Ana riskierte einen Blick und las die in fetten Buchstaben gedruckte Überschrift:
»Weitere Einflussfaktoren auf den Drahtwurmbefall«
Was war ein Drahtwurm? Mit einem vorsichtigen Blick aus den Augenwinkeln musterte sie das blasse, bebrillte Gesicht des Mannes. Dann war die Frage beantwortet. Ein Drahtwurm, dachte sie und nahm ihren Krimi zur Hand – ein echtes Scheißbuch, das merkte sie nach ein paar Seiten. Es wurde so viel Mist gedruckt. Wenn man bedachte, mit welcher Mühe und welchem Aufwand die ersten Bücher entstanden und wie kostbar einst der Besitz eines Buches war, wie glücklich sich jemand geschätzt haben musste, ein Buch lesen zu dürfen, dann war es einfach zum Verzweifeln, welche Scheiße es mittlerweile wert war, gedruckt zu werden. Jeder Depp veröffentlichte seine Memoiren, jeder Politiker hielt seine Gedanken für wichtig genug, um sie der Menschheit in Buchform zu präsentieren. Natürlich hatte auch er ein Buch geschrieben oder schreiben lassen. »Mein Weg« hatte es geheißen oder so ähnlich. Selbstverständlich hatte sie es nicht gelesen. Sie wusste mehr von seinem Weg, als er in diesem Buch zugeben würde. Natürlich hatte er sie begierig nach ihrer Meinung gefragt:
»Wie hat dir mein Buch gefallen?«
»Ich kann nichts Negatives sagen, da ich es nicht gelesen habe«, antwortete sie und erntete für die Bemerkung ein beleidigtes Gesicht.
»Es ist kränkend, dass du dich nicht für meine Dinge interessierst«, beschwerte er sich.
»Warum sollte ich es lesen? Du glaubst doch nicht im Ernst, dass dein Leben tatsächlich von übergeordnetem Interesse ist. Sag mir einen Grund, warum ich es lesen sollte.«
»Meine Generation, wir haben in diesem Land etwas verändert.«
Er war in der Studentenbewegung ganz groß herausgekommen. Da hatte sie ihn zum ersten Mal seit den gemeinsamen Kindheitstagen wieder gesehen, im Fernsehen, bei einer großen Protestkundgebung riss er die Klappe auf. Beinahe hätte sie ihn nicht erkannt mit seinen langen Haaren, dem Bart, der das Gesicht überwucherte. Schreiend, mit erhobener Faust wütete er gegen die Imperialisten, gegen die Faschisten und Kapitalisten, sein Gerede völlig unverständlich, voll von Ismen. Der Hass verzerrte sein Gesicht. Sie wusste, welcher Hass ihn trieb. Schließlich hatte sie ihn gekannt, als er ein kleiner Junge war. Trotzdem war es seine beste Zeit gewesen, die 70er Jahre. Sein Weg verständlich, konsequent, wenn man seine Kindheit betrachtete. Auch die paar Steine, die er geschmissen hatte, durchaus nachvollziehbar. Ana fürchtete nur, er hatte sich für Kieselsteinchen entschieden, von Anfang an. Er hatte sich immer verschiedene Optionen offen gehalten.
Der Schaffner verlangte den Fahrschein des Jungen. Folgsam zog der sein Ticket hervor:
»Zweiter Klasse!«, registrierte der Kontrolleur.
»Ach so, ist das die Erste hier?« Der Junge wurde rot, stand auf und verzog sich ohne Protest – braves Kind. Ein Irrtum, kein Aufstand gegen das Klassensystem. Schade. Ana hatte sich mehr Vorstellung erwartet. Da zog er hin, in seiner luxuriösen Schlampigkeit.
Sie schaute aus dem Fenster auf den schönen deutschen Wald, der im Sonnenlicht nett anzuschauen war. Nett, die sauberen Häuschen. Ob die Leute darin nett waren, mochte sie nicht beurteilen. 30 Jahre zuvor hätte sie die Frage vielleicht mit einem »Ja« beantwortet. Heute traute sie den Menschen nicht mehr. Im Grunde hausten in diesen hübschen Häuschen kleine Monster. Sie mussten nur geweckt werden. Eine Kleinigkeit reichte. Ein paar Türken zu viel im Land, der Job in Gefahr, das Auto des Nachbarn größer als das eigene. Was wusste sie – sie hatte Armut nie gekannt, keine Ahnung, was sie aus Menschen machte. Trotzdem – sie misstraute der Idylle, jeder Idylle. Nicht aus Pessimismus, sondern aus Erfahrung.
An der nächsten Station stiegen zwei Polizisten mit einem Schäferhund ein. Sie musterten die Passagiere, als suchten sie nach jemandem. Ana fühlte sich unwohl. Sie traute ihm einiges zu. Vielleicht mobilisierte er den Bundesgrenzschutz, Bundeskriminalamt, Bundesnachrichtendienst, Staatssicherheit – ach, die gab es ja nicht mehr, offiziell jedenfalls nicht, also einfach irgendwelche Bullen. Keine Ahnung, die Macht hatte er. Er war nicht der Typ, der sich seinen Besitz nehmen ließ, nicht mehr. Vielleicht litt sie unter Paranoia, aber sie hatte das alles schon erlebt. Ihr erster Mann verfolgte sie, als sie ihn verließ – mit Privatdetektiven, mit nächtlichen Anrufen, mit fiesen Typen, die wie Zuhälter aussahen. Für ein paar Monate heuerte ihr Vater zwei Bodyguards für sie an. Manche Männer betrachten Frauen als Besitz. Wieso wurde gerade sie immer wieder von solchen Kerlen heimgesucht? Natürlich kannte sie den Grund. Ihre Unabhängigkeit reizte gewisse Männer bis aufs Blut, auch wenn der Zorn nicht bei jedem solche Ausmaße annahm wie bei ihrem Ehemann. Er geriet derartig in Wut, dass er eines Tages mit einem Herzinfarkt über einem Kräuterlammrücken zusammenbrach. Er hatte sie in ein Restaurant verfolgt, in dem sie mit einem Freund aß. Sie wusste nicht, ob ihr Ex-Mann damals kein Geld mehr für die teuren Spitzel hatte, oder ob er den Spitzeln nicht mehr traute, auf jeden Fall kümmerte er sich eines Tages selbst um die Beobachtung. Im Pariser Restaurant »La Coupole« nahm er einen kleinen Ecktisch ein und ließ Ana und ihren Begleiter nicht mehr aus den Augen. Sie tat, als ob sie ihn nicht bemerkte, und flirtete mit dem Freund, der tatsächlich nur ein netter alter Bekannter war, schwul zudem. Sie dort flirtend sitzen zu sehen, ging ihrem Verflossenen so nah, dass er auf der Tischplatte zusammenbrach. Als Grund vermutete man eine Austernvergiftung; er hatte Austern als Vorspeise mehr in sich hineingestopft, als genossen. Ein Krankenwagen brachte ihn mit Blaulicht in die »Charité«, aber jede Hilfe kam zu spät, da es sich eben nicht um eine Austernvergiftung handelte, sondern um einen Herzinfarkt. Ana wusste nicht, ob sie ihn beneiden oder bedauern sollte. Einerseits war er beim Genuss eines köstlichen Mahls gestorben, was wollte man mehr; andererseits musste ihn im Moment des Todes bohrender Hass gegen seine Ex-Frau gequält haben. Anstandshalber übernahm sie seine Rechnung: eine Flasche Chablis, die Austern und den Lammrücken, obwohl er ihn nur halb aufgegessen hatte, dazu ein königliches Trinkgeld für die Unannehmlichkeiten, die ihr hinscheidender Ex-Mann dem Restaurant bereitet hatte. Der Kellner betonte mit traurigem Gesicht, die Austern seien frisch gewesen, was sie ihm glaubte. Sie selbst hatte sie an diesem Abend verzehrt, sie waren vorzüglich gewesen.
Die Beerdigung fand in Hamburg statt. Sie nahm natürlich teil – wegen der Kinder, aber ohne zu behaupten, dass sie sehr trauerte. Sie spendete keinen Kranz. Sie konnte diese Kränze nicht leiden und was sollte sie auf das kleine Fähnchen schreiben? »In stiller Verbundenheit«, »In alter Treue«, »Ein letzter Gruß«? Im Grunde war sie froh, sich nun nicht mehr nach möglichen Verfolgern umdrehen zu müssen. Die Bodyguards entließ sie. Ana atmete auf.
Noch einmal musterte sie die zwei Polizisten im Zug und beschloss, vorerst nicht misstrauisch zu sein, denn er konnte ja von ihrem Weggang nichts wissen. Sie spürte das Geldbündel in ihrer Gesäßtasche. Da saß sie, ihre Unabhängigkeit, dick und stark. Was für ein wohltuendes Gefühl.
*