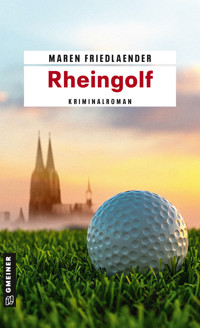Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Romane im GMEINER-Verlag
- Sprache: Deutsch
Dies ist die Geschichte von Ariel, dem Löwen Gottes. Und es ist die Geschichte einer großen Liebe, die eine Zuhörerin braucht. Der im Jahr 1939 geborene jüdische Junge Ariel vagabundiert mit seinen wohlhabenden Eltern durch die Welt, während die Nazis in Deutschland morden. Ariels Vater stirbt bei seinem Einsatz für den britischen Geheimdienst. Der Sohn wird zum Nazi-Jäger, zum Rächer. Er ist der Löwe Gottes. Dies ist die Geschichte von Vergangenheit, die nie vergeht - und einer großen Liebe.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 166
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Maren Friedlaender
Der Löwe Gottes
Roman
Zum Buch
Von Liebe, Schuld und Sühne Dies ist die Geschichte von Ariel, dem Löwen Gottes. Und es ist die Geschichte einer großen Liebe, die eine Zuhörerin braucht.
Sie irrt deprimiert im Kaufhaus umher und sucht einen Lippenstift, einen Farbtupfer für ihr trauriges Gesicht. Da sieht sie Ariel. Sie folgt seinem Wunsch, ihm zuzuhören. Ariel erzählt ihr seine Geschichte, die eines 1939 geborenen jüdischen Jungen, dessen wohlhabende Eltern mit dem Kind durch die Welt vagabundieren, während die Nazis in Deutschland morden. Der Vater, ein deutscher Jude, heiratet eine Äthiopierin. Kein guter Zeitpunkt für die zwei jungen Liebenden. Ariels Vater will nicht mehr Opfer sein, stirbt bei seinem Einsatz für den britischen Geheimdienst und wird zum Helden. Den Sohn Ariel holt die Geschichte ein. Er wird zum Nazi-Jäger, zum Rächer. Ein Versprechen, das er seinem Großvater gibt, zwingt ihn zu einem letzten mörderischen Auftrag.
Dies ist die Geschichte von Vergangenheit, die nie vergeht.
Maren Friedlaender, in Kiel geboren. Journalistin beim ZDF, Studium der Psychologie, Kommunalpolitikerin. Mit dem Fahrrad erobert sie ihre Wohnorte: Hamburg, Wiesbaden, Berlin, Köln. Die Entdeckung der Städte durch das Unterwegssein in verschiedenen Welten: schreibend, aber auch aktiv in der Politik; für einige Jahre Mitglied des Kölner Kulturausschusses. In dem Roman »Der Löwe Gottes« verarbeitet sie das Schicksal der Emigration ihrer jüdischen Familie, die während der Nazi-Zeit und des Krieges in Liechtenstein ausharrte und sich danach für ein vereintes Europa engagierte. Es sind die in Jahrzehnten am Familientisch ausgetauschten Geschichten, die sich in der jetzt vorliegenden fiktiven Erzählung niederschlugen.
Bisherige Veröffentlichungen im Gmeiner-Verlag:
Die Macht am Rhein (2019)
Berlin.Macht.Männer (2019)
Rheingolf (2018)
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2020 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage 2020
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung: Julia Franze
E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © tcerben / photocase.de
Druck: GGP Media GmbH, Pößneck
Printed in Germany
ISBN 978-3-8392-6350-1
I.
Ich suchte nach einem Lippenstift. Normalerweise kann ich Lippenstifte nicht leiden. Ich mag nicht den schmierigen Abdruck, den sie auf Glasrändern hinterlassen. Ich mag nicht küssen mit diesem synthetisch-öligen Geschmack. Lippen sind ein sensibles Organ, das man nicht mit Künstlichem verstören sollte. Ich mag auch nicht, wenn das Rot auf die Zähne abfärbt. Es ekelt mich, wenn ich es bei anderen Frauen sehe und mehr noch bei mir selbst. Aber ich war deprimiert und dachte, ein roter Farbtupfer mitten in meinem Gesicht würde mich vielleicht aufmuntern. Ich schlenderte unentschlossen durch die Parfumabteilung des Kaufhauses. Über den Ständen hing eine Wolke von Düften. Wer konnte noch unterscheiden, welcher zu Dior, welcher zu Chanel oder Hermès gehörte? Ich mag Parfums nicht sehr. Ich habe einen feinen Geruchssinn. An ihrem natürlichen Duft erkenne ich die Menschen.
Die Verkäuferinnen sahen aus, als ob sie die gesamte Palette der von ihnen vertretenen Produkte auf ihren Gesichtern zur Schau stellten. Ich konnte nichts Menschliches hinter ihren Masken erkennen und traute mich nicht, eine anzusprechen. Ich mied ihre Blicke, damit sie nicht mich ansprachen. Mittlerweile war ich zur Flucht entschlossen. Da erbarmte sich eine, vielleicht musste sie noch etwas für ihren Umsatz tun.
»Kann ich Ihnen weiterhelfen?«
Sie schaute missbilligend auf mein ungeschminktes Gesicht.
»Ich suche einen Lippenstift.«
Sie bat mich an ihren Stand. Dort steckten in einem Display ungefähr 30 Testexemplare, 30 Farben, von hellrosa bis dunkellila. Ich wollte keinen Lippenstift, ich wollte nach Hause. Ich würde auch so mit meiner Depression fertig werden.
Die Verkäuferin nahm mehrere der Stifte aus ihrer Musterkollektion und zog mit jedem einen kurzen Strich auf ihrem Handrücken. Der Anblick ihrer blassrosa Haut mit den dicken, tiefen Poren stieß mich ab. Wahrscheinlich enthaarte sie sich täglich. Berufsbedingt. Sie war eher der haarige Typ, aber kein noch so kleines Härchen auf dem Arm.
»An welche Farbe haben Sie gedacht?«
»Äh, rot …?!«
Wieder dieser niederschmetternde Blick.
»Natürlich rot!«, lächelte sie nachsichtig mit ihrem grell geschminkten Mund. Einen solchen Mund wollte ich keinesfalls.
Ich zeigte wahllos auf irgendeinen Strich auf ihrer Hand.
»Vielleicht den?«
»Sie können ihn probieren.«
Sie nahm einen kleinen Pinsel zur Hand.
»Ganz locker lassen«, befahl sie und begann, die Farbe auf meinen Lippen zu verteilen. Ich wollte das nicht.
»Locker lassen!«, wiederholte sie in genervtem Ton. Als sie endlich fertig war, hielt sie mir einen Handspiegel vor das Gesicht.
Da sah ich ihn.
Das Reflexionsgesetz erlaubte ihm, mir direkt in die Augen zu schauen, obwohl er hinter mir stand. Ich erschrak und drehte mich um. Er war der schönste Mann, den ich je gesehen hatte. Ich kann schöne Männer sonst nicht besonders leiden. Sie vergessen zu leicht, dass eine Packung auch einen Inhalt braucht. Aber dieser Mann hatte gar keine Verpackung. Er schien nur aus Inhalt zu bestehen. Das war die Schönheit. Besser kann ich es nicht ausdrücken.
Ich errötete.
»Nicht diesen Lippenstift«, sagte er mit einer tiefen, rauen Stimme.
»Welchen dann?«, fragte ich ratlos.
»Keinen Lippenstift«, sagte er fast bittend.
Die Verkäuferin hätte eigentlich sauer auf den Mann sein müssen, weil er ihr das Geschäft verdarb. Stattdessen bedachte sie mich erneut mit einem vernichtenden Blick, dem Mann hingegen warf sie ein aufreizendes Lächeln zu. Er ignorierte das.
Ich ließ die Verkäuferin stehen, ohne mich bei ihr zu bedanken. Ich ließ auch den Mann stehen. Ich ging zum Ausgang des Kaufhauses. Ich ging, ohne mich umzudrehen. Es kostete mich alle Kraft. Draußen vor der Tür atmete ich die parfumfreie Luft tief ein. Es half, aber ich ahnte, dass es nicht zu Ende war.
»Verzeihen Sie!«, sagte er und berührte mich kaum spürbar an der Schulter. Er zog seine Hand sofort wieder zurück.
»Sie waren meine letzte Hoffnung, das letzte Gesicht in der Menge«, fügte er leise hinzu.
Ich drehte mich zu ihm um.
»Und wie soll ich jetzt über den Tag kommen? Der Lippenstift war meine letzte Hoffnung.«
»Der Lippenstift hätte Ihnen auch nicht geholfen. Er passt nicht zu Ihnen. Lassen Sie Ihre Traurigkeit heraus. Weinen Sie! Sie haben viel zu lange nicht geweint.«
»Woher wollen Sie das wissen?«, fragte ich trotzig.
»Aber es stimmt doch«, sagte er und schaute mich mit weisen Augen an.
»Es stimmt«, gab ich widerstrebend zu. Ich wollte das nicht sagen, aber ich sah in seinem Blick, dass es keinen Zweck hatte, sich vor ihm zu verstecken.
Ich stand vor dem Kaufhaus, gepufft und umhergestoßen von hin- und hereilenden Passanten. Ich redete mit einem Mann, den ich nicht kannte, von meiner Traurigkeit.
Wenn er jetzt geht, laufe ich ihm hinterher, dachte ich, aber er ging nicht.
Plötzlich fing es an zu gießen. Es schüttete wie aus Kübeln. Die Menschen verließen fluchtartig die Einkaufsstraße und suchten Schutz unter den Vordächern. In Sekundenschnelle füllte sich der überdachte Eingang des Kaufhauses mit durchnässten Passanten. Sie drängten und schubsten und neue Flüchtende quetschten sich dazu. Er und ich standen dicht aneinandergepresst mitten in dem Pulk von Leuten, die nach feuchten Textilien rochen. Mein Herz schlug schneller, als ich es gewohnt war.
Um uns herum schüttelten sich die vom Regen Überraschten und prusteten und lachten, aber das war nur eine Hintergrundmusik.
Der Regen hörte so abrupt auf, wie er begonnen hatte. Sofort verliefen sich die Menschen in alle Richtungen. Durch den Wolkenbruch war die Temperatur stark abgekühlt. In meiner dünnen Sommerjacke war ich der kühlen Brise schutzlos ausgeliefert. Ich zitterte ein wenig. Der Mann stand noch immer neben mir. Er zog seinen Regenmantel aus und legte ihn über meine Schultern.
»Mein Auto steht nur zwei Ecken weiter«, sagte er und ging voran. Ich folgte ihm.
Ganz in der Nähe der Fußgängerzone, mitten im Halteverbot, parkte ein großer dunkelgrüner Geländewagen. Unter dem Scheibenwischer klemmte ein Strafzettel. Er zog ihn hervor und warf ihn achtlos auf die Straße, ohne ein Wort über dieses Ärgernis zu verlieren. Er hielt mir die Tür auf. Ich stieg ein.
Während der Fahrt schwiegen wir. Was sollte ich sagen? Ich wusste nicht einmal, wohin wir fuhren.
Normalerweise bin ich eine grauenhafte Beifahrerin. Ich mag mein Leben nicht in die Hände anderer Menschen legen. Ich lasse die Straße nie aus dem Auge und überprüfe jede Aktion des Fahrers, drehe meinen Kopf, wenn der Fahrer blinkt, um die Spur zu wechseln. An jeder Kreuzung kontrolliere ich die Querstraße in beide Richtungen und verkneife mir mühsam, »rechts frei« zu rufen. Der Mann strahlte Souveränität aus, er steuerte sein Fahrzeug mit Sicherheit durch den Verkehr. Jede seiner Bewegungen erfolgte ruhig und konzentriert. Ich lehnte mich entspannt zurück.
Er verließ die Stadt in Richtung Süden auf einer Landstraße, die in die Berge führte. In einem Dorf bog er von der Hauptstraße ab, fuhr durch eine kleine gewundene Gasse, die in einen ansteigenden Feldweg überging. Nach ein paar Minuten sah ich kein Haus mehr weit und breit. Ich hatte keine Angst. Ein paar Hundert Meter ging es durch den Wald, dann öffnete sich vor meinen Augen eine Lichtung, an deren Rand ein kleines Bauernhaus lag. Der Weg führte direkt darauf zu. Er stoppte den Wagen vor dem Eingang, schaltete den Motor ab und drehte sich zu mir. Er lächelte aufmunternd. Ich nahm das als Signal auszusteigen. Er ging auf die hölzerne Eingangstür zu. Kein Namensschild verriet, wer hier wohnte. Er drückte die Türklinke hinunter. Das Haus stand offen. Wir traten ein. Das Innere des Hauses lag im Halbdunkel. Er ging zur gegenüberliegenden Seite und öffnete die Jalousientüren, durch die abendliches Licht hereinfiel. Ich stand in einem riesigen Raum, der die ganze Fläche der unteren Etage einnahm. Er war mit Holzbohlen ausgelegt und nur karg möbliert: ein langer hölzerner Esstisch mit Stühlen auf der einen Seite, ein mit buntem Stoff bezogenes Sofa und zwei Sessel vor einem Kamin auf der anderen Seite. Ich trat hinaus auf eine Terrasse. Erst jetzt sah ich, dass man von dieser Seite des Hauses auf einen See hinunterschaute. Bei der Anfahrt hatte ich keinen See bemerkt. Wir hatten uns wohl von der dem Gewässer abgewandten Seite des Berges genähert. Der See war verzaubert. Das sich leicht kräuselnde Wasser glitzerte in der untergehenden Sonne, ein Meer aus Gold. Einige Segelboote kreuzten draußen, sonst war alles ruhig. Ich setzte mich in einen der Korbstühle, die auf der Veranda standen.
»Rotwein?«, fragte er.
Ich nickte.
Er kehrte mit einer Flasche und zwei Gläsern zurück.
»Wohnen Sie hier?«, wollte ich wissen.
»Manchmal«, antwortete er.
Er setzte sich in den anderen Stuhl, und für ein paar Minuten genossen wir schweigend die stille Abendstimmung über dem See.
»Ich weiß, wer Sie sind«, sagte er nach einiger Zeit. »Ich habe Sie gesehen, in einer dieser Talkshows. Sie haben ein Buch veröffentlicht – ›Die Frauen des Orients‹, ein gutes Buch, Sie haben die Frauen in diesem Teil der Welt verstanden und sehr einfühlsam beschrieben.«
Er schaute wieder auf den See, schwieg und trank. Er erschien mir nicht mehr so ruhig, wie ich ihn im Laufe des Nachmittags erlebt hatte.
Plötzlich beugte er sich zu mir, ergriff meine Hand und blickte mir eindringlich in die Augen.
»Sie müssen ein Buch für mich schreiben. Ich erzähle Ihnen eine Geschichte, und Sie müssen sie schreiben.«
Mir wurde in dem Moment klar, dass unsere Begegnung kein Zufall war.
»Ich soll also Ihr Werkzeug sein?«
Es war das erste Mal, dass ich mich gegen ihn wehrte.
»Wir werden beide etwas davon haben.«
Er sagte das sehr bestimmt. Darüber ärgerte ich mich. Woher wollte er wissen, was ich davon hatte, ihm ein Buch zu schreiben. Er las meine Gedanken.
»Sie werden aus der unerträglichen Mittelmäßigkeit hervortreten.«
Ich zuckte zusammen. Er hatte mir ein Messer mitten in die wundeste Stelle meiner Seele gebohrt. Ich bin 42 Jahre alt, ich bin gut aussehend, intelligent und talentiert, das ist das Allerschlimmste – talentiert! Hinter diesem Lob lauert heimtückisch die Niederlage. Und ich bin auch noch vielseitig talentiert, umso schlimmer!
II.
Ich bin in einer mittelgroßen Stadt in Norddeutschland geboren. Mein Vater war ein mittlerer Beamter beim Versorgungsausgleichsamt. Er berechnete die Renten der anderen Beamten. Bis 1945 war er ein Nazi gewesen, aber nur ein bisschen – mittelviel, eine kleine Leuchte, nicht bedeutend genug, um ihm hinterher einen Strick daraus zu drehen. Im Krieg war er Oberleutnant gewesen, wahrscheinlich hatte er durchschnittlich viele feindliche Soldaten umgebracht. Meine Mutter war Lehrerin, keine Mittelschullehrerin, sie unterrichtete die Abc-Schützen. Sie hat die mittelgroße Stadt nie verlassen, nur einmal als junges Mädchen für eine Deutschlandfahrt mit ihrem BDM-Chor. Von diesem Erlebnis schwärmte sie den Rest ihres Lebens. Bund Deutscher Mädel. Ach, Mutter, das war also der Höhepunkt ihres Daseins gewesen, die Hitlerjugendorganisation, in der sie auf den Führer eingeschworen wurde. Auf der Deutschlandtour hatte sie meinen Vater kennengelernt. Die beiden heirateten gleich nach dem Krieg und zogen in die Heimatstadt meiner Mutter, denn sie hatte dort eine gesicherte Anstellung als Grundschullehrerin. In dieser Stadt in Norddeutschland zeugten meine Eltern drei Kinder. Ich nehme an, dass sie dabei durchschnittlich viel Vergnügen empfanden. Die beiden ersten Kinder, mein Bruder und meine Schwester, legten alsbald eine durchaus erfreuliche mittelmäßige Begabung an den Tag. Nur ich, die Jüngste, zeigte echtes Talent, vor allem eine Leichtigkeit im Lernen. Ich konnte alles. Ich war sportlich und spielte ziemlich gut Klavier. In der Schule glänzte ich in allen Fächern. Ich amüsierte die Leute mit meinem Witz. Im Alter von 14 Jahren schrieb ich bereits kleine Kabarettstücke für das Schultheater. Meine Eltern unterstützten keines dieser Talente. Ein Sportlehrer entdeckte mein außergewöhnliches Ballgefühl und ermutigte mich, Tennis zu lernen. Meine Eltern fanden diesen Sport zu teuer und gaben mir keinen Pfennig Geld dafür. Im Musikraum der Schule setzte ich mich an das Klavier und spielte, ohne je eine Note gelernt zu haben. Der Lehrer empfahl meinen Eltern dringend, mir Stunden zu geben. Sie meinten, das sei herausgeworfenes Geld. Als ich in der Theater-AG der Schule mitwirkte, mäkelten sie, das koste zu viel Zeit und halte mich vom Lernen ab. Ich hatte es satt, um Geld zu betteln, also nahm ich im Alter von 15 einen Job in einer Kneipe an, um mir mein eigenes Geld zu verdienen. Ich arbeitete dort an zwei oder drei Abenden in der Woche. Merkwürdigerweise störte es meine Eltern nicht, dass ich nun weniger Zeit für die Schule hatte. Von dem Selbstverdienten wollte ich mir die Tennis- und Klavierstunden finanzieren. Meine Leistungen in der Schule wurden nicht schlechter, aber ich war oft so müde, dass ich keine Kraft mehr für die Stunden aufbrachte. Mit dem Abitur in der Tasche wollte ich die Welt erobern, aber meine Eltern dachten gar nicht daran, mich dabei zu unterstützen. Mein Vater hatte die mittlere Laufbahn für mich vorgesehen; er wollte mir eine Lehrstelle in einer der städtischen Behörden verschaffen. Da entfaltete ich eine Deutschlandkarte, nahm einen Zirkel, stach die Spitze in den Punkt für unsere mittelgroße Stadt und zog einen Kreis von 20 Zentimetern Durchmesser. Nur Städte, die außerhalb dieses Kreises lagen, kamen in Betracht. Ich fand, dass München gut klang. Ich bewarb mich für ein Literaturstudium. Bei einem Notendurchschnitt von 1,4 brauchte ich nicht lange zu betteln. Den Studienplatz erhielt ich, aber mein Vater weigerte sich, nur eine müde Mark herauszurücken. Einen Anspruch auf Bafög hatte ich nicht. Dafür waren meine Eltern zu gut situiert.
Ich räumte mein Bankkonto, lieh mir noch 500 Mark bei meiner Schwester, packte meine Sachen und nahm den Zug nach München.
Eine Werbeagentur gab mir eine Volontärstelle. Ich zeigte ihnen meine Kabaretttexte und ein paar Zeitungsartikel, die ich verfasst hatte. Ihnen reichte das als Referenz. Aber mehr noch half mir, glaube ich, dass der Art Direktor Gefallen an mir fand. Wir vergnügten uns ein Jahr lang auf jedem Schreibtisch der Agentur, manchmal auch in seinem Jaguar. Er nahm mich gerne mit zu Präsentationen bei den Kunden. Auf dem Rückweg, wenn alles gut gelaufen war, fuhren wir auf einen Parkplatz. Ich fand unser Verhältnis durchaus befriedigend. Ich half ihm dabei, seine Angst vor dem Altern zu verdrängen, dafür lehrte er mich alles, was er über Werbung wusste. Außerdem sorgte er dafür, dass ich ein angenehmes Leben führen konnte. Von meinem Volontärgehalt ließen sich keine großen Sprünge machen, das war ihm unangenehm, und er glich diesen Mangel aus seiner Privatschatulle aus. Ich nahm das großzügig entgegen.
Je mehr er sich vor dem Altern fürchtete, desto heftiger klammerte er sich an mich. Mit der Zeit belastete mich seine Panik. Ich war jung und mochte mich nicht ständig um das Altwerden sorgen. Es war sein Altwerden. Also verließ ich ihn, aber damit war ich natürlich auch meinen Job in der Agentur los. Wir beide unter einem Dach, das ging natürlich nicht. Ich sah das ein.
Ich bewarb mich bei einer Kulturzeitschrift. Merkwürdigerweise bekam ich den Job. Irgendwie verbreitete ich in dieser Zeit eine Aura von Effizienz und Kreativität oder mitreißender Spontaneität, die die Leute sofort für mich einnahm. Es half mir aber auch, glaube ich, dass der Chefredakteur sich für mich interessierte. Er nahm mich mit zu einer Kunstmesse in Amsterdam. Abends aßen wir in einem kleinen französischen Restaurant und leerten zwei Flaschen Wein. Wir lachten drei Stunden ununterbrochen über unsere humoristischen Einfälle. Sie sprudelten aus uns heraus. Wir schoben uns gegenseitig die Vorlagen zu. Wir erlebten ein Feuerwerk aus Geistesblitzen. An diesem Abend brauchten wir nur ein Hotelzimmer. Wir schliefen keine Sekunde in dieser Nacht. Zwischen den erotischen Freuden wetzten wir die Klingen verbal, vergnügten uns mit unseren Wortspielchen und wetteiferten in unserem Witz.
In den folgenden Monaten suchte er wie ein Süchtiger nach Begegnungen mit mir. Seine Erwartungshaltung ermüdete mich. Manchmal wollte ich einfach schlaff in der Ecke hängen und keine Geistesblitze produzieren. Er aber ließ nicht locker, er brauchte seine Droge. Es blieb mir nichts anderes übrig, als ihn langsam auf Entzug zu setzen. Das nahm er mir übel. Süchtige sind nicht besonders vernünftige Menschen. Am Ende half nur die Schocktherapie. Ich verschwand aus seinem Leben.
Glücklicherweise besaß ich bereits das Angebot eines Reisemagazins. Ich sollte eine Serie »Frauen auf Reisen« betreuen. Ich für meinen Teil reiste lieber mit Männern, aber wenn andere Frauen es reizvoller fanden, allein oder mit ihren Freundinnen auf Tour zu gehen – bitte schön. Mir verschaffte dieser Job ein anständiges Einkommen und die Möglichkeit, auf Kosten des Verlags die Welt zu sehen. Obwohl ich das Thema »Frauen auf Reisen« recherchierte, war ich mit einem Mann unterwegs, einem begnadeten Fotografen. Seine Leidenschaft waren Gesichter. Er porträtierte Menschen, bemächtigte sich ihrer Gesichter mit einem Einfühlungsvermögen, wie ich es nicht wieder erlebt habe. Er sah ihnen mit der Kamera in die Seele. Wir vagabundierten gemeinsam durch alle vier Ecken der Welt. Natürlich machte er auch von mir Fotos. Mit seinem Objektiv blickte er mir in die Seele. Er verliebte sich in diese Seele. Dann verliebte er sich in meinen Körper. Er fotografierte jedes Detail in jeder Stellung, er fotografierte meine nackte Haut, meinen halb entblößten Busen, meinen Po, wenn ich entspannt auf dem Bauch lag, die Stelle zwischen Hals und Schulter, die Haare zwischen meinen Beinen. Die Aufgabe stellte ihn so vollkommen zufrieden, dass er ganz vergaß, diesen Körper zu liebkosen. Mir genügte es nicht, durch das Auge der Kamera begehrt zu werden. In einer Bar in Marrakesch folgte ich einem feingliedrigen Beduinen, der mich mit seinen Glutaugen verführte. Er erinnerte mich voller Lust daran, dass ich einen Körper aus Fleisch und Blut besaß. Der Fotograf hat mir das nicht verziehen.
Natürlich dachte ich in diesen Jahren manchmal an die Wunderwerke, die ich noch vollbringen wollte. Aber ich war noch jung und hatte alle Zeit der Welt, meine Pläne zu verwirklichen. Ich spürte die Kraft und Energie in mir und war mir meiner Kreativität vollkommen sicher, sodass ich nicht daran zweifelte, dass mein Genie früher oder später ein Ventil finden würde. Die Mittelmäßigkeit anderer Menschen belächelte ich mitleidig. Ich fühlte mich von diesem Virus nicht bedroht.