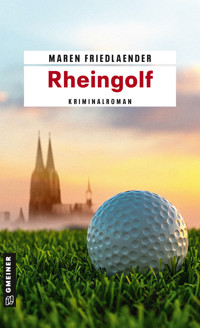Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissarin Theresa Rosenthal
- Sprache: Deutsch
Am Kölner Stadtwald liegt ein unbekannter Toter, genau dort, wo 1977 Arbeitgeberpräsident Schleyer von der RAF entführt wurde. Kommissarin Rosenthal und Kollege Bär stehen vor der Frage: Ist der Tatort Zufall oder besteht eine Verbindung zu den RAF-Morden? Eine Spur führt ins dänische Nordschleswig zu einem Ex-Stasi-Major. Durch die Ermittlungen rumort es in der einstigen RAF-Sympathisantenszene. Gibt es einen RAF-Täter, der sich entschlossen hat zu reden? Rosenthal muss aber auch alte Wunden bei den Opfern aufreißen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 247
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Maren Friedlaender
Schweigen über Köln
Kriminalroman
Zum Buch
Mord verjährt nicht Während Schumanns Sinfonie Nr. 4 in d-Moll summt Kommissarin Rosenthals Telefon. Hals über Kopf verlässt sie das Konzert in der Kölner Philharmonie. Am Stadtwald liegt ein unbekannter Toter in einem roten Renault – genau dort, wo 1977 Arbeitgeberpräsident Hanns Martin Schleyer von der RAF entführt wurde. Sein Fahrer und drei Leibwächter wurden damals erschossen. Kommissarin Rosenthal und ihr Kollege Bär stehen vor der Frage: Ist der Tatort Zufall oder besteht eine Verbindung zu den RAF-Morden? Eine Spur führt ins dänische Nordschleswig. Dort betreibt der pensionierte Stasi-Major Kraske einen blühenden Handel mit Dossiers über die einst von der DDR geschützten RAF-Terroristen. Unter dem Druck der dänischen Polizei packt der Major aus. Daraufhin rumort es in der ehemaligen RAF-Sympathisantenszene von Bonn bis Aachen. Unterstützer, die mittlerweile gutbürgerlich leben, fürchten um ihre Existenz. Gibt es einen RAF-Täter, der sich entschlossen hat zu reden? Kommissarin Rosenthal muss aber auch alte Wunden bei den Hinterbliebenen der Opfer aufreißen.
Maren Friedlaender, in Kiel geboren. Unter anderem politische Redakteurin beim ZDF. Die Autorin lebt seit 35 Jahren in Köln, studierte dort Psychologie. Mit dem Fahrrad erobert sie ihre Wohnorte: Hamburg, Wiesbaden, Berlin, Köln – vom Fahrradsattel aus sieht man mehr. Die Entdeckung der Städte durch das Unterwegssein in verschiedenen Welten: schreibend und aktiv in der Politik, unter anderem Mitglied des Kölner Kulturausschusses. Die unterschiedlichen Einblicke in die politische Szene verarbeitete sie in den Krimis: »Berlin.Macht.Männer«, »Die Macht am Rhein« (mit Olaf Müller) und »Rheingolf«. Ebenfalls im Gmeiner-Verlag erschien der Roman »Der Löwe Gottes«. Den Terror der RAF erlebte sie hautnah als Journalistin und verarbeitet ihre Erinnerungen in dem Krimi »Schweigen über Köln«.
Impressum
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2021 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © ullstein bild / dpa
ISBN 978-3-8392-6986-2
Haftungsausschluss
Personen und Handlung sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt. Den Hintergrund des Kriminalromans bildet der Terror der RAF, weshalb Bezug auf bestimmte Personen und Ereignisse dieser Zeit genommen wird.
Alte Kollegen
Müller traf Erwin Kraske in Dänemark, in Vester Vedsted. Das Örtchen liegt zwischen Ribe und Skærbæk in Nordschleswig, der deutschsprachigen Region. Dort hatte der Ex-Stasioffizier ein Häuschen angemietet, schon zu DDR-Zeiten, als er Major beim Ministerium für Staatssicherheit war, tätig für die HVA, Hauptverwaltung Aufklärung, Abteilung Auslandsspionage.
Linientreue Stasis hatten zu DDR-Zeiten Zugriff auf ein wenig Luxus gehabt, natürlich im Auftrag des Vaterlandes oder für den internationalen Sozialismus – wie man es nahm. Kraske und Müller waren sozusagen Kollegen – Exkollegen. Sie waren beide nicht mehr im Dienst. In ihrer aktiven Zeit hatten sie für gegnerische Seiten gearbeitet, waren sich persönlich aber nicht begegnet. So konnte Müller nicht beurteilen, ob Kraske mal ein gutaussehender und durchtrainierter Mann gewesen war. Er ging davon aus. Harte Schule der HVA in Golm bei Potsdam. Seine Form hatte der Kollege nicht nur aus Altersgründen eingebüßt. Schlaffe Gesichtszüge mit rötlichen Hautflecken verrieten den Trinker. Die Körperhaltung ließ auf Verfallserscheinungen schließen. Beim ersten Carlsberg blühte Kraske auf, wurde gesprächig und entwickelte einen Charme, mit dem er in guten Zeiten das schöne Geschlecht zur Mitarbeit an einer besseren Welt überzeugt hatte.
Typen wie Kraske mäanderten nach dem Fall der Mauer überall in Deutschland herum. Sie hatten ihre Jobs eingebüßt. Die Verlierer. Es gab auch die anderen, die Gewinner, Ex-Stasis, denen es blendend ging. Müller war sicher, dass sie im Ministerium für Staatssicherheit viel früher als im Westen Informationen darüber gehabt hatten, dass es mit ihrer DDR zu Ende ging. Müller, einst angestellt beim Bundeskriminalamt, hielt nicht viel von den eigenen Kollegen beim BND. Wie hatte Thomas de Maizière, damals Innenminister, bei einem Vortrag für die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik gesagt: »Ohne die Amerikaner sind wir blind und taub.« Müller war bei der Veranstaltung im Kölner Hotel Excelsior dabei gewesen. Ihm wurde damals umgehend schlecht. Wozu unterhielten sie den Monsterbetrieb mit 6.500 Mitarbeitern in Berlin und Pullach, wenn sie dabei blind und abhängig blieben von den Brosamen, die vom reich gedeckten Tisch des CIA abfielen?
Die Jungs im Ministerium für Staatssicherheit waren ausgeschlafener gewesen. Immer gut informiert. Sie hatten Stasi- und SED-Vermögen beiseitegeschafft und nach der Wiedervereinigung eins zu eins gegen D-Mark eingetauscht. Aus wertloser DDR-Mark war eine harte Währung geworden. Das Geld war nicht verschwunden. Geld verschwand nicht, es wanderte. Irgendwo lagerte und arbeitete es. Insider profitierten. Einige Alt-Stasis saßen bis heute am Drücker. Kraske gehörte eher zu den Verlierern. Er hielt sich mit dem Verkauf von brisantem Material über Wasser.
Erwin Kraske holte zwei weitere Carlsberg aus dem Kühlschrank und brachte eine Flasche Aquavit aus der Tiefkühltruhe mit. Müller akzeptierte. Er wollte Kraske in Redelaune halten, machte sich aber keine Hoffnung, dass der Kollege im Suff mehr ausplaudern würde als gewollt. Knallharte DDR-Schule. Mit ein paar Schnäpsen kriegte man solche Spezialisten nicht unter. Der alte Stasi-Offizier hatte keine Eile. Er genoss das Gespräch unter Kollegen sichtlich, bediente sich im zweiten Gang an einer Flasche Gammel Dansk.
»Für den Magen«, grinste er und prostete Müller zu. »Auf die guten alten Zeiten.«
Die guten alten Zeiten – vielleicht für Stasi-Mitarbeiter. Sie hatten Privilegien genossen, durften teilweise im Ausland leben, es sich gut gehen lassen beim Klassenfeind, indem sie sich an dessen Lebensweise anpassten, im Auftrag des sozialistischen Staates und für die höheren Ziele. Trösteten nette Frauen von Mitarbeitern im westdeutschen Verteidigungsministerium mit Söhnlein Brillant, hörten aufmerksam zu. Methode »Romeo« nannten sie es im Ministerium für Staatssicherheit. Methode »Romeo« meinte, einsame Sekretärinnen von Politikern und hohen Militärs durch Liebesbekundungen zu gewinnen und emotional abhängig zu machen. Scheinheirat nicht ausgeschlossen. Im rüden Stasi-Jargon hieß die Taktik: »Intim betreuen« oder brutaler: »Ficken fürs Vaterland«. Unwissentlich gaben unzählige Frauen nachrichtendienstlich wichtige Erkenntnisse weiter. Wenn die Geliebte misstrauisch wurde, steckte sie schon so tief drinnen, dass man sie erpressen konnte.
Auch zu Hause im sozialistischen Einheitsstaat, wo die eigene brave Ehefrau saß, genossen die Stasi-Offiziere Exklusivität. Datschen und Zugang zu Waren gehörten dazu. Während Stasi-Mitarbeiter und ihre inoffiziellen Helfer die Bevölkerung bespitzelten, hatten die Funktionäre keine Ahnung, was die Menschen wirklich dachten. Darin glichen sich Monarchien und kommunistische Diktaturen wie ein Ei dem anderen. Sie verloren die Verbindung zu ihrem Volk. Selbst in den Demokratien: Wusste denn Frau Merkel, was in den Köpfen ihrer Mitbürger vorging?
Die Stasi hatte den Untergang der DDR vielleicht aus Millionen abgehörten Telefonaten herausgehört, aber das starre Regime war zu Reformen nicht fähig gewesen. Der wirtschaftliche Zusammenbruch zeichnete sich ab. Die Funktionäre sahen es. Eine Volkswirtschaft, die in 40 Jahren als technologisches Highlight einen Trabi präsentierte, auf den man zehn Jahre warten musste, war nicht zukunftsfähig. Das wussten die Strippenzieher des VEB-Deutschlands, die im Westen gern BMW und Audi fuhren.
Wahrscheinlich war Kraske kein großer Fisch gewesen, aber er hatte Zugang zu geheimem Material gehabt und selbst Berichte geliefert. Er erzählte dem Wessi-Kollegen von seinem Einsatz in Dänemark.
»Was haben euch denn die Dänen interessiert?«, wollte Müller wissen.
»Die Nordschleswiger«, erklärte Kraske. »Ich gab der Zentrale eine Lageeinschätzung zur politisch-operativen Entwicklung in der deutschen Minderheit in Dänemark. Durch die Nordschleswiger konnten wir das Bundesland Schleswig-Holstein beackern. Die deutsche Minderheit in Dänemark hat immer exklusive Kontakte nach Schleswig-Holstein gehabt. Wir nutzten auch die Spannungen zwischen Deutschen und Dänen. Ziemlich viele Leute waren vorbelastet durch den Krieg, also durch eine Nazi-Vergangenheit. Dadurch waren sie für die Stasi erpressbar.«
Kraske zündete sich eine Zigarre an und kippte einen weiteren Gammel Dansk, bevor er fortfuhr.
»Für uns war Nordschleswig in einem weiteren Punkt interessant. Hier wird Deutsch gesprochen, das gab uns die Möglichkeit, Bürgern der DDR oder sonstigen Deutschsprachigen eine neue Identität als dänische Staatsbürger zu geben. Sie fielen nicht auf.«
Das war das Stichwort. Es war das, was Müller vermutet hatte. Sie kamen zum Geschäft. Kraske überreichte dem Kollegen eine Mappe. Müller blätterte sie durch.
»Nur ein Name?«, fragte er. »Grundmann. Nie gehört.«
»Ein Name! Ein Honorar«, bestätigte Kraske. »Mach deinen Job, dann komm wieder. Es gibt mehr Namen – für mehr Geld.«
Müller zahlte den vereinbarten Betrag.
»Mach ihm etwas Feuer unter dem Hintern. Mach es ihm ungemütlich in seinem dänischen Refugium«, bat der Ex-BKA-Mann. »Ich will Grundmann raus aus Dänemark haben.«
Müller grinste: »Du kannst ein fettes Honorar für die Rückführung ins Vaterland von ihm kassieren. Die Kerle wussten immer schon, wie man sich Moneten beschafft.«
»Wird erledigt«, versprach Kraske. »Ich habe sowieso nie Sympathie für die Jungs von der Terroristentruppe gehabt, auch nicht für die Mädels. Alles Querköpfe.«
Kein Verhandlungsspielraum
Das Telefonat mit Ronald Grundmann verlief wie gewünscht. Kraske hatte offensichtlich gute Vorarbeit geleistet. Grundmann ging auf alles ein. Treffen in Köln, Angebot eines neuen Wohnsitzes, Eupen, Deutschsprachige Gemeinschaft in Belgien, gleich hinter der Grenze bei Aachen. Es wurde über das Honorar verhandelt, was heißt verhandelt? Müller stellte eine Forderung: 50.000. Grundmann schluckte, vor allem schluckte er, dass es hier nur ums Geld ging. Ein Geschäft, nichts weiter. Er versuchte den Preis zu drücken. Müller blieb hart.
»Großer Aufwand, großes Risiko, kein Verhandlungsspielraum«, hatte er gesagt. Müller ließ durchsickern, dass er ein ehemaliger Stasi-Agent war. Das klang plausibel und überzeugte Grundmann. Hilfe von den Stasis gegen Geld.
»Man müsse von etwas leben«, hatte Müller unverhohlen mitgeteilt.
»Klar. Ich mach’s«, antwortete Grundmann kurz angebunden.
Müller ging davon aus, dass der Exterrorist knapp bei Kasse war. Wie er an frisches Geld käme, konnte er sich denken. Wahrscheinlich besorgte er es sich auf die alte Tour – Banküberfall. Umso besser, dann hatte Müller ihn in der Hand. Vielleicht überzeugte er den Mann auszupacken, überlegte Müller. Er sah eine Chance.
Die Filiale
Der Biturbo heulte auf. Gummi verbrannte auf dem Asphalt der Hauptstraße. Wie eine Rakete schoss der Audi A6 auf die Sparkassenfiliale in Langerwehe zu. Mit einer Vollbremsung kam er zum Stehen. Der Motor schnurrte im Leerlauf. Eine maskierte Person sprang heraus. Der Typ trug eine Heckler & Koch MP 5, schwarze Jacke, Turnschuhe, Jeans. Der erste Feuerstoß verwandelte die Deckenverkleidung in ein Millionenpuzzle. Der zweite Feuerstoß erwischte die Thermoskanne des Filialleiters, der Beruhigungstee beruhigte nun Kontoauszüge, die Titelseite der Lokalzeitung und die Tastatur eines Computers. Frau Wamich, 45 Jahre im Dienst der Girokonten, zuckte zusammen, fiel in Ohnmacht. Auszubildender Willi Kuckertz behielt die Nerven, erreichte aber nicht den Alarmknopf.
»Alles einpacken. Zacki, zacki!« Der Maskierte fackelte nicht lange. Bankangestellte Marlene Rosarius griff alle Scheine aus der Kasse und steckte sie in die Plastiktüte. »Zeitschloss. Mehr kommt nur durch das Zeitschloss. Das geht nicht so schnell«, stotterte sie.
Filialleiter Egbert Laufenberg kam mit erhobenen Händen und einer Hose, über die sich der Morgenkaffee ergossen hatte, mutig auf den Maskierten zu.
»Was wollen Sie?«
»Saublöde Frage. Knete. Alles. Sonst gibt es hier Tote«, grunzte eine verstellte Stimme hinter der Maske.
»Folgen Sie mir.«
Egbert Laufenberg hatte mehrere Seminare zum Thema Überfall durchlaufen. Oberstes Gebot: Ruhe bewahren. Die Realität sah anders aus. »Ruhe bewahren«, ratterte es in seinem Kopf. »Personenschutz hat Vorrang. Geld herausgeben. Deeskalieren.« Für Laufenberg war es das erste Mal. Er machte seine Sache ganz gut, ging zum Tresor in Raum 003, öffnete ihn und verwies auf die Geldscheine in den abgepackten Klarsichtpaketen.
»Geht doch«, grunzte es wieder.
Alle Scheine verschwanden in Aldi-Plastiktüten. Frau Wamich wurde von Willi Kuckertz liebevoll versorgt. Die drei Frühkunden standen mit erhobenen Händen im Schalterraum und wagten keinen Mucks, keine Bewegung.
Der Spuk war nach zehn Minuten vorbei. Zehn lange Minuten. War ihm nie so bewusst gewesen, die Sache mit den langen Minuten. »Haben alle 60 Sekunden«, hatte Laufenberg immer geblödelt, wenn ihm Leute mit den langen Minuten kamen. Dieses waren die längsten seines bisherigen Lebens gewesen.
Der Biturbo heulte erneut auf. Die Reifen hinterließen schwarze Spuren. Der Audi jagte auf der Hauptstraße in Richtung A 4. Im selben Moment ging der Alarm bei der Polizei in Düren ein. Mehrere BMW verließen das Präsidium und rasten Richtung Langerwehe. Sie kamen zu spät. Der Audi A6 war bereits am Autobahnkreuz Aachen.
Ende der Sendung
Die Autos der Mitarbeiter des Belgischen Rundfunks in Eupen standen oft viele Stunden unbenutzt auf dem Parkplatz. Manche Redakteure begannen um neun Uhr morgens mit der Arbeit und stiegen erst gegen 22 Uhr in ihren PKW, um am Kehrwegstadion vorbei, Spielort des Erstligisten »Allgemeine Sportvereinigung Eupen«, hinab in die Unterstadt zu fahren. Andere brachen in Richtung Hohes Venn auf, dem Quellort der Rur, eigenwillige Landschaft mit herbem Charme.
Er hatte alles recherchiert. Mittwochs stand der Renault Megane ab neun Uhr auf einem abgelegenen Parkplatz des Rundfunkgebäudes. Mit zwei Griffen klackte die Türsicherung auf. Modernste Elektronik ließ den Anlasser sofort anspringen. In drei Minuten verschwand der Neuwagen aus dem Hause Weymans und tauchte erst eine Woche später wieder in Köln auf.
Als Robert Cremer, zuständig für Lokalberichterstattung im Hörfunk des BRF, um 21.45 Uhr in bester Laune den Belgischen Rundfunk verließ, dauerte es ungefähr fünf Minuten, bis die Laune in Ärger umschlug. Zuerst glaubte er an ein Missverständnis, dann an einen Scherz der Kollegen. Um 21.50 Uhr stürmte er wütend zurück an die Rezeption.
»Das ist effektiv nicht wahr!«
»Robert, hast du was vergessen?« Isabell Schüren, Spätschicht am Empfang, kannte Robert lange. So aufgebracht war er nie gewesen.
»Die haben mir meinen neuen Renault geklaut!«
»Nicht möglich.«
»Wenn ich es doch sage.«
»Bist du sicher?«
»Steht hier oben ›blöd‹ auf der Stirn, oder was?«
»Ich mein ja nur. Hast du ihn nicht in der Werkstatt?«
»Bin ich mit dem Mopedhelm reingekommen? Siehst du irgendwo da draußen eine Kutsche?«
»Okay, ich ruf die Polizei an.«
Robert Cremer nickte, frustriert darüber, dass er seinen Feierabend mit Protokollaufnahmen verbringen würde.
»Belgischer Rundfunk, Schüren. Dem Robert sein Auto ist gestohlen worden. Was? Ja heute. Wann? Keine Ahnung. Robert, wann ist dir der Wagen gestohlen worden?«
»Gib mal her. Ja, Cremer, Robert. Dunkelroter Renault Megane. Kennzeichen kommt gleich. Heute Morgen geparkt. So gegen neun Uhr. Jetzt will ich nach Hause. Da ist der Wagen weg. Kameras? Haben wir Kameras, Isabell? Ja, wir haben Kameras. Aber nicht da, wo mein neuer Renault parkte. Super. Ja. Find ich auch. Einfach super.«
Um 22 Uhr kamen die Beamten Jeanne Emontspool und Peter Gentgarten. Sie schauten lange auf den leeren Parkplatz. Schüttelten bedächtig den Kopf. Danach gingen sie an den Empfangstresen des BRF und schrieben das Protokoll.
Peter kannte den Robert aus gemeinsamen Zeiten in der Städtischen Grundschule Unterstadt. Im Grunde kannten sich alle in Eupen.
»Ja, Robert. Was soll ich sagen. Weg ist weg. Da führt effektiv kein Weg dran vorbei. Der zehnte Fall in diesem Monat. Der ist bestimmt schon raus aus der Deutschsprachigen Gemeinschaft. Futschneu? Ich tippe auf Moldawien. Zweitwagen für die Frau von einem Mogul oder wie die so heißen.«
»Oligarch, Peter, Oligarch. Mehr Hoffnung kannst du mir nicht machen?«
»Spricht die Statistik dagegen. Effektiv.«
»Effektive Scheiße, Peter. Yasmin wartet seit einer halben Stunde mit einem Fondue auf mich. Und ich steh hier, schau auf einen leeren Parkplatz und kann mir was von moldawischen Oligarchentussen anhören. Scheiße ist das. Hätt’ ich bloß den alten Golf behalten. Aber nein. Madame wollte ja eine Familienkutsche.«
»Robert, wir fahren dich. Ist doch klar. Die Versicherung wird ihn ersetzen. In zwei Wochen hast du einen neuen. Nimm eine andere Farbe. Rot bleicht aus.«
»Danke, großer Trost. Der nächste dann in Weiß. Essen auf Rädern oder so. Abflug. Sonst mach ich eine Sondersendung über die Eupener Polizei.«
Robert, Peter und Jeanne verließen den BRF, fuhren in Richtung Baraque Michel und fachsimpelten über die effektive Aufstellung von Überwachungskameras.
Bis Moldawien kam der Renault nie. Als Robert ihn vermisste, parkte er bereits in einer Garage in Köln-Rodenkirchen. Eine wichtige Fahrt stand dem Wagen noch bevor.
Schnelle Entscheidung
Müller bekam keine Information aus Grundmann heraus. Sie saßen im Auto. Der Ex-BKA-Mann verhandelte, machte Druck: Den neuen Wohnsitz, die neue Identität gäbe es nur gegen Namen. Grundmann blieb stur. Es sei nur ein Geldbetrag vereinbart gewesen.
»Stichwort Langerwehe.« Es war Müllers letzter Versuch. »Wie viel hast du erbeutet? – Könnte Schwierigkeiten geben«, drohte er nach kurzer Bedenkzeit für den Alt-Terroristen. Der schwieg. Ein harter Brocken.
Müller stieg aus, gab dem Fahrer eines vor ihnen parkenden Autos ein Zeichen. Grundmann war überrascht, dass es einen zweiten Mann vor Ort gab, ein alter Kollege von Müller, Sven Hubens, lange Jahre Fahnder beim Verfassungsschutz in Düsseldorf. Mittlerweile arbeitete Hubens auf eigene Rechnung, für wen, hatte er Müller nicht verraten, aber Sven besaß offensichtlich gute Kontakte zum ehemaligen Team. Die alten Seilschaften funktionierten.
»Bis dass der Tod uns scheidet«, hatte Sven lachend gesagt und half Müller mit einigen relevanten Informationen aus. »Eine Hand wäscht die andere. Wenn du mit dem Arschloch fertig bist, übernehme ich. Ich brauche auch etwas«, forderte er von Müller. Der stimmte zu. Schließlich hatte Hubens den Kaufbetrag für die Stasi-Akte besorgt. Mit einem Handshake wurde die Vereinbarung besiegelt. Nichts Schriftliches, ein Gefallen unter alten Kumpels.
Müller übernahm Hubens Auto und fuhr in Richtung Militärring davon, während Hubens auf der Fahrerseite des Renaults mit belgischem Kennzeichen einstieg und sich Grundmann vornahm.
Der Gebrauch der Waffe war nicht geplant gewesen. Hubens hatte diesen Ausgang des Gesprächs nicht ausgeschlossen, aber er hätte die andere Variante vorgezogen. Leider schwieg Ronald Grundmann: keine Reue, vielleicht ein paar Zweifel, aber keine Gewissensbisse. Keine relevanten Informationen. Keine Täternamen. Sie bunkerten immer noch. Grundmann bunkerte. Nicht einmal, als der Mann auf dem Fahrersitz eine nicht registrierte Walther PPK auf ihn richtete, rückte er mit einem Täternamen heraus. Wer hat Herrhausen getötet? Rohwedder? Grundmann blieb verstockt. Ob er geglaubt hatte, sein Gegenüber pokere nur?
»Lily?«, fragte Hubens. »Wo ist sie?«
Hubens entsicherte die Waffe. Er sah, wie dem Mann auf dem Beifahrersitz der Schweiß ausbrach.
»Halle«, sagte Grundmann mit zitternder Stimme. Dann machte der Exterrorist den Fehler, in seine Tasche zu greifen. Hubens wusste, mit wem er es zu tun hatte. Grundmann war ein Desperado. Kein Risiko. Der Schuss aus kurzer Distanz ging glatt durch die Stirnwand. Dem Getroffenen blieb nicht einmal Zeit für ein Gefühl der Überraschung. In den gegenüberliegenden Häusern hörte niemand den Schuss. Hubens hatte einen Schalldämpfer benutzt. Die Patronenhülse hob er von der Fußmatte des Wagens auf und steckte sie in die Jackentasche.
Ohne Hast öffnete der alte Profi die Tür des Wagens, stieg mit gemächlichen Bewegungen aus, ging um den Renault herum, öffnete die Beifahrertür und fasste in Grundmanns Jackentasche. Er fühlte hartes, glattes Metall. Vorsichtig zog er Grundmanns Hand aus der Tasche. Die Hand umklammerte eine Waffe.
»Dachte ich es mir doch«, zischte Hubens. »Immer noch dieselben Wichser. Eine Makarow. Wahrscheinlich von den Freunden aus dem Osten.« Hubens hätte schwören können, dass das Ding nicht registriert war.
Er legte die Hand mit der Pistole auf Grundmanns Schoß. Es machte den Eindruck, als halte der Terrorist die Makarow anschlagbereit. In der anderen Jackentasche fand er das Handy. Er nahm es an sich und verschwand im angrenzenden Stadtwald. Mit ruhigen Schritten passierte er den hohen, dunkelgrauen, obeliskartigen Gedenkstein, der in der Mitte des Parkzugangs platziert war. Wege durchkreuzten den Park, er ging vorbei an einem Spielplatz. Eine dunkle Nacht. Menschen traf er keine. Nicht einmal die Hundebesitzer trieben sich zu dieser Stunde im einsamen Park herum. Keine Junkies. Keine Liebespaare. Er ging zu Fuß vorbei am Kahnweiher, drehte sich um, kein Mensch zu sehen. Er zog die SIM-Karte aus dem Handy und warf es ins Wasser des Tümpels. Die Walther PPK, mit der er auf Grundmann geschossen hatte, flog hinterher. Sie sank auf den Grund des trüben Wassers und versackte im Schlamm. Hubens schlenderte weiter bis zur Dürener Straße. Alles ohne Hast. Ein Mann beim abendlichen Spaziergang. Ecke Stadtwaldgürtel bestieg er den schwarzen Golf, den er zurzeit benutzte, und fuhr in Richtung Süden.
Hustenkonzert
Theresa Rosenthal parkte ihren grünen Mini Cooper um Punkt 18.00 Uhr vor dem Haus ihrer Lieblingsverwandten in Köln-Marienburg. Sie hatte am Morgen einen Anruf von Tante Clarissa erhalten.
»Kind«, hatte die Tante mit ihrer kräftigen Stimme in den Hörer gedröhnt. Sie sagte immer noch Kind zu Theresa, obwohl die mit ihren fast 50 Jahren schon länger aus dem Gröbsten heraus war. »Kind, begleitest du mich heute Abend ins Konzert? Londoner Philharmoniker unter Sir Eliot Gardiner. Ein Leckerbissen.«
»Und den willst du mit mir teilen?«, fragte Theresa überrascht. »Ist Elsa krank?« Elsa war Tante Clarissas Abo-Freundin.
»Ja, die postkarnevalistische Grippewelle hat sie erwischt. Ich weiß nicht, warum sie mit ihren lächerlichen 82 Jahren jeden Virus aufschnappt.«
»Was treibt sie sich in ihrem Alter auch im Karneval herum?« Theresa lachte. Die absurde Vorstellung, dass die elegante Elsa sich im Karneval tummelte, amüsierte sie. Nun war Theresa also dran und musste Tantchen ins Konzert begleiten. Einer 93-Jährigen schlug man keinen Wunsch ab, wenn er irgendwie erfüllbar war. Theresa hatte zwar Bereitschaftsdienst, aber sie würde ihr Handy stumm schalten und das Beste hoffen. Der dauernde Stand-by-Modus ging ihr auf die Nerven. Jedes Jahr dasselbe Theater. Von Weiberfastnacht bis Karnevalsdienstag schunkelten die Kollegen halbnackt in den Straßen herum, bis auch der Letzte sich mit dem Grippevirus infiziert hatte. Dieses Jahr wütete er besonders arg. Sie arbeiteten im Morddezernat KK 11 mit halber Mannschaft. Verbrecher hatten gute Chancen, ungestraft davonzukommen. Theresa gehörte wie jedes Jahr, weil sie dem Mummenschanz fernblieb, zu den Gesunden und Leidtragenden. So wie ihre Tante, die trotz ihres Alters robust war. Ostpreußische Gutsherrengene.
Auf Theresas Klingeln hin stand die alte Dame fertig angekleidet im eleganten schwarzen Yves-Saint-Laurent-Mantel bereit.
»Da bist du ja, Kind.« Die Tante verriegelte die Türschlösser oben und unten, drehte den Schlüssel jeweils zweimal um.
»Immer noch keine Alarmanlage?«, fragte Theresa, die Antwort kennend. Vergeblich bat sie bei jedem Besuch, endlich eine Sicherung einzubauen. Die wohlhabende Verwandte lebte in dem teuren Kölner Villenviertel allein in ihrem Haus. Es hatte mehrere Einbruchversuche gegeben, und Trickdiebe hatten erst kürzlich versucht, die Arme mit irgendeiner Dachdeckernummer zu übertölpeln, worauf sie wenigstens eine Gegensprechanlage installieren ließ, damit Gangster nicht gleich in ihrem Flur standen. Aber wahrscheinlich haut sie ihnen die Handtasche um die Ohren, dachte Theresa, als Tante Clarissa mit eiligem Schritt die Zufahrt hinuntereilte. Der flotte Gang verriet ihr Alter nicht, nur das von Osteoporose zerbröselnde Rückgrat, das sich wie ein Flitzbogen krümmte. Sie schrumpelt langsam weg, bemerkte Theresa, während sie der Tante die Fahrzeugtür aufhielt. Als sie sich ins Auto hineinbeugte, um beim Anschnallen zu helfen, pfiff Clarissa Hammerstadt ihre Nichte an.
»Ich kann das selbst. Bin doch kein Kind mehr.«
»Aber vielleicht wieder«, lachte Theresa. Mit ihrer Tante pflegte sie einen lockeren Umgangston, den die ihr nie übelnahm, anders als ihre eigene Mutter, mit der Theresa bei jedem der seltenen Telefonate aneinandergeriet.
Das Konzert begann erst um acht Uhr, aber die Kommissarin, die immer mal wieder für die kränkelnde Elsa einsprang, kannte das Prozedere der musikalischen Abende. Sie begannen mit einem Glas Champagner und einem Imbiss im »La Brasserie«, gegenüber der Philharmonie. Früher waren sie ins Dom-Hotel gegangen. Das fiel aus, es war im fünften Jahre geschlossen – und damit hatte die einzige Gastronomie auf dem Domplatz den Betrieb eingestellt. In Köln schaffte es nicht nur die Stadt, Chaos im Bausektor anzurichten, auch auswärtige Investoren kriegten das in der Jeckenmetropole hin. Es gab in Köln für ein Hotel keinen attraktiveren Standort als die Lage am Roncalliplatz mit Blick auf das Weltkulturerbe, aber irgendetwas lief bei der Renovierung des altehrwürdigen Hotels schief, und nun bröckelte das Gebäude traurig vor sich hin. Ähnlich wie die Oper. Bauprobleme hatten in der Rheinmetropole Tradition. Für ihren Dom benötigten die Kölner schlappe 623 Jahre bis zur Fertigstellung.
Im Foyer der Philharmonie wurde Theresa Zeuge der fleischgewordenen Statistik zur Überalterung der deutschen Gesellschaft. Die Folgen bekam sie sofort zu spüren. Trotz des erfreulichen Anlasses mufften die alten Leute herum, überfordert durch die Anstrengungen, die es sie kostete, die lädierten Körper vom gemütlichen Eigenheimsessel bis in den Sitz des Konzertsaals zu überführen. Theresa hatte es verpasst, die Restauranttoilette aufzusuchen. Sie musste Tantchen auf einer Sitzbank deponieren und sich im Waschraum der Philharmonie anstellen, wo sich vor den Häuseln eine Schlange der von Inkontinenz Geplagten bildete, unter denen schlechte Stimmung herrschte. Besorgte Blicke auf die Uhren.
»Eigentlich bin ich für das Konzert hergekommen und nicht zur Toilettenbesichtigung«, nörgelte Theresa gut vernehmbar. »Können die hier nicht eine angemessene Anzahl an Scheißhäusern bereitstellen?«, fügte sie wütend hinzu. Strafende Blicke trafen sie. In letzter Zeit nahm Theresa gewisse Anzeichen des Tourettesyndroms an sich wahr. Immer häufiger überfiel sie eine unbändige Lust, ausfallend zu werden. Umso mehr, je distinguierter die Szene war. Vielleicht eine Folge ihrer strengen Erziehung. Die adligen Eltern hatten jegliches Fluchen im Keim erstickt. Womöglich drängte jetzt alle aufgestaute Wut aufs Mal aus ihr heraus.
Eine aus der Toilette herausstolpernde Alte rempelte die Kommissarin an und brummte vergrätzt: »Wenn sich hier nicht all die Musikkretins tummelten, müsste man nicht anstehen.«
Sie waren nicht gut drauf, die reichen deutschen Rentner. Manche der älteren Leute hatten diesen Anspruch auf Vorfahrt im Gesichtsausdruck. Hoffentlich verabschiede ich mich von der Welt, bevor ich solche Attitüden annehme, überlegte Theresa. Frühzeitig und mit üblen Flüchen auf den Lippen. Bei dem Gedanken verbesserte sich ihre Laune. Die Chancen, eine seltsame Alte zu werden, standen eh schlecht. Ihre beiden erwachsenen Söhne würden sie zurechtstutzen. Die ließen ihr nichts durchgehen.
Theresa und ihre Tante schafften es kurz vor acht Uhr, die Sitze einzunehmen. Vor dem eigentlichen Konzert begann das Hustenkonzert. Theresa war froh, dass sie den Außenplatz erwischt hatte. Die letzten Ausläufer der Grippewelle schwappten durch die Sitzreihen. Durch die hervorragende Raumakustik war jeder Hustenakkord perfekt zu vernehmen. Auch Damen, die auf dem oberhalb des Konzertsaals liegenden Heinrich-Böll-Platz mit Stöckelschuhen klapperten, hörte man innen ausgezeichnet. Die Geräusche wurden von den schwingenden Trägern in den Konzertsaal übertragen. Während der Aufführungen wurde der Platz deshalb abgesperrt und bewacht, was jährlich etwa 100.000 Euro Kosten verursachte. Seit der Philharmonie-Eröffnung 1986 hatte die Stadt es nicht geschafft, diese Fehlkonstruktion zu korrigieren.
Bei den ersten Takten von Robert Schumann, Ouvertüre, Scherzo von Opus irgendwas, dämmerte Theresa hinweg. Die schlaflosen Nächte, in denen sie sich gefühlt seit 20 Jahren mit Lesen von üblen Gedanken ablenkte, führten dazu, dass sie einnickte, sobald in einem Kino, Theater oder Konzertsaal die Lichter erloschen. Die Londoner Philharmoniker bemühten sich vergeblich, was Theresa anging. Anders als Tantchen hatte die Kommissarin kein fein ausgebildetes Gehör für Musik. Ihr Kopf fiel abrupt nach vorn. Sie erwachte von dem Ruck, blickte verstohlen zu Clarissa hinüber, ob die sie beim Sekundenschlaf erwischt hatte, und dämmerte bei Schumanns sanften Klängen sofort wieder weg. Applaus weckte Theresa. Sie klatschte kräftig mit.
»Ein paar Ungenauigkeiten, aber überwiegend gut gespielt«, kommentierte die Musikkennerin neben ihr.
Als Theresa ihr zustimmte, lachte die Tante und gab ihrer Nichte einen Klaps auf das Knie. »Heuchlerin, du hast durchgeschlummert. Weiterhin diese schlaflosen Nächte?«, fragte die Tante. »Ich mache mir Sorgen um dich.«
»Keine Angst, solange du mich mit ins Konzert nimmst, kann ich den Schlaf ja nachholen. In der zweiten Halbzeit bin ich topfit«, versprach Theresa.
Sie blätterte im Programm: »Piotr Anderszewski, Feingeist und Fabulierer am Klavier ist berühmt für seine Eigensinnigkeit, mit der er die Hörer entzückt, bisweilen auch verstört«, las sie vor. Das Klavierkonzert von Beethoven dudelte an ihr vorbei. Theresa hätte es auch nicht wiedererkannt, wäre es ihr bereits am Vortag vorgespielt worden. Musikalisch brauchte sie stärkere Kost. Strawinskys »Sacre du printemps« wühlte sie auf. Da war sie ganz Ohr und der Körper wollte tanzen. Bei Robert Schumanns Sinfonie Nr. 4 in d-Moll brummte das Handy in ihrer Jackentasche. Sie zog es verstohlen heraus, verdeckte den leuchtenden Bildschirm mit ihrem Schal und sah die Nummer ihres Kollegen Marco Bär, der die Grippe gerade überstanden hatte und wieder einsatzbereit schien.
Sie antwortete per SMS: »Bin im Konzert, was gibt’s?« Die Zuhörer in der Reihe über ihr fingen an zu zischeln. Peinlich. Sie hatte größtes Verständnis, aber die Alternative war, ihren Platz zu verlassen, an allen vorbei die steilen Treppen zu erklimmen, um draußen zu telefonieren. Das Theater wollte sie nicht erleben. Greise Musikliebhaber konnten sehr aggressiv werden.
Bärs Antwort erschien umgehend auf ihrem Bildschirm: »Mordfall!«
»Wo?«
»Friedrich-Schmidt-Str., Ecke Vincenz-Statz-Straße.«
»30 Min.«
Das Zischeln von oben wurde bedrohlich.
Schumann neigte sich dem Ende zu. Noch vor dem Einsetzen des Beifalls keifte die Musikliebhaberin aus der Reihe neun: »Unverschämtheit, das Konzert mit Ihrem Herumgespiele am Handy zu stören.«
Tante Clarissa, die Theresas Notsituation kannte, drehte sich empört um und donnerte der Kritikerin entgegen: »Sie ist bei der Mordkommission, und eines verspreche ich Ihnen, wenn Ihr Mann Sie demnächst umbringt, wird meine Nichte nicht auftauchen.«
»Das kann mir dann ja egal sein«, murrte die Alte und fiel danach in den Applaus ein.
Theresa setzte Tante Clarissa ins Taxi, gab dem Fahrer die Anweisung, die alte Dame bis zu ihrer Haustür zu begleiten, und fuhr danach direkt zum Tatort. Es war kurz nach 21.30 Uhr und kaum Verkehr auf den Straßen. Sie brauchte von der Philharmonie 15 Minuten hinaus nach Lindenthal.
Erinnerungen werden wach
»Schick!«, kommentierte Marco Bär und deutete auf die schwarze Pashmina, die die Kollegin zum blauen Hosenanzug trug.
»Für Beethoven«, lächelte die Kommissarin. »Auch Schumann, glaube ich.«
»Ach – wieder mal im Konzert geschnarcht?«, grinste Bär, der die Schlafprobleme seiner Kollegin kannte.
»Ja, dafür topfit für unseren Toten – oder ist es eine Tote?«
»Ein Toter – er sitzt dort im Wagen.« Bär zeigte auf einen dunkelroten Renault Megane am Straßenrand.
»Wo ist die Kollegin Burrenscheidt?«
»Grippe.«
»Gerade erst bei uns angetreten und gleich mal krank?«
»Karneval!«
»Ich kann’s nicht mehr hören. Karneval – ist das eine Krankheit?« Rosenthal war wütend. Erst feierten die Leute tagelang, und danach kam der Arzt.
Der eher gemütliche, aber sehr akribisch arbeitende Kollege Oliver Korte hatte sie verlassen. Er war nach Bielefeld gegangen. Bielefeld – gab es die Stadt überhaupt? Rosenthal kannte sie nur als Autobahnabfahrt.
»Ich vermisse Korte«, sagte die Kommissarin. »Was macht der bloß in Bielefeld?«
»Ich vermisse Korte auch, aber ich glaube, die Eva ist okay.«
»Eva ist die Burrenscheidt, oder was?«