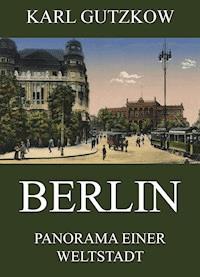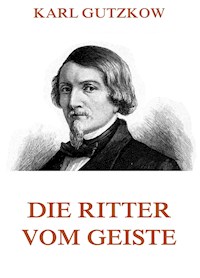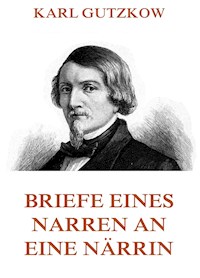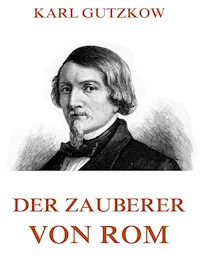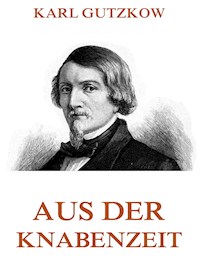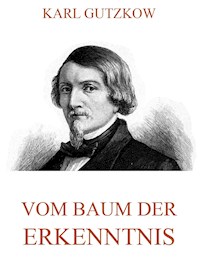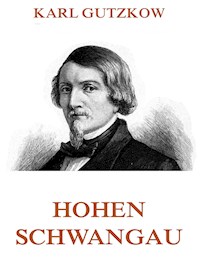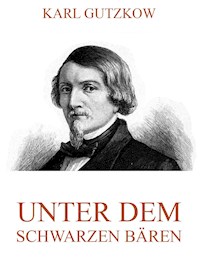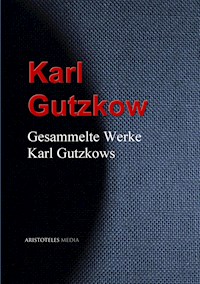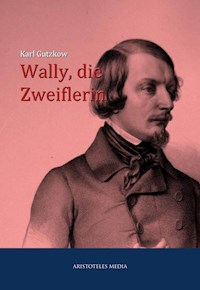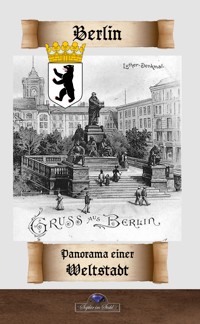
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: historisches Deutschland
- Sprache: Deutsch
Karl Gutzkows Buch 'Berlin - Panorama einer Weltstadt' präsentiert eine detaillierte kulturelle und soziale Analyse der Stadt Berlin im Jahr 1874. Karl Gutzkow sammelte von verschiedenen Autorinnen Texte über Berlin im Großen und Kleinen. Er widmet sich in seinen Beiträgen einer breiten Palette von Themen, darunter Literatur, Kunst, Politik und Soziologie, die er in einem lebendigen und fesselnden Stil präsentiert. Die Schreibweise von Gutzkow ist geprägt von einer tiefen Verwurzelung in der Romantik, die die Atmosphäre der Zeit, in der das Buch geschrieben wurde, widerspiegelt. Gleichzeitig wird die Schriftsprache von 1874 beibehalten, lediglich die neue Rechtschreibung wurde vorsichtig angewandt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 222
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Herausgeber
Erik Schreiber
Historisches Deutschland
Karl Gutzkow
Berlin - Panorama einer Weltstadt
Verlag Saphir im Stahl
e-book 222
Historisches Deutschland 22
Karl Gutzkow - Berlin - Panorama einer Weltstadt (1874)
Erscheinungstermin: 01.02.2024
© Saphir im Stahl
Verlag Erik Schreiber
An der Laut 14
64404 Bickenbach
www.saphir-im-stahl.de
Titelbild: Simon Faulhaber
Lektorat: Peter Heller
Vertrieb: neobooks
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
I. „Weltstadt“-Panorama
Café Stehely (1831)
Cholera in Berlin (1831)
Alte Bauten-neue Bauten (1832)
Dom, Schauspielhaus-“Sechserbrücke“ (1840)
Blumenausstellung in Stralow (1840)
Notizen (1841)
Berlins sittliche Verwahrlosung (1843)
Der Geist der Öffentlichkeit (1844)
Mystères de Berlin? (1844)
Impressionen-z.B.: Borsig (1854)
Quatsch, Kroll und „Satanella“ (1854)
Neues Museum-Schloßkapelle-Bethanien (1854)
Zur Ästhetik des Häßlichen (1873)
II. Für und wider Preußens Politik
Über die historischen Bedingungen einer preußischen Verfassung (1832)
Drei preußische Könige (1840)
Das Barrikadenlied (1848)
Landtag oder Nicht-Landtag (1848)
Preußen und die deutsche Krone (1848)
Abwehr einer Verleumdung (1850)
Varnhagens Tagebücher (1861)
Vorläufiger Abschluß der Varnhagenschen Tagebücher (1862)
III. Drei Berliner Theatergrössen
Ernst Raupach (1840)
Ludwig Tieck und seine Berliner Bühnenexperimente (1843)
Madame Birch-Pfeiffer und die drei Musketiere (1846)
IV. Aus dem literarischen Berlin
Der Sonntagsverein (1833)
Cypressen für Charlotte Stieglitz (1835)
Diese Kritik gehört Bettinen (1843)
Ein preußischer Roman (1849)
Eine nächtliche Unterkunft (1870)
Zum Gedächtnis Wilhelm Härings (Willibald Alexis) (1872)
Lyrisches aus dem Zeitungsviertel (1873)
Louise Mühlbach und die moderne Romanindustrie (1873)
Vorwort
Die Herausgabe der Buchreihe „Historisches Deutschland“ ist ein Projekt, um die Vergangenheit sichtbarer zu machen. Dem Redakteur und dem Herausgeber ist es wichtig, das die Vergangenheit verständlicher zu machen. Indem alte Texte neu herausgegeben werden, kann man die Vergangenheit aus Sicht der damaligen Zeit sehen und verstehen. Es gibt viel zu viele Bücher, in denen aus heutiger Sicht die Vergangenheit erklärt wird. Die dadurch entsehenden Widersprüche können durch Originaltexte geklärt werden.
Gleichzeitig bieten die alten Texte die Möglichkeit, die Entwicklung, z. B. von Orten, darzustellen. Man lernt als Leser die Geschichte eines Ortes und ist in der Lage, die Beschreibung mit dem Zustand des heutigen Ortes zu vergleichen.
Die Texte werden oft aus der Fraktur-Schrift, buchstabengetreu übertragen, wobei die damalige Schriftsprache beibehalten bleibt. Nur offensichtliche Schreibfehler wurden berichtigt.
Damit ist die Buchreihe etwas Besonderes, ebenso wie die e-book-Schwesternreihe „Windrose“, wo alte Reiseberichte veröffentlicht werden.
Als verantwortlicher Redakteur wünsche ich gute Unterhaltung.
Peter Heller
I. „Weltstadt“ Panorama
Café Stehely (1831)
Ob man bei Stehely einen Begriff von der Verberlinerung der Literatur bekommen kann, ganz gewiß, oder man müßte sich täuschen in die der stummen Bewegungssprache, die einen Haufen von Zeitschriften mit wilder Begier und neidischem Blick zusammenträgt, ihn mit der Linken sichert und mit der Rechten eine nach der andern vor die starren, teilnahmslosen Gesichtszüge hält. Die Eisenstange und das Schloß des Journals scheint mit schwerer Gewalt auch seine Zunge zu fesseln, wer würde hier seinen Nachbar auf eine interessante Notiz aufmerksam machen? Ein feindliches Heer könnte eine Meile von Berlin entfernt sein, kein Mensch würde die Geschichte vortragen, man würde auf den Druck warten und auch dann noch ein Exemplar durch aller Hände wandern lassen, fast in der Weise, wie in Stralow die honetten Leute vor jeder lebhafteren Gruppe vorbeigehen mit dem tröstenden Zuruf, man würd' es ja morgen gedruckt lesen.
Stehelys Besucher bilden natürlich zwei Klassen, die Jungen und die Alten, mit der näheren Bezeichnung, daß die Jungen ans Alter, die Alten an die Jugend denken. Jene sind Literaten in der guten Hoffnung, einst sich so zu sehen, wie man jetzt die Klassiker sieht, weihrauchumnebelt; diese sind Beamte, alte Offiziers, die in einem Atem von den politischen Stellungen des preußischen Staats, den Füßen der Elsler, den Koloraturen der Sonntag, dem Spiel der Schechner sprechen! Nichts Unerbaulicheres! Vor dem Gespräch dieser alten Gecken möchte man sich die Ohren zuhalten, oder in die einsamere Klause des letzten Zimmers flüchten. Schon wenn sie angestiegen kommen, zumal jetzt im Winter; diese dummen, loyalen Gesichter, diese Socken und Pelzschuhe, deren Tritt nicht das leiseste Ohr erspähen könnte. Triumphierend rufen sie um die „Staatszeitung“, forschen nach den privatoffiziellen Erklärungen eines H., v. R., v. Wsn. Hierauf lesen sie die Berliner Korrespondenzen in der „Allgemeinen Zeitung“, die ja wohl der Ausdruck der Berliner öffentlichen Meinung, als wenn es eine solche gäbe, sein sollen, und wenn sie sich dann noch an den logischen Demonstrationen der Mitteilungen aus der „Posener Zeitung“ gestärkt haben, fallen sie übers Theater her und man muß sie verlassen. Ihnen am nächsten stehen einige langgestreckte Gardeleutnants und Referendare, die sich dadurch unterscheiden, daß die einen viel sprechen und wenig denken, die andern wenig denken und viel sprechen. Diese geben den Übergang zu den schon vorhin bezeichneten Jüngeren, auf die wir unten des breiteren zurückkommen müssen.
Es fehlt hier also durchaus nicht an den Mitteln und Elementen, sich ein Bild der Berlinerei vorzuführen. Man verlasse das Lokal und bei jeder Aussicht wird man für sein Bild noch immer treffendere und bezeichnendere Züge finden. Sogleich die Ansicht einer Kirche, die außerdem, daß sie eine Kirche ist, auch keine ist. Wie ein Luftball, der unten einen Fallschirm zur Sicherheit trägt, erhebt sich die stolze Vorderseite dieses Domes, leere Steinmassen und hohler Prunk, und hinten dann das geschmackloseste Anhängsel einer kappenförmigen Kuppel, die doch das Wahre an dem ganzen Lärm ist in ihrer sonntäglichen Bestimmung. Wiederum vom Opernplatz aus furchtbare Steinmassen, Urkunden des Ungeschmacks aus dem 16ten und 17ten Säkulum, Hunderte von Fenstern erinnern an die Zeiten der Aufklärung und der Illuminaten, die kahlen Kulturversuche finden sich wieder in diesen leeren Wänden, die sich ohne Unterbrechung 80-90 Fuß in die Höhe glätten. Gilt dies freilich mehr gegen eine vergangene Zeit, so hält es doch nicht schwer, das alles wiederzufinden in der Galanteriewarenmanier der neuesten Bauten, wo der Ernst nur ein übertünchter ist ...
Cholera in Berlin (1831)
... Im gegenwärtigen Augenblick beschäftigt uns am meisten die seit dem ersten d. M. hier wirklich angekommene Cholera: Auf der Frankfurter Journalière erwartet und auf die Kontumazanstalt verwiesen, hat sie einen anderen Weg genommen, durch den Finowkanal. Die näheren Umstände des ersten Cholerafalles sind in der Tat tragikomisch, der Schluß fast balladenartig. An die Möglichkeit, daß die Cholera nach Charlottenburg (eine halbe Meile von Berlin) käme, hatte man nicht gedacht, der Hof hatte sich im dortigen Schlosse absperren wollen und eine Anzahl Proviantwagen war schon dahin abgegangen. Da erscholl plötzlich von dorther die Kunde von einem an der Cholera gestorbenen Schiffer. Polizeibeamte und die wachslinnenen, steifen Harnischmänner, die zur Wartung der Cholerakranken eigens errichtete Garde, eilen hinaus und in dem stolzen Bewußtsein, im Kampfe die ersten zu sein, tun sie sich ein wenig zu Gute. Der Tote wird eingesargt, und des Nachts sollen ihn die Wärter auf einem Kahne vom Schiffe abholen; doch am andern Morgen erfuhr man, daß bis auf einen ans Ufer getriebenen Mann alle untergegangen, und die Fischer bei Spandau einen Sarg im Netze gefangen hatten. Da nun dieser mit der Spree in Berührung gekommen ist, will man weder Fische noch Krebse essen. Jene Proviantwagen sind auch wieder zurückgekehrt, und soviel man weiß, wird sich der König auf die Pfaueninsel bei Potsdam begeben.
Der erste Erkrankungsfall in Berlin selbst war der eines Schiffers, gerade in der Mitte der Stadt. Bis jetzt sollen 29 erkrankt und 21 gestorben sein. Man klagt über die Mutlosigkeit und Unbeholfenheit der hiesigen Ärzte: Wir hatten gehofft, erfahrene Männer aus den infizierten Gegenden hieher gezogen zu sehen; doch ist von einer solchen Sorgfalt noch nichts bekannt geworden. Die öffentliche Stimmung ist bis jetzt noch so ziemlich gemäßigt, doch sind Vergnügungsörter gegenwärtig weniger besucht, und das Raffen nach Präservativen, Leibbinden, Harzpflastern ist allgemein; Dienstboten werden entlassen, manche Nahrungszweige stocken gänzlich. Es lassen sich die Folgen des kommenden Elends noch nicht berechnen.
Alte Bauten, neue Bauten (1832)
... In den langweiligen Zeiten der Restauration, vor den militärischen Rüstungen und den Verheerungen der Cholera, waren die Kassen des Staats reicher gefüllt als gegenwärtig. Berlin war in zunehmender Verschönerung begriffen; die Aufführung vieler öffentlicher Gebäude ließ ebensosehr den Geschmack bewundern, in dem sie angelegt und vollendet wurden, als die Vorsicht loben, die einem großen Teile unserer Proletairs eine reichliche Nahrungsquelle sicherte. Diese Baulust ging damals auch auf Privatleute über, deren Geld und Unternehmungsgeist Berlin um ein prachtvoll gebautes Stadtquartier vergrößerte. Aber auch von dieser Seite stehen alle Plane gegenwärtig still. Die beiden öffentlichen Bauten, an die in diesem Augenblick allein gedacht wird, sind die völlige Umgestaltung des sogenannten Packhofes, eines Stapelplatzes und Warenlagers für die ankommenden Kaufmannsgüter, und ein künftiger Neubau der Bauakademie. Wer in Berlin gewesen ist, weiß, daß er, um vom Schloßplatze nach der Jägerstraße zu kommen, sich durch die lebhafteste, aber zugleich auch engste Passage, die Werderschen Mühlen, die Schleusenbrücken, die Verbindung unserer Alt- und Neustadt, durchwinden muß. Später wird diese unbequeme Gegend gelichtet werden. Dicht an der genannten Brücke wird rechts ein freier Platz beginnen, der die Aussicht nach dem Packhofgebäude und der Werderschen Kirche frei macht. Gewinnen werden bei einem solchen Projekt die Besitzer jenes Häuserwinkels von der Niederlagstraße bis zur Brücke, verlieren aber muß die kleine, winzige Werdersche Kirche, deren Unbedeutendheit bei einer großartigern und freiern Umgebung nur deutlicher hervortreten wird.
Der Bau der obengenannten Akademie hat noch nicht begonnen, aber es kann auch noch lang mit ihm anstehen, da der gegenwärtige Zustand dieses Instituts einen so bedeutenden Kostenaufwand nicht vergilt. Diese einst so blühende Anstalt ist gegenwärtig durch die Eröffnung neuer Provinzialbauschulen und die Gewerbeakademie, die sich unter der Leitung des Hrn. Beuth, unsers künftigen Handels- und Gewerbeministers, immer mehr hebt, in die tiefste Zerrüttung gesunken, so daß die Zahl der an ihr angestellten Lehrer der der Schüler gleichkommen mag. Darum bleibt vielleicht dieses Bauprojekt einstweilen noch unausgeführt ...
Dom, Schauspielhaus „Sechserbrücke“ (1840)
Von meiner Wohnung aus ist mir ein Blick auf die Umgebungen des Schlosses gewährt, auf eine Überfülle von großen Gebäuden, die die Gegend von dem Anfang der Linden bis zum Dom zu einem der merkwürdigsten Plätze Europas machen. Störten mich nur nicht am Dom die beiden Zwillingsableger des großen Turms! Neben einer großen Kuppel, die schon an sich unwesentlich ist, da sie für das Innere der Kirche gar keinen Wert hat, sondern nur als bloße architektonische Verzierung dient, haben sich noch zwei kleine Schwalbennester wie zwei Major-Epauletts niedergelassen. Man hatte dabei wahrscheinlich die Isaakskirche in Petersburg vor Augen; aber dort gehören diese kleinen Türme zum Kultus, indem sie auf einzelne Kapellen Licht fallen lassen, sie sind so zahlreich bei den russischen Kirchen angebracht, daß sie schon dadurch etwas für die dortige heilige Architektur Wesentliches vorstellen. Hier in Berlin, wo man so viel Russisches in der Politik und den Militäruniformen nachahmte, wollte man auch der Hauptkirche der Stadt eine russische Perspektive geben und Schinkel war schwach genug, die beiden kleinen Vogelbauer neben den größern Turm der Kirche zwecklos und unschön hinzustellen. Überhaupt würden die Gebäude der Residenz mehr künstlerischen Wert haben, wenn Schinkel, ein so reicher, erfinderischer, sinniger Kopf, jenen echten Künstlerstolz besäße, der ihn verhindert hätte, Änderungen seiner ursprünglichen Baupläne hinzunehmen. Eine höhere Hand, deren Munifizenz allerdings ruhmvoll anerkannt werden muß, strich ihm bei vielen seiner vorgelegten Baupläne meist immer das Charakteristische und Kecke weg. Alles Hohe, Hinausspringende, Hinausragende (z.B. dreist aufschießende Türme an den Kirchen) wird von einem an sich ganz achtbaren, aber in Kunstsachen unbequemen Sinn für das Bequeme, Bescheidene, Zurückhaltende weggewünscht. Es ist nicht rühmlich für Schinkel, daß er bei seinen zahlreichen Baugrundrissen dem Künstlerstolz so viel vergeben hat.
Schinkel hat in seinen geistvoll geschriebenen Erläuterungen zu seinen Bauten auch alle die Umstände angeführt, die ihn bewogen, dem Schauspielhause seine jetzige Gestalt zu geben. Wenn an einem öffentlichen Gebäude die Fassade nicht einmal als Ein- und Ausgang benutzt wird, wenn man auf einer großen Freitreppe Gras wachsen sieht, so regt sich unwillkürlich das Gefühl, das Unbenutzte auch für eine Überladung zu halten. Doch mögen die Kenner über den äußern architektonischen Wert des Schauspielhauses entscheiden! Das Innere dieses Theaters, wiederum nicht ausgehend von der speziellen Ansicht Schinkels, hat ganz jenen gedrückten Miniatur- und Privatcharakter, den ein Haus, das früher Nationaltheater hieß, nicht haben sollte. Es wäre vielleicht nicht nötig gewesen, dies Theater größer, als für 1200 Menschen zu bauen; aber warum dieser wunderliche Charakter der Isolierung in der Anlage des Ganzen? Ein Rang ist dem andern unsichtbar. Das Parterre und die Parkettlogen sehen nichts von den Rängen. Man weiß an einer Stelle des Hauses nicht, ob es an der andern besetzt ist. Eine Übersicht des Ganzen ist nur auf dem Proszenium und Podium möglich, so daß man, um zu wissen, ob das Haus besetzt war, die Schauspieler fragen muß. Jedenfalls geht durch dieses Privatliche, das dem Hause aufgedrückt ist, zweierlei verloren. Einmal eine größere gesellschaftliche Annehmlichkeit. Da sich das ganze Publikum nicht beisammen sieht, da der eine dem Auge des andern entzogen ist, so fällt der Charakter einer geselligen Zusammenkunft, der so oft für eine schlechte Vorstellung Ersatz geben könnte, in diesem Theater gänzlich weg. Man kann Bruder und Schwester im Theater haben und sieht sie nicht. Das zweite Unangenehme dieser winkeligen Bauart ist, daß sich das Publikum nicht als solches bildet. Publikum heißt eine Masse, die sich ihrer Kraft ansichtig ist und das Bewußtsein einer Korporation dem Spiel gegenüber zu behaupten weiß. Wo man im Parterre nicht sehen kann, welche Mienen der zweite Rang macht, wo ein Besucher des Theaters nur immer auf den Rücken des andern angewiesen ist, da kann auch keine Totalität des Urteils stattfinden; jeder ist auf sich angewiesen und der Schauspieler bleibt ohne die richtige Würdigung seiner Leistung. Mir haben viele Schauspieler gesagt, daß Berlin kein Publikum mehr hat. Der Grund liegt darin, daß die Lokalität dieses Publikum verhindert, sich als solches kennenzulernen und auszubilden ...
Noch eine Bemerkung will ich hier machen. Von meinem Gasthofe führt eine Brücke auf den Schloßplatz. Diese Passage ist nur für ein kleines Brückengeld gestattet, welches von einer Gesellschaft, die diese Verbindung auf eigene Kosten anlegte, erhoben wird. Jeder Bürgerliche zahlt am Ende der Brücke eine Kleinigkeit. Das Militär ist frei. Warum? Ich denke, weil die gemeinen Soldaten in Berlin herumzuschlendern pflegen und von der Bedeutung dieses Brückengeldes schwerlich eine Vorstellung haben. Es würde ein ewiges Zurückweisen sein, Händel geben und deshalb läßt man Soldaten frei passieren. Wie aber nun die Offiziere? Wird man nicht annehmen, daß diese eine so kleine Vergünstigung verschmähen und mit echtem point d'honneur da nicht frei vorübergehen werden, wo eben eine arme alte Frau oder ein Handwerker seinen Sechser bezahlt? Nein, ein General geht mit einem Bürgerlichen hinüber: Der Bürgerliche bezahlt, der General nicht. Ich denke nun jeden Morgen und Abend nach, wie ein so achtbarer, auf das Feinste seines Ehrgefühls wahrender Stand, das preußische Garde-Offizier-Korps, sich daran gewöhnen kann, von einer winzigen Steuer, die ihm allerdings erlassen ist, sich so loszusagen, daß er in der Tat von jener Vergünstigung Gebrauch macht. Wär' ich Offizier, ich würde es für beleidigend halten, wollte man mir zumuten, von einer Steuer dieser Art, die den Ärmsten trifft, mich zu befreien.
Ich schließe daraus, wie wenig das, was wir Ehre nennen, doch als etwas Ursprüngliches im Menschen ausgebildet ist; denn sehen wir hier nicht, daß eine in diesem Punkte sehr zartfühlende Menschenklasse dennoch in einer Ehrensache ganz von der Sitte und der Gewöhnung abhängen kann und wie leicht wir über etwas, das sich der Einzelne nicht gestatten würde, hinweggehen, wenn es von allen angenommen wird?
Blumenausstellung in Stralow (1840)
Was rennt das Volk? Was strömt es durch die Gassen? Alles eilt hinaus in die Gegend des lieblichen Stralow: In die Blumenausstellung, nach dem Hyazinthen-Flor. Eine halbe Stunde mußt' ich mit meinem Wagen Queue machen, eh' ich vor dem Eingang zu Faust und Moewes aussteigen konnte. Schon aus weiter Entfernung, mehre Straßen vorher, riecht man die von Hyazinthen parfümierte Luft. Tausende von Menschen drängen sich in großen, feldähnlichen Gärten und bewundern ungeheure Anlagen von Hyazinthenbeeten, die auf den Effekt hin gepflanzt sind, sich in den buntesten Schattierungen ablösen, ja sogar große, riesige Figuren zu bilden, z.B. einen Floratempel, ein „eisernes Kreuz“ und dergleichen Zusammenstellungen. In Harlem können nicht größere Blumenmassen beisammenstehen. Indessen gerade dies Holländische ist abstoßend. Man wird gegen den Reiz der Blumen unempfindlich, wenn man sie in Massen versammelt sieht. Nun gar zur Bildung von allerhand Symbolen mißbraucht, hat die Blume nur noch den Wert der Farbe, und das Freie, Selbständige, das Duftige derselben geht mit dieser Bestimmung verloren.
Hier sind meine Berliner recht in ihrem Element. Eine Anlage ohne Schatten schreckt sie bei der glühendsten Hitze nicht ab. Ein dumpfes Musikgedudel nennen sie musikalische Unterhaltung. Vorn an der Kasse zieht man ein Los, zahlt dafür 5 Silbergroschen und gewinnt gewöhnlich nur einen Strauß, den man auf dem Gendarmenmarkt für 4 Pfennige kauft. Was ließe sich unter dem Titel „Die Blumenverlosung“ nicht für eine hübsche Lokalposse schreiben. Hier laufen in Berlin soviel „volkswitzige“ Schriftsteller herum, warum erfinden diese Leute nicht dergleichen Späße für die Königsstädter Bühne? Herr Glaßbrenner schreibt kleine Broschüren, worin er Berliner sogenannte Volkscharaktere sich im geschraubtesten und gemeinsten Berliner Jargon über das Hundertste und Tausendste unterhalten läßt; nein; auf der Bühne, im sinnigen Arrangement solcher Lokalscherze bewährt sich der Beruf zum Volksschriftsteller. Beckmann z.B. ist ein so willkommnes Menschengerüst, auf welches man die drolligsten Erfindungen hängen kann. In der Blumenverlosung denk ich mir ihn mit der grünen Gärtnerschürze am Eingang eines Treibhauses und die Gewinste austeilend. Er entfaltet die Nummer: „Sie erhalten, Madame, einen kleinen Ableger einer neuerfundenen Pflanze, die erst kürzlich auf der Pfaueninsel entdeckt und aus Amerika hier eingeführt wurde.“ Die Dame sagt: „Mein Gott, das ist ja nichts als eine Maiblume mit einem Salatblatt.“ Darauf müßte Beckmann replizieren und seine botanischen Kenntnisse entwickeln. Zum Schluß könnte durch die Blume noch eine Heirat zustande kommen. Warum schreibt Herr Cerf keine Konkurrenzpreise aus?
Notizen (1841)
Ein Pietist Unter den Linden
Nach einigen sehr staubigen, schwülen Tagen hatte es endlich geregnet. Der schönste Sonntagmorgen lockte unabsehbare Menschenscharen unter die Linden. Am Palais des verstorbenen Königs tritt mich ein Mann mit einem Orden im Knopfloche an: „Schönes Wetter.“ „Schönes Wetter.“ „Das macht Gott mit einem Wort. Unser Menschenwitz hätte das nicht machen können.“ „Schwerlich.“ „Und der Herr ist allerwegs mächtig und groß ist sein Name, ja groß in Ewigkeit.“ „Amen!“ Der Fremde begann hierauf mit kräftiger Stimme und vielem Redetalent eine Auseinandersetzung über die angeborne Sündhaftigkeit des Menschen. Da ich ruhig und fast teilnahmslos neben dem mir gänzlich unbekannten Manne herging, frug er mich mit fast zorniger Ungeduld: „Ich weiß nicht, ob Sie mich verstehen?“ „Vollkommen!“ „Halten Sie mich für einen Schwärmer?“ „Ich höre den Lärm, sehe aber kein Licht.“ Diese Antwort von dem schlichten Spaziergänger war dem Bekehrer unerwartet. Er sah mich groß an und ging. Zu Hause fand ich in der Rocktasche einen Bußtraktat. (Gedruckt bei Wohlgemuth.)
Die Kandidaten der vakanten Ämter
Einen rührend-komischen Anblick gewährt an jedem Morgen in den ersten Frühstunden ein Spaziergang durch die oberen Linden und die Wilhelmstraße bis zur Leipziger Straße hin. Das ist nämlich die Zeit, wo die Kandidaten aller vakanten und nicht vakanten Ämter, die Kandidaten aus allen möglichen geistlichen, Schul-, Justiz- und Regierungsfächern den mächtigen Ministern und Räten ihre Aufwartung machen. Schwarz gekleidet, mit weißer Binde um den Hals, schießen sie an dir vorüber, plötzlich stehen sie still, überlegen eine erhaltene Antwort oder ein zu stellendes Gesuch, probieren die eingelernte Rede noch einmal, nähern sich der verhängnisvollen Tür, haben nicht das Herz, kehren noch einmal um, um sich zu erholen, und wagen es erst dann mit einem mutigen Entschluß. Andere wollen eben von der Rechten an die Tür eines Hotels treten, da begegnet ihnen ein anderer von der Linken. Und doch ist nur eine Stelle vakant! Jeder bildet sich ein, so früh zu kommen, daß er den mächtigen Mann, der sie vergibt, allein trifft, aber, entsetzliche Täuschung, schon ist das ganze Vorzimmer gefüllt und die eine Lebensfrage, auf deren Lösung eine seit sieben Jahren verlobte Braut und ein nachgerade ungeduldig werdendes Schwiegerelternpaar harrt, verschwimmt in den Lebensfragen von dreißig anderen Menschen, in den Hoffnungen von ebensoviel anderweitigen Bräuten! Geöffnet ist hier die geheime Werkstatt unserer Existenz, offen liegen sie da, die Gruben und Gänge, die der Fuchs oft schneller durchgräbt, als der still arbeitende Bergmann--ein Anblick, zugleich komisch und zum Weinen!
Sommertheater in Steglitz
Wie weit bleibt das Sommertheater in Steglitz hinter den Anpreisungen der Journale und den mäßigsten Erwartungen zurück! Ref. hoffte, ein niedliches, von Holz und Backsteinen aufgeführtes, der Würde Berlins entsprechendes Theater zu finden und fand eine Bretterbude, nicht besser als eine Scheune, mit langen hölzernen Bänken und einem Rang, der nichts als eine Galeriebrüstung ist. Die Hitze in dem kleinen Raume ist unerträglich und verläßt man ihn, so wandelt man, wilden Tieren gleich, in einem abgeschlossenen sandigen Vorplatze umher, nichts sehend als Luft und Fläche. Wer dies Theater einmal gesehen hat, besucht es nicht wieder. Wenn hier eine Befriedigung der Schaulust geschaffen werden sollte, so hätte man etwas geben sollen nach dem Vorbilde des Hamburger Tivoli. Ein Sommertheater ist nur unter freiem Himmel genießbar oder es sei denn, daß ein steinerner Bau die ersehnte Kühlung spendet. Daß eine so armselige Umgebung nur nachteilig auf das Interesse wirken kann, welches die Schauspieler selbst in Anspruch nehmen, versteht sich von selbst. Sie werden vom Publikum verspottet, ihr Ernst wird ironisiert.
Berliner Volkscharakter
Berlin macht von Jahr zu Jahr bedeutendere Fortschritte nach dem Ziele einer seinem äußern Umfange auch innerlich entsprechenden Großstädtigkeit. Anlagen jeder Art, merkantilische, industrielle, gesellige, werden in größerem Stile als früher ausgeführt. Manches, was noch vor drei Jahren das hiesige Publikum beschäftigen konnte, wird jetzt verachtet, z.B. die Trivialität der sogenannten Berliner Volksliteratur, die in „Herrn Buffey auf der Kunstausstellung“ den Gipfel des Unsinns und der widerlichsten Geschmacklosigkeit erreicht hatte. Die Königstädtschen Theaterwitze sind im Abnehmen und aus der lügenhaften Verballhornisierung des Berliner Volks-Charakters, wie dieser sich in „Berlin, wie es ißt und trinkt“ gezeichnet findet, tritt allmählich wieder das ursprüngliche Grundelement des Berliners heraus: Harmloseste Gutmütigkeit, Freude am neckenden, geselligen Scherz, hohe Achtung vor jeder geistigen Auszeichnung, sinniger Genuß der sparsamen, aber oft anmutigen Schönheiten, die die Natur, im Bund mit der Kunst, dieser gewiß noch einer bedeutenden Zukunft entgegensehenden Hauptstadt geschenkt hat.
Berlins sittliche Verwahrlosung (1843)
Im vergangenen Winter brachte jeder Tag die Kunde eines neuen, in Berlin verübten Diebstahls. Die dortigen Zeitungen machen aus dem ungesicherten Zustand der Hauptstadt kein Geheimnis mehr. Die Berliner Diebe erfreuen sich einer so originellen Organisation, daß die Polizei manchen Bewohnern anzeigen kann, sie würden in kurzem bestohlen werden. Vierzehn Tage wachen die Gewarnten: Am fünfzehnten wird richtig bei ihnen eingebrochen. Ein Artikel der „Vossischen Zeitung“ erzählt, daß nachts in den besuchtesten Straßen durch Leiteranlegung sogar die Beletagen bestohlen werden. Wenn man diese sich täglich wiederholenden kriminalgerichtlichen Anzeigen liest, muß man glauben, Berlin würde zum großen Teil von einer ungebesserten Verbrecherkolonie bewohnt.
Ehe man aus diesem Gefühl gänzlicher Unsicherheit, das gegenwärtig in Berlin allgemein herrschen soll, einen Schluß auf die sittlichen Zustände der norddeutschen Hauptstadt macht, muß man so gerecht sein, einige Umstände mit anzuschlagen, die in Berlin dem Diebswesen ganz besonders zu Hilfe kommen. Geboren in Berlin und selbst einmal durch Einbruch dort bestohlen, glaub' ich über diesen Gegenstand, der nachgerade die Aufmerksamkeit jedes Sitten- und Volksfreundes beschäftigen muß, eine Stimme zu haben.
Den Diebstahl erleichtert in Berlin der Mangel an Aufsicht und die Einrichtung der Häuser. Die Zahl der Nachtwächter ist viel zu klein. Diese „Schnurren“ sind alte ausgediente Militärs oder sonstige Exspektanten, die aus Verzweiflung einen Dienst ergreifen, den sie fast nur pro forma versehen. Die Nachtwächter in Berlin sind oft hinfällige Greise. Mit einem spärlichen Gehalt versehen, sind sie auf die Sporteln ihres Dienstes angewiesen. Diese bestehen in den Erträgnissen eines Privilegiums, das man in fremden Städten kaum für möglich halten möchte. Der Berliner Nachtwächter hat ein Bund von hundert Hausschlüsseln am Leib hängen und schließt jedem auf, der des Abends nach zehn Uhr in das erste beste Haus einzutreten wünscht. Die Trinkgelder sind seine Revenuen. Man sieht, daß es die Diebe an keinem Ort der Welt so bequem haben, als in Berlin.
Das Revier des Nachtwächters ist zu geräumig. Er hat mehr Straßen unter sich, als er beaufsichtigen kann. Mit seinen Trinkgeldern beschäftigt, kümmert ihn das Straßenleben sehr wenig. Er horcht nur, daß man ihn ruft, um in ein Haus eingelassen zu werden. Gegen Morgen weckt er die Bäcker, die Brot zu backen haben. Die Rundgänge durch die Straßen werden ohne Aufmerksamkeit abgemacht. Der schützende „Kellerhals“, hinter dem er ausruht, ist sein bequemer Sorgenstuhl. Macht er seinen Rundgang, so kündigt ihn seine Pfeife schon an und die Diebe haben Zeit, sich während seines Vorübergehens zu zerstreuen.
Berlin muß die Zahl der Wächter verdreifachen und sie unter eine militärische Disziplin stellen wie Hamburg. Die Hamburger Wächter sind eine wirkliche Schutzwache gegen die Feinde der Ordnung und des Eigentums.
Hat man schon aus dem Vorigen gesehen, daß die Berliner Häuser sich des Nachts jedem beliebigen Besucher öffnen, so ist der Hausfriede am Tage nicht gesicherter. In Paris hört man viel von Betrügereien in den Kaufläden, von Betrügereien in hunderterlei Manieren, wie sie Vidocq in seinem Lexikon aufführt, aber wenig von Diebstahl oder gar nächtlichem Einbruch. Berlin ist eine große Stadt geworden und war ursprünglich nur auf eine Mitte1stadt angelegt. Die Straßen sind weitläufig, die Reviere entlegen, die Häuser sind meist zweistöckig und nur von einigen Familien bewohnt. Das Institut des Portiers (Hausmeister in Wien) kennt man nicht, da dafür die Häuser zu klein sind. Hier gibt es keine Kontrolle der Ein- und Ausgehenden. Jeder Hof ist frei, jede Treppe den Bettlern zugänglich. Den ganzen Tag reißt das Klopfen und Klingeln nicht ab. Jeder Mieter ist froh, sich auf seine Zimmer abschließen zu dürfen und kümmert sich nicht um den Nachbar, bei dem man, während nebenan Gesellschaft ist, alles ausräumen kann. Während mir vor Jahren in Berlin mein ganzes Zimmer ausgeräumt wurde, saß meine Wirtin ruhig im Zimmer nebenan, las den „Beobachter an der Spree“ und strickte Strümpfe.
Läßt sich nun auch hierin, da Berlin nicht umgebaut werden kann, keine Veränderung treffen, so wird doch darum die erhöhte Wachsamkeit der Behörden um so dringender. Ohne eine neue Wächter- und Patrouillen-Organisation wird in Berlin die Gefahr des Eigentums immer mehr zunehmen.
Dieser Gegenstand läßt aber noch tiefere Betrachtungen zu. Ist in Berlin den Dieben ihr Handwerk erleichtert, wo kommen all die Diebe her? Woher diese sittliche Verwahrlosung, von der wir tägliche Belege erfahren? Woher gerade in Berlin diese immer mehr zunehmende Verworfenheit? Harun Al Raschid, der verkleidet des Nachts durch die Straßen ging, Harun Al Raschid würde darüber sehr tief nachgedacht haben, wenn er diese Beobachtung an Bagdad gemacht hätte.