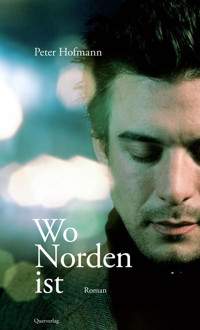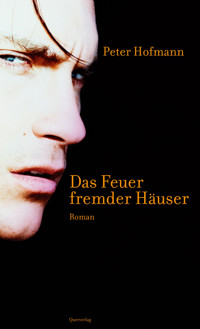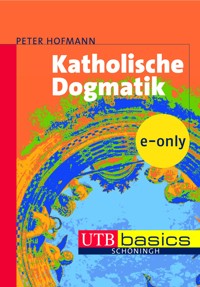Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Querverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wir sind alle auf der Suche nach der "großen Liebe". Aber gibt es sie überhaupt, und woher wissen wir es, wenn wir dem "Richtigen" begegnen? Am Anfang dieser Liebesgeschichte zweifelt der Erzähler grundsätzlich an seiner Fähigkeit zu lieben, doch dann begegnet er dem Mann, auf den er solange gewartet hat. Der Tanz einer beginnenden Beziehung bahnt sich an: Verliebtheit, Sex, Sehnsucht nach Nähe, Zukunftspläne. Die ersten Konflikte, ein gemeinsamer Urlaub und ein Tauziehen widersprüchlicher Gefühle. Peter Hofmann ist mit Berlinsolo ein Roman-Debüt gelungen, das präzise und filigran das Lebensgefühl der schwulen Generation beschreibt, die nicht mehr jung, aber längst noch nicht alt ist, einer Generation, in der emotionaler Realismus herrscht, aber dennoch - oder gerade deswegen - die Sehnsucht nach Geborgenheit immer größer wird.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 325
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
To melt your icy blue heart
Should I start?
To turn what’s been frozen for years
Into a river of tears.
Emmylou Harris
Handlung und Personen sind frei erfunden. Jede Ähnlichkeit mit tatsächlichen Ereignissen oder Personen wäre rein zufällig.
Erste Auflage der Printausgabe September 2000
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Umschlag und grafische Realisierung von Sergio Vitale unter Verwendung eines Fotos von Tiziano Bedin.
ISBN 978-3-89656-559-4
Bitte fordern Sie unser Gesamtverzeichnis an:
Querverlag GmbH
Akazienstraße 25, 10823 Berlin
www.querverlag.de
Kapitel 1
Es ist mein erstes Internet-Date in einem Restaurant, ich weiß nicht, was ich anziehen soll. Er ist Journalist, er ist vierzig, das heißt, er ist gerade vierzig geworden, was man dem Bild, das er mir als Datei geschickt hat, nicht ansieht.
Mitte Dreißig hätte ich ihn geschätzt, aber er gab sofort zu, so alt zu sein. Es scheint, er kommt gut damit klar. Das gefällt mir. Ich habe mir das Bild lange angesehen, habe es vergrößert und verkleinert, versucht es heller zu machen, denn seine rechte Gesichtshälfte ist sehr schattig auf dem Bild. Es zeigt ihn nur bis zur Brust; er trägt ein Sakko mit Hemd darunter. Er lächelt. Er blickt den Betrachter an und zeigt etwas von seinen Zähnen. Ich habe es umgewandelt in Schwarzweiß, dann aber wieder die Farbe angeklickt. Er sieht so oder so gut aus. Bei dreihundertprozentiger Vergrößerung verschwimmt er, löst sich in farbige Vierecke auf. Er ist attraktiv, auch als Bleistiftskizze oder als Relief, gespiegelt oder auf den Kopf gestellt. Er sieht noch immer gut aus, als ich auf Schließen klicke und der Computer mich fragt: Sollen die Änderungen in ICH2 gespeichert werden?
Nein. Nein, ich will ihn so behalten, wie er ist. Möglicherweise werde ich das Bild noch heute abend in den Papierkorb schieben, den ich dann in ein paar Tagen leeren werde. Dort liegen schon viele Bilder. Ein steifer Schwanz aus Hamburg; ein Gesicht mit Balken über den Augen aus Berlin-Spandau, der aus Cottbus steht an seinem Auto, mit heruntergelassener Hose zeigt er seinen Arsch und zieht ihn mit beiden Händen auseinander. Ein Pärchen aus NRW sitzt in den Dünen. Sie lächeln, halten sich im Arm; ein anderes Bild zeigt ihre Unterleiber, einmal schlaff, einmal erregt. Ein anderer Berliner sitzt in einem Biergarten und hebt gerade ein großes Glas Bier, prostet lachend der Kamera zu. Der Dessauer hat sich auf dem Balkon knipsen lassen. Er trägt Shorts und hat seine Hände in die Lycra-Hosen gesteckt. Dann ist da noch einer aus Magdeburg, der ein Bild sendete, das einen amerikanischen Porno-Helden zeigt.
Ich muß den Papierkorb leeren. Es sind die Pics der flüchtigen Chats. Die anderen sind auf der Festplatte unter „Download“ zu finden.
Ihn habe ich unter „Eigene Dateien“ abgelegt, dort sind auch Photos von mir gespeichert. Ich habe keines, das mich nackt zeigt oder in Unterhose, weder meinen Schwanz noch meinen Hintern habe ich eingescannt.
Ihm schickte ich das Bild, das Michael im Park von mir gemacht hat. Michael wohnt in Hamburg und ist Photograph. Es sind schöne Fotos. Sie sind ruhig und sehen aus wie Herbst.
Ich habe mich lange nicht auf Bildern gesehen. Das schönste Bild, mein Gesicht, das ich an den Stamm einer Buche lehne, habe ich ihm geschickt. Ich habe es in Schwarzweiß abgespeichert. Michael will mir noch einen Abzug davon anfertigen.
Ich klicke abermals auf ICH2 und sehe ihn mir an. Es ist kurz nach sieben; in zehn Minuten muß ich losfahren. Wir sind um acht im Arco verabredet. Er mag italienisches Essen und hat dieses Lokal empfohlen.
Es war erst gestern, daß wir uns online kennengelernt haben. Wir haben zunächst Telegramme geschickt, er hat damit begonnen, denn ihm gefiel mein Motto im AOL-Profil: Is that a gun in your pocket…?
Was soll man unter „Persönliches Motto“ auch schreiben? Vielleicht „Carpe diem“, „Quo vadis“ oder „Mein rechter, rechter Platz ist leer“?
„Die gute alte Mae West“, schrieb er und machte den Anfang. Er fragte dann nicht nach meiner Lust oder nach der Größe meiner Genitalien. Er tat weder so, als suchte er etwas Schnelles für den Abend, noch spickte er seine Sätze mit Anzüglichkeiten.
Wir tauschten unsere Bilder per e-mail. Danach telefonierten wir. Und heute sind wir verabredet.
Ich habe mich für ein schwarzes T-Shirt und das dunkle Sakko entschieden. Es ist ein teures Sakko, aber es ist unauffällig, und ich finde mich darin auffällig elegant, aber nicht aufdringlich.
Ich habe keine Lust mehr auf abgewetzte Lederjacken und Basecaps. Ausgerissene Jeans mit Tüchern in der linken oder rechten Gesäßtasche trug ich noch nie. Meinen Ohrring, eine silberne Kreole, habe ich schon vor Jahren abgemacht. Es sah aus, als hätte ich einen Fremdkörper am Ohr, der dort hängt, als hätte ihn jemand vergessen. Seither trage ich nur noch eine Armbanduhr. Es muß reichen, denke ich. Obwohl ich nicht verbergen will, daß ich schwul bin. Ich mag keine Verkleidung tragen. Manchmal beneide ich die, die es tun und sich wohl dabei fühlen. Ich kann es nicht mehr.
Vielleicht deshalb, weil ich die Camouflage anderer schnell zu durchschauen vermag. In dem Ledertypen sehe ich nicht das Sextier, das nach Schweiß und Männlichkeit riechen will, ich sehe den Sachbearbeiter. Ich glaube es jedenfalls zu sehen. Ich merke, daß die blondierten Haare der Jungs ihre braunen, unglücklichen Augen nicht heller machen, im Gegenteil, sie wirken für mich noch trauriger. Ich glaube den Verkleidungen nicht mehr, weder den Glatzen mit ihren fleckigen Jeans, noch den Tunten mit ihren Perücken. Hinter ihren zynischen Bemerkungen, hinter ihrer farbenfrohen Herablassung sehe ich das Original. Und es macht mich traurig.
Bill hat mich in San Francisco verkleidet. Er wickelte mich in Leder ein, mit Chaps, mit Jacke, mit 501’ern und einem Südstaaten-Lederkäppi. Ich ging durch die Stadt und fühlte mich seltsam, und wenn ich mein Spiegelbild in den Schaufenstern erblickte, glaubte ich nicht, daß ich das sein könnte. Es war zu fremd. Und ich spielte die Rolle zu schlecht, denn es ist nicht meine Rolle.
Meine Verkleidung ist, daß ich mich nicht verkleide. Und das scheint als Tarnung zu genügen.
Ich war lange nicht mehr in einer Schwulenbar. Die letzten Male bin ich immer traurig geworden, wenn ich den Männern zusah. Und wie in der Lenor-Werbung aus den siebziger Jahren schien mein zweites Ich neben mich zu treten, die Arme zu verschränken und zu sagen: Was willst du eigentlich hier?
Ich leerte mein Bier oder ließ es stehen und ging. Dann fuhr ich durch die Stadt, allein. Und ich wurde noch etwas trauriger. Vielleicht ist es mehr eine Melancholie. Daß ich über die Unmöglichkeit traurig bin, über das, was nicht da ist, was fehlt. Ich weiß nicht, ob mir jemand fehlt, doch ich wünschte mir, daß jemand da wäre. Und so ist diese Traurigkeit unbestimmt.
Ich weiß das erst jetzt. Und ich weiß, daß ich es bislang vor mir zu verbergen suchte.
Seither bin ich online. Man muß sich nicht verkleiden, aber verstecken kann man sich, viel besser als sonstwo.
Ich schließe die Datei. Das Lächeln von ICH2 verschwindet, der Computer fährt herunter und piept zum Abschied.
Im Flurspiegel überprüfe ich mich. Es sieht gut aus, denke ich und merke, wie die Aufregung beginnt, in meinen Schläfen zu pochen.
Ich habe alles: Geld, Führerschein, Autoschlüssel. Ich sehe mich noch einmal an und lächle.
Ich habe ein Kondom in meiner Hosentasche, ich nehme es heraus und lege es auf den Sims unter dem Spiegel. Nein, heute nicht. Das ist kein Fick-Date, das ist kein weiteres Online-Häschen, das ich knacke, mit dem ich schlafen möchte, um danach genau zu wissen, daß ich keine weiteren Fragen stellen oder beantworten werde.
Ich will, daß es diesmal etwas anderes ist. Und sei es ein langweiliger Abend.
„Gut“, sage ich, werfe mir einen kurzen Blick zu und gehe.
Ich will jetzt keine Erwartungen, will mir bloß nichts ausmalen. Es wird sonst eine Enttäuschung. Es ist vielleicht schlimm, wenn man sich auf nichts freuen will, nur um nicht enttäuscht zu werden. Ich rechne ja nicht mit dem Schlimmsten. Jedenfalls nicht immer. Es ist gut, an nichts zu denken, nichts zu erwarten, um dann eventuell eine Überraschung zu erleben.
Maria denkt, ich sei müde. Ich habe es ihr gesagt, als sie mich fragte, ob ich mit ins Kino gehen wollte. Ich habe niemandem von der Verabredung erzählt.
„Nein, heute bin ich zu schlapp“, log ich.
Wir nehmen es uns nicht übel, wenn wir uns nicht fühlen und allein sein wollen. Aber ich erzähle Maria längst nicht alles über meine Männer. Sie ahnt vielleicht etwas. Manchmal hat sie einen kennengelernt und seinen Namen gleich vergessen. Es waren einmalige Begegnungen, einmalig und am Dutzend, unverwechselbar, wie alle anderen. Sie hat sie nicht kommentiert. Sie hat auch nie gefragt, wie es Jürgen dem Sozialarbeiter oder Joachim dem Pressereferenten geht, hat sich mit Reinhard dem Krankenpfleger angeregt unterhalten, und mit Henry dem Promoter hat sie gelacht, ohne einen von ihnen jemals wieder zu erwähnen. Sie weiß, daß ich ständig eine Männergeschichte habe. Ich erzähle es ihr nicht, vielleicht weil ich mich ein wenig dafür schäme.
„Ich kann nicht einfach so mit jemandem schlafen“, sagte sie einmal. Und ich glaubte ihre Mißbilligung über die Leute zu hören, die das tun. Oder aber sie wünscht sich es zu können. Ich habe sie nie darauf angesprochen.
Einmal sagte ich: „Eigentlich könntest du ein bißchen mehr Spaß haben. Benutz sie einfach und hab Spaß. Das können die ab.“
Sie sah mich etwas traurig an. Oder hat sie mich beobachtet? Ich weiß es nicht mehr.
„Nein, ich kann das nicht. Manchmal würd ich’s gern, aber wenn’s passiert, dann ist da bei mir immer gleich mehr.“
„Ich bin eben so“, setzte sie hinzu.
Einmal, als sie an einem Sonntagnachmittag einfach bei mir klingelte, log ich, daß ich geschlafen hätte.
Da lachte sie.
„Ach komm, ich hab den nassen Fußabdruck auf dem Läufer im Bad gesehen. Erzähl mir nix“, sagte sie und legte ihre Stirn mit einem spöttischen Lachen in Falten. Sie grinste verschwörerisch und fragte, ob’s schön war.
„Na ja“, sagte ich, „es war ganz gut.“
Dann verschwand der Spott aus ihren Augen, nur die Falten blieben noch einen Augenblick auf ihrer Stirn.
Ich sehe auf die Uhr, denn ich sehe immer auf die Uhr, wenn ich zu einem Termin oder einer Verabredung unterwegs bin. Ich komme sehr selten zu spät.
Heute will ich pünktlich sein, aber nicht zu pünktlich. Wenn ich zu früh bin, kommt der andere meist etwas zu spät, so daß ich derjenige bin, der wartet. Ich werfe es niemandem vor, aber es ärgert mich. Ich hasse dieses Warten. Es liefert einen aus.
Berlin-Schöneberg, Freitagabend um acht. Ich kriege natürlich keinen Parkplatz, schon gar nicht vorm Arco. Und diesmal bin ich nicht früh genug, die Parkplatzsuche ist nicht eingerechnet, ich wollte nicht zu früh kommen, also komme ich nun, wie es aussieht, zu spät.
Gut. Nach einer Viertelstunde finde ich eine Lücke, parke ein und gehe eilig zum Restaurant. Schweißperlen habe ich auf der Stirn. Ich bleibe vor dem Eingang stehen und tupfe sie mit einem Tempo ab. Dann denke ich an das Bild, an das Lächeln und daran, daß ich nichts erwarte. Ich höre mein Herz schlagen und ich gehe hinein.
Ich sehe ihn gleich. Er sitzt an einem Tisch in der Ecke, die Arme vor sich auf der Tischplatte verschränkt, eine Kerze brennt und ein Glas Bier steht vor ihm. Ich bin fast zwanzig Minuten zu spät.
Er lächelt trotzdem.
„Entschuldige, ich bin zu spät.“
„Macht nichts.“
Sein Lächeln ist schöner als auf dem Bild, aber er ist kleiner, als ich ihn mir vorgestellt hatte. Ich setze mich.
„Ich bin eigentlich immer pünktlich.“
„Ja?“ Es klingt verwundert. Dann gesteht er: „Ich nicht, ich komm eigentlich immer zu spät. Heute war ich aber genau um acht hier. Hab mich schon über mich selbst gewundert.“
„Na gut, ich fuhr Punkt acht vorbei, aber bis man hier einen Parkplatz findet.“
„Jaja, ich steh auch drei Ecken weiter. Willst du was essen?“
„Gern. Bist du oft hier?“
„Ja, ich kenn den Besitzer, und das Essen ist einfach gut.“
„Dann kannste mir ja was empfehlen. Ohne Zwiebeln bitte.“
„Wie, ohne Zwiebel.“
„Na, ich esse keine Zwiebeln, hab ich noch nie getan.“
„Ist ja lustig.“ Er grinst und schaut in die Karte.
„Ich hab da so ’ne Theorie. Wahrscheinlich hat mir mal eine alte Frau ihren Zwiebelmundgeruch böse in den Kinderwagen gehaucht, da ist es dann passiert. Nie wieder Zwiebeln und nie wieder Frauen.”
„Könnte hinhauen.“
Er lächelt weiter und ich merke, daß ich langsam in Form komme, denn wenn ich will, kann ich sehr unterhaltsam sein, und wenn ich mich nicht sicher fühle, bin ich entweder still oder doppelt amüsant.
Er hat ein schönes und dennoch unauffälliges Gesicht. Sein Mund schmunzelt etwas; der Blick wirkt gutmütig. Zurückhaltend, etwas schüchtern, aber gut. Ich fühle mich nicht beobachtet oder gemustert, nicht taxiert. Obwohl er mich ansieht, wenn er spricht, er weicht nicht aus, das ist zum Beispiel gut. Und daß seine Mimik zu seinen Worten paßt.
Gut ist auch, daß ich nicht weiß, ob er etwas von mir will. Ich weiß es selber nicht, denn er gibt keine Zeichen. Nichts ist verfänglich an diesem Abend. Wir lachen viel. Es ist ein verhaltenes Lachen, nicht zu ausgelassen, keinesfalls anzüglich.
Er erzählt über die Zeitschrift, bei der er stellvertretender Chefredakteur ist. Eine Jugendzeitschrift. Mit bonbonfarbenen Postern von Boygroups, Zopf-Frisuren für kleine Mädchen und einer Ecke für die Sexfragen der kleinen Jungs.
„Ich verdien gut, aber – na ja – die sind eben alle total cool und so total egdy, wenn du weißt, was ich meine.“
„Auja, das kann ich mir vorstellen, weil das echt total abgeht und die sich supertotal toll finden und alles.“
Wir lachen uns an.
„Aber du betreust nicht die Leserbriefseite, wo die kleine Nadine schreibt, daß sie sich einen kleinen Orgasmus mit einem kleinen Kevin wünscht, der sie aber gar nicht beachtet.“
„Nö. Ich bin so die Kontrollinstanz. Und ein bißchen Politik kann da ja auch stattfinden, das hoff ich jedenfalls.“
„Gut, wann findet die ‚Zahnspangen Raus‘-Demo statt?“
Das war zuviel, denke ich, aber er lacht, es scheint ihn zu amüsieren.
„Entschuldige, aber ich denk das immer weiter und kann mich dann nicht gegen die Bilder wehren. Bin da ziemlich krank“, sage ich.
„Ist doch okay, ich weiß, daß es nicht der große Journalismus ist.“
„Darum geht’s ja auch nicht. Und wenn es dich beruhigt, ich habe schon die Backstreet Boys interviewt.“
Ich mache mein Verschwörergesicht und sehe ihn eindringlich an: „Das bleibt aber um Gottes willen unter uns. Bitte.“
Und er lacht wieder.
Wir essen. Es ist wirklich gut. Und ich trinke noch ein Bier, obwohl ich mit dem Auto gefahren bin. Ich könnte ein drittes Bier trinken, um dann zu sagen, daß es doof ist, noch ein Bier zu trinken, weil ich ja noch Auto fahren muß. Dann müßte er sagen, daß ich bei ihm schlafen kann, weil er um die Ecke wohnt. Er wohnt nicht weit von mir, denn er sagte es mir, als er das Restaurant vorschlug. Aber ich weiß auch, daß er nicht der Typ ist für solche Spielchen. Ich bin mir jedoch nicht sicher, ob ich mitgehen würde. Ich bleibe neutral.
Sein Blick ruft nichts hervor bei mir, es sticht oder rumort nicht in mir. Ich muß ihn nicht ständig ansehen, werde weder rot noch blaß, weder unruhig noch gelangweilt. Er ist hübsch, aber er macht mich nicht geil. Jedenfalls nicht jetzt und nicht sofort.
Im Moment könnte ich allein nach Hause fahren, ohne mich zu quälen, ich könnte bei ihm bleiben und es würde vielleicht ganz nett. Ich weiß es nicht.
Auch an ihm sehe ich keine Zeichen. Oder er verbirgt sie sehr gut. Würde mich jemand fragen, wie es mir im Moment geht, würde ich antworten: „Satt. Satt und entspannt.“
Obwohl er schöne Augen hat, obwohl er aussieht wie ein Mann und nicht irgendeinen Boy raushängen läßt.
Er trägt ein schwarzes Sakko und ein schlichtes Hemd darunter. Er hat eine Halbglatze, seine Stoppelhaare sind grau, seine Ohren stehen etwas ab und haben schöne Ohrläppchen. Es ist komisch, aber ich mag Männer mit angewachsenen Ohrläppchen nicht, sie sind mir suspekt. Abgeflachte Hinterköpfe und Gesichter ohne Kinn wecken lediglich mein Desinteresse. Sein Kinn ist schön. Es hat ein Grübchen in der Mitte und ist markant. Es ist ein Männerkinn und gibt seiner etwas schmächtigen Gestalt, die aber keinesfalls schwächlich ist, mehr Nachdruck.
„Du entschuldigst mich.“
Er steht auf und geht zur Toilette, er ist kleiner als ich und etwas geduckt, aber nicht schlaff. Er hat breite Schultern. Immerhin. Er sieht gut und gerne fünf Jahre jünger aus, als er ist, das könnte sich ausgleichen, denn ich werde meist älter geschätzt. Aber ich will nicht so weit denken, denn ich weiß nicht, wie weit ich denken kann und wie weit ich denken will. Die Kerze ist halb heruntergebrannt, die Zeit vergeht schnell mit ihm.
Wir wissen nun, was wir arbeiten. Wir erzählten uns, woher wir kommen, er aus Westdeutschland, ich aus dem Osten. Wir wissen, daß wir beide solo sind.
Das muß für den Anfang reichen. Wenn es ein Anfang ist.
Er kommt zurück und lächelt.
„Was meinst du, wollen wir noch einen Absacker trinken?“
„Ja, warum nicht, wenn es alkoholfreie Absacker gibt. Muß ja noch Auto fahren.“
„Na ja, das kriegen wir schon hin.“
Er bleibt unbestimmt. Ich weiß nicht, ob er Absichten hat, ob er mich näher an seine Wohnung lockt und beabsichtigt, daß ich nicht mehr Auto fahren kann. Aber es war ein Zeichen, immerhin, es gibt also eine Möglichkeit, mit der er offenbar schon spielt. Schon länger.
„Wo?“
„Laß uns ins Ufer gehen.“
Ja, es ist ganz nah, er wohnt um die Ecke.
„Gut.“
Wir bezahlen, getrennt.
„Wo steht dein Auto?“
„Da drüben.“
Wir gehen. Der Ärmel seines Sakkos berührt den Ärmel meines Sakkos. Es ist vielleicht Zufall, aber ich weiche nicht aus. Dann sind es eben zwei Zufälle.
„Hier.“ Er bleibt bei einem kleinen, roten Ford stehen.
„Ich bin weiter weg, da hinten.“ Ich zeige ungefähr die Richtung. „Also, ins Ufer. Ich hoffe, ich muß da nicht auch wieder Stunden nach einem Parkplatz suchen, ich bin da sehr talentiert. Keinen zu finden, mein ich.“
Er lacht: „Du machst das schon. Da bin ich ganz sicher.“
Plötzlich ist er ganz nah. Steht mir gegenüber, wir sehen uns an.
Seine Augen sind sanft und gut. Er sieht mich an, und wir kommen noch etwas näher. Er nimmt meine Hand. Seine ist warm und sicher, er zögert nicht.
Es wird ein Kuß. Ein kleiner Kuß, ich spüre nur seine Lippen, sie sind etwas hart, aber sie schmecken gut.
Ich öffne die Augen, sehe ihn an.
„O Gott, ich hab ganz weiche Knie“, flüstert er und schaut mir in die Augen. Sie sind so graublau und so sanft, daß ich mit meinem Handrücken über sein Kinn fahren muß. Ich lächle ein wenig.
Er schaut mir nach, wie ich zum Auto gehe. Ich habe keine weichen Knie. Aber seine weichen Knie beängstigen mich nicht.
Noch nicht.
Kapitel 2
Die Wohnung sieht fast noch genauso aus, wie ich sie vor acht Tagen verlassen habe. Ein Stapel Hemden liegt auf der Couch, zwei Hosen hängen frisch gebügelt über einem Sessel, das Bügelbrett ragt noch ins Wohnzimmer, belegt mit Unterhemden und meinem weinroten Pullover. Ich kann mich nie entscheiden, was ich in Urlaub mitnehmen soll. Jedesmal nehme ich mir vor, diesmal weniger einzupacken, suche aus, lasse weg, packe ein und wieder aus, trenne mich von Lieblingshemden, die ich eigentlich unbedingt tragen wollte – und habe am Ende doch eine zu schwere Tasche.
Doch die Tasche ist nicht hier. Sie fehlt. Aber es ist nicht das einzige, was nicht mehr da ist. Es fehlt eine Menge. Mag sein, es würde niemandem auffallen, aber ich bin nicht vollständig zurückgekommen. So wie es aussieht, fehlt mir eine Woche Urlaub.
Ich wirke wahrscheinlich nicht traurig, doch es fällt auf, daß ich weniger lache. Und daß ich schlanker bin, weil fast sechs Kilo in einer Woche von mir abfielen, ohne Diät, ohne Schlankheitskur. Einfach ohne Hunger. Ich habe keine Lust auszugehen, ich habe keine Pläne, keine Termine. Und ich habe keine Ahnung.
Ich sehe mir die Wohnung an, nehme den Pullover, lege ihn wieder hin, gehe zum Tisch, suche Zigaretten, finde sie, setze mich auf die Hosen. Es ist mir egal.
Das Zimmer ist ein Chaos. Aber ich räume nicht auf. Diese Arbeit muß ich mir für später aufheben, wenn ich nicht mehr anders kann, wenn mir die Decke auf den Kopf fällt und ich nichts mit mir anzufangen weiß.
Dann werde ich beginnen, die T-Shirts zusammenzulegen, die Hemden wegzuräumen, die Hosen abermals zu bügeln, die Socken vom Wäscheständer zu nehmen, die beiden ausgetrockneten Kaffeetassen in den Geschirrspüler zu stellen und die Kleiderbügel, die vor dem Schrank liegen, hineinzuhängen. Später. Heute abend oder morgen, vielleicht erst am Sonntag, aber nicht jetzt. Es ist besser, in einer chaotischen Wohnung unglücklich zu sein. Ist alles ordentlich, wirkt alles leer.
Eine aufgeräumte Wohnung wirkt, als trüge jemand einen Anzug, ohne auszugehen; eine aufgeräumte Wohnung wartet wie ein gedeckter Tisch darauf, daß jemand kommt. Eine aufgeräumte Wohnung zeigt, wie selten der Bewohner zu Haus ist. Oder er hat nichts zu tun, was Unordnung bringen könnte. Alles ist in Ordnung. Eine aufgeräumte Wohnung wirkt immer, als fehlte etwas. Ich erwarte nichts. Ich will nicht, daß mir etwas fehlt, obwohl alles darauf hinweist. Denn der Zustand meiner Behausung ist eine Woche alt, alles ist so liegengeblieben, nichts ist verändert. Obwohl alles anders ist.
Ich rufe Maria nicht an. Und unter normalen Umständen würde sie diese Tatsache dazu veranlassen, selbst zum Hörer zu greifen, denn sie würde mein Schweigen registrieren. Sie spürt das immer schnell. Sie ahnt es, sie fragt. Und wenn ich ausweiche, zeichnet sie die Kurve meines Manövers nach, kombiniert und deutet auf die Spur, in deren Bogen sich der Punkt befindet, den ich zu umgehen suche.
„Das, was nicht kommuniziert werden soll, beherrscht die Kommunikation zwischen zwei Menschen.“ Solche Sätze sagt sie. Nebenbei. Sie sieht mich dann mit einem großäugigen und sehr konzentrierten Blick an. Ihre Augen werden dunkel und rätselhaft. Indem sie mein Geheimnis, das selbst ich nicht weiß, zu ergründen versucht, wird sie für mich unergründlich. Wir sind Freunde, wir kennen uns, und auch ich weiß, was ihr fehlt.
Nein, Maria wird nicht anrufen. Nicht, daß sie sich keine Sorgen machen würde, aber sie rechnet weder mit meinem Anruf noch mit meinem Schweigen. Nicht einmal meinen Anrufbeantworter habe ich angeschaltet.
Ich werde sie später alle anrufen: Maria, Matze, Heiner – vielleicht sogar meine Mutter.
Es hat keine Eile, denn eigentlich bin ich gar nicht da. Seit Sonntag vor einer Woche. Auch wenn ich heute morgen um elf meine Tür aufgeschlossen habe. Das sind zirka sechs Stunden, die ich schon hier bin, ohne daß jemand davon weiß.
Bis kommenden Sonntag, 15.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit, befinde ich mich für sie in Israel. Also fehle ich Maria noch fünf Tage. Sie sagte jedenfalls, daß ich ihr fehlen würde.
Sie weiß nicht, daß ich heute morgen um 9.34 Uhr Ortszeit in Berlin-Tegel gelandet bin, daß ich die letzte Nacht in Heathrow verbracht habe, weil mich British Airways nicht anders umbuchen konnte. Ich hätte sonst noch einen Tag in Tel Aviv verbringen müssen. Doch das konnte ich nicht. Ich hätte es tun können. Aber was bedeutet das schon, dieses ‚hätte‘. „Wenn das Wörtchen ,wenn’ nicht wär …“
Wenn ich gar nicht erst gefahren wäre, wenn ich es vorher geahnt hätte oder wenn ich meinen Ahnungen Glauben geschenkt hätte. Was hätte ich tun sollen?
„Wenn das so ist, dann muß ich weg.“
Es hätte eine Antwort kommen können, aber es kam keine.
Also nahm ich den Flieger von Tel Aviv nach Gatwick, fuhr mit dem Shuttle von dort nach Heathrow, wo ich sechs Stunden auf einer Bank lag, sogar etwas schlief, bis ich endlich in den Sitz 13E des BA-Fluges 0865 sank. Die sechs Stunden schienen mir kurz. Weitere sechs Stunden in Israel wären kein Vergleich gewesen.
Maria weiß nicht, daß ich zurückgekommen bin, weil ich meine Ankunft nicht angekündigt habe. Obwohl ich es wollte.
Ich habe es nicht gewagt.
In Laras Wohnung in Tel Aviv steht in jedem Zimmer ein Telefon, und wird auf einem Apparat eine Nummer gewählt, tickern die anderen Apparate mit. Das Telefon im Wohnzimmer, eins an der Wand neben dem Küchenschrank, jenes in Laras Schlafzimmer und das Gerät auf dem kleinen verschossenen Schreibtisch im Gästezimmer, wo ich lag. Ich wagte es nicht. Was hätte ich erreicht? Marias Mitgefühl vielleicht. Aber einen Rat hätte auch sie mir nicht geben können. Dazu war ich zu weit weg. Worte reichen nur über eine gewisse Entfernung, wenn man sagen kann, daß man sich heute abend sieht oder am nächsten Tag, wenn alles schon nicht mehr so schlimm aussieht, wie es in dem Moment wirkt. Ihr Trost wäre zu weit weg gewesen.
Ich wollte nicht, daß die anderen Apparate in den anderen Zimmern die Anzahl der Ziffern registrieren. Ich wollte vor allem nicht, daß die Nebenstellen mein Flüstern ahnen. Und ich wußte nicht, ob Lara oder er mithören konnte. Niemand hätte mich auf das Tickern angesprochen.
Keine Frage ist mehr als hundert Fragen wert.
Keine Antwort ist auch eine Antwort.
Es wäre nur ein weiteres Schweigen gewesen, das mich auf diesen Anruf hingewiesen hätte.
So wagte ich lediglich einen Anruf. Das Telefonbuch nahm ich heimlich mit ins Zimmer, in der Hoffnung, die hebräischen Schriftzeichen wenigstens soweit entziffern zu können, um die Nummer der Auskunft zu finden.
Vielleicht hätte Lara es verstanden. Sie hätte ich fragen können, aber ich war zu feige. Von ihr war nichts zu erwarten.
Ich wollte nicht bleiben, definitiv, keinen Tag länger. Ihretwegen hätte ich vielleicht gar nicht flüstern müssen. Sie spricht kaum deutsch, obwohl ihr Vater Deutscher war. Ich wollte nicht, daß sie mich zum Bleiben überredet. Ich wollte nicht, daß sie sagt, alles sei nicht so schlimm, und es würde schon besser. Ich wollte nicht, daß ich ihr vielleicht geglaubt hätte. Denn es wäre nicht besser geworden.
Sie hat jedoch alles gut genug verstanden, um dann wirklich zu versuchen, mich zu überreden. Das war jedoch, als ich die Auskunft angerufen, den Flug umgebucht und ihr Bescheid gesagt hatte. Sie ahnte es nicht, oder sie tat so, obwohl die Apparate ratterten.
Bis dahin hatte sie sich nicht eingemischt. Sie sah sehr wohl, was passierte. Vor allem konnte sie sehen, daß nichts passierte. Deshalb hielt sie sich raus.
Wir fuhren nach Jerusalem, drängten uns durch den Markt der Altstadt, besichtigten die Geburtskirche, gingen den Orthodoxen aus dem Weg, weil Sabbat war. Sie zeigte mir die Umrisse von Bethlehem in der steinernen Ferne, und immer war sie es, die das Schweigen brach, denn sie hatte nichts mit diesem Schweigen zu tun. Es galt nicht ihr, also hatte sie nicht darunter zu leiden. Für sie hatte sich auch nichts verändert, und alles, was zu ändern gewesen wäre, lag nicht in ihrer Macht. Sie enthielt sich jedes Kommentars – jedenfalls mir gegenüber. Sie ist nicht meine Freundin. Sie kennt ihn, aber nicht mich. Vielleicht hat sie geredet. Spät nachts bei ihm im Wohnzimmer, wenn ich im Gästezimmer so tat, als schliefe ich.
Nur eben gestern, als ich fertig war mit Packen und als meine Reisetasche im Flur stand, sagte sie: „Du bist nicht den weiten Weg gekommen, um jetzt zu gehen. Das ist dumm. Zu Hause wirst du dich nicht besser fühlen.“
Sie hatte recht, das weiß ich, aber für sie war es ein Problem anderer Leute, das, wenn man es kühl genug bedenkt, lösbar ist. Aber ich konnte nicht denken. Ich war ohne Gedanken, ohne Plan, ohne Strategie. Ich sagte Worte, aber es waren die falschen. Sie waren falsch, weil sie nicht halfen, und sie sind es noch immer, weil sie das Gegenteil von dem bewirkten, was ich eigentlich mit ihnen ausdrücken und erreichen wollte.
Sobald ich die Sätze beendet hatte, wußte ich, daß sie nicht richtig sind.
Wenn man jemandem, der einen nicht oder nicht mehr liebt, sagt: „Ich liebe dich“, dann entfacht dieser Satz sein eigenes Gegenteil, dann ist er kein Geständnis mehr, sondern Drohung, letzter Angriff und Kapitulation in einem. Selbst bei einer erwiderten Liebe kann er das zuweilen sein. Dieser Satz schafft mehr Probleme, als er jemals zu lösen vermag; dieser Satz ist ein Wunsch, der im Moment seiner Erfüllung Vergangenheit wird. Und der, der diesen Satz sagt, gibt sich auf und ist im schlimmsten Fall verloren. Er zeigt Schwäche, die Schwäche für jemanden, der ihn schwach macht. Und wenn derjenige, der diese Schwäche hervorruft, nicht sagt: „Ich liebe dich auch“, dann ist es vorbei. Dann ist das, was eben noch schön war, nur noch peinlich. Man beißt sich auf die Lippen, wenn man an diesen Satz denkt, man schreckt aus dem Schlaf, weil sich die Szene, bei der dieser Satz fiel, im Traum wiederholt und noch unerträglicher scheint, als sie es in Wirklichkeit war. „Ich liebe dich“ ist wie ein Fluch, der den dreifach trifft, der ihn ausspricht. Eine Form von schwarzer Magie, die sichere Formel für das Unglück.
„Ich weiß, daß ich mich nicht besser fühlen werde, aber ich fühle mich lieber zu Hause schlecht als hier“, sagte ich zu Lara.
Dieser Satz ließ sie unbeeindruckt. Sie dachte bereits ans Danach. Ich aber war im Gestern. Und ich bin es noch immer, in einer Wohnung mit gestriger Unordnung.
„Nimm einen Bus ans Tote Meer, fahr nach Mezada und nimm dir ein Hotelzimmer. Verbring deinen Urlaub alleine, versuch was daraus zu machen.“
Ihr Englisch ist einfach; ich verstand sie sehr gut. Auch ich spreche diese Sprache nicht perfekt, doch in dem Moment konzentrierten wir uns beide auf das Wesentliche. Das Wesentliche ist in jeder Sprache einfach, auch wenn Lara und ich völlig verschiedene Sichten auf das Wesentliche hatten. Kompliziert ist nur der Kokon, in dem sich das Wesentliche verbirgt.
Mit Lara waren die einfachen Sätze einfach, weil wir nichts voneinander erwarteten. Ich wußte, daß sie meine Situation kannte. Doch für mich war meine Abreise das Wesentliche, obwohl es nicht darum ging. Ich weiß, daß es nicht darum geht. Meine Abreise hat nichts bewirkt.
Gestern, als mir Lara gegenübersaß, wußte ich nichts, und ich bin nun, da ich in meiner Wohnung hocke, keinen Deut klüger.
Nur daß die Zeit jetzt anders vergeht, daß sie keine endlose Fläche aus gelbem Stein in einem fremden Land ist. Meine Küchenuhr tickt, und sie tickt schneller, weil ich nicht unter einer sengenden Sonne stehe und auf meine Armbanduhr schaue, daß ich nicht jede Minute bitte, sie möge schneller vergehen.
„Du, du, du. Mein Schöner“, sagt jemand nah an meinem Ohr. Ich streife den Geruch dieses Satzes wie eine Spinnwebe ab.
Lara sah mich zwar an, aber sie wich meinem Blick aus.
„Du kannst noch mal umbuchen“, sprach sie ruhig und musterte mich dabei.
„Nein, ich kann jetzt nicht ans Tote Meer, Lara. Ich kann jetzt nirgendwohin. Ich hätte das gleich am Anfang tun müssen. Jetzt ist es zu spät.“
Ich hätte gern im Toten Meer gebadet, mich lachend in Schlamm eingepackt, wäre gern im Mietwagen durch die Wüste gefahren. Ich wollte Jad Waschem sehen und den Gazastreifen. Sechs Filme für meine Kamera hatte ich dabei, nun ist gerade mal einer zu drei Vierteln belichtet.
Aber das war alles plötzlich nicht mehr wichtig. Es war mir egal. Was hätte Lara tun können? Sie sagte nicht: „Bleib bei ihm, er braucht dich jetzt“. Stattdessen riet sie mir zu meinem eigenen Urlaub. Allein. Wollte sie mich abwimmeln? Hatte er mit ihr gesprochen, hatte er ihr erzählt, was ihn umtrieb? Hatte er mich feige und gemein an sie verraten?
Lara zog an ihrer Zigarette und schaute mich an, kühl und erwachsen. Ohne mit der Wimper zu zucken und ohne Partei zu ergreifen. Ohne Trost.
Sie sagte nicht, daß noch alles zu retten sei. Sie klärte nichts auf, sagte nicht, es werde schon wieder gut oder daß alles ein Mißverständnis sei. Maria hätte das getan; bei ihr hätte ich vielleicht sogar weinen können.
Lara sah mich unbewegt an. Sie ist nicht meine Freundin, dennoch, kein Zeichen sprach dafür, daß sie etwas vor mir verbarg, daß sie klüger war, als sie zugab, daß sie mehr wußte. Aber es ging ihr wahrscheinlich wirklich nur darum, daß ich meinen Urlaub nicht verplempere, daß ich noch etwas von ihrem Land sehen sollte. Mehr war nicht aus ihr herauszukriegen. Sie war steinern, aber nicht kalt, ihre vermeintliche Kälte ist Abstand.
„Warum willst du nicht ans Tote Meer? Es ist wirklich schön.“
Sie machte diesen Vorschlag beschwichtigend. Als wäre ich ein weinendes Kind, das man nur vom Grund der Tränen abzulenken braucht, um es wieder zum Lachen zu bringen.
„Weil ich jetzt zu traurig bin“, antwortete ich knapp, und nur die Art, wie sie mich ansah, zeigte mir, daß sie mich nicht verhöhnte.
Lara stieß Rauch durch die Nase. Sie ist knapp 50, sie lebt allein, sie wollte sich wahrscheinlich wirklich nicht einmischen. Das war gut so, denn hätte sie sich anders verhalten, wäre ich schon früher gegangen.
„Ich kann nichts tun“, sagte sie, als hätte sie meine Gedanken gelesen. Ich war traurig, weil ich das wußte, weil ich weder Wunder noch Erklärungen erwartete, weil ich spürte, daß es hoffnungslos war und daß weder sie noch irgendwer mir helfen konnte. Da kroch mir der Schmerz wieder in die Bauchhöhle. Der Anruf bei British Airways, der Zettel mit Abflug- und Ankunftszeiten, das Wissen, daß ich vierundzwanzig Stunden später zu Hause sein würde, hatten ihn nur kurz übertüncht.
Seit der Ankunft in Tel Aviv vor knapp einer Woche ist dieser Schmerz da. Eigentlich war er schon früher da. Hätte ich ihm geglaubt, diesem bohrenden Gefühl unter meinem Zwerchfell, wäre ich wahrscheinlich gar nicht mitgeflogen.
Am Anfang war es nur eine Ahnung, ein Schatten, den ich überspielte, den ich mir mit Aufregung wegen der Reise erklärte, dann der Zeit- und Klimaumstellung zuschrieb, der Fremdheit des Landes, dem Chumus, der sich in meinem Magen zu Beton verklumpte, so daß ich die ersten vier Tage unter Verstopfung litt.
Am Strand dachte ich, ich könnte das Gefühl, das sich immer mehr zu einem Schmerz zusammenschob, einfach ausschwitzen. Aber es gelang mir nicht. Der Schmerz wurde größer, saß wie ein Alp unter meinen Rippen, wuchs hinauf zu meinem Hals, so daß auch ich nichts mehr sagen konnte, ohne daß meine Stimme gepreßt und gezwungen klang.
Der Schmerz ist noch da. Jetzt und hier. Er ist mitgekommen. Ich hatte ihn im Taxi zum Flughafen, wo ich dann, wie alle Passagiere, über zwei Stunden auf meine Abfertigung warten mußte, wo man mich bat, meine Reisetasche zu öffnen, wo man ungeniert in meinem Paß blätterte, meinen Kalender durchforstete, wo ein sehr junger, uniformierter Mann mit meinen Papieren verschwand, um Minuten später mit einer sehr jungen Frau zu erscheinen, welche mir dann, meinen Paß und mein Ticket in der Hand haltend, noch einmal alle Fragen stellte, die ihr Kollege schon gefragt hatte.
Wie lange waren Sie in Israel? Wann haben Sie sich entschieden, Israel zu besuchen? Warum waren Sie hier? Welche Orte haben Sie besucht? Was haben Sie dort gekauft? Haben Sie Ihr Gepäck alleine gepackt oder war noch jemand dabei? Welchen Beruf üben Sie in Deutschland aus? Warum haben Sie umgebucht?
Die Stimme der Frau, die trotz Uniform wie ein Mädchen wirkte, sich aber bemühte, erwachsen zu sein, klang wie die eingeübte Karikatur eines Soldaten. Sie schaute in mein Handgepäck, das ich, wie die anderen Passagiere auch, zusammen mit der Reisetasche auf den schmalen Tisch gestellt hatte.
Fliegen Sie direkt nach Deutschland? War das Ihr erster Aufenthalt in Israel? In welchem Hotel haben Sie übernachtet?
Ich antwortete gewissenhaft, fast kopierte ich ihren zackigen Ton. Ich fühlte mich wie bei einem Standgericht. Ich fragte mich, während ich ihr antwortete, ob man dort den Mädchen und Jungs eintrichtert, besonders unfreundlich zu sein? Gehört das dazu? Ich hätte ihr gern auch ein paar Fragen gestellt. Waren Sie schon in Deutschland? Aus welchem Grund? Und wenn nicht, warum? Was halten Sie von den Deutschen?
Ich blieb ruhig, antwortete kurz und sachlich, reichte dem offiziellen Kind Laras Visitenkarte, nachdem abermals nach meinem Aufenthaltsort in Israel gefragt wurde. Lara wußte wohl, was mich erwartete.
„Falls man danach fragt, zeig es ihnen“, hatte Lara gesagt und mir das Papier gegeben. Das Mädchen verschwand ein zweites Mal mit hektischen Schritten, als spielte eine Kapelle den Marsch zu flott. Ich schaute unauffällig auf die Uhr, sah, daß sich immer mehr Menschen am Check-In-Schalter meines Fluges drängten. Hinter mir wurde die Schlange immer länger. Keiner der Reisenden äußerte Unmut; man wirkte betont gelassen. Am Tisch neben mir entfaltete ein anderes Mädchen Baupläne, der Besitzer, offenbar ein Architekt, stand dabei und versuchte etwas linkisch und unsicher, behilflich zu sein. Ich sah ihm die Angst um die Unterlagen an. Das Mädchen schaute auf die Pläne, tat so, als verstünde sie etwas davon, gab sie zurück, etwas grob, als würde sie einen Riß mit einkalkulieren, und sah unbewegt zu, wie der Besitzer sie wieder hastig und doch sorgfältig zusammenrollte.
„Kommen Sie bitte mit“, sagte der junge Mann, der plötzlich vor mir stand, mit meinem Paß und meinem Ticket. Laras Visitenkarte konnte ich nicht entdecken.
Ich wuchtete meine Reisetasche und mein Handgepäck auf den Karren und folgte ihm zum Schalter. Er checkte mich ein, nahm meine Boarding-Karte, machte eine kurze Handbewegung in meine Richtung, also schob ich den Gepäckwagen hinter ihm her, unter den Augen der anderen Reisenden, in eine Halle, wo ich die beiden Taschen abermals auf einen Tisch stellen mußte und wo der Junge, nachdem er sich Gummihandschuhe angezogen hatte, begann, meine Sachen in Plastikbehälter zu packen.
In diesem Moment hatte ich meinen Schmerz fast vergessen, denn ich war damit beschäftigt, mich zu konzentrieren und meine Hilflosigkeit zu verbergen. Ich dachte daran, was passieren würde, wenn mich der Junge so lange filzte, daß ich den Flug verpaßte, ob die Fluggesellschaften auf Passagiere wie mich warten, und mutmaßte, was ich gesagt oder getan haben könnte, daß er ausgerechnet meine Hosen mit einem Metalldetektor untersuchte, selbst die Plastiktüte mit meiner dreckigen Unterwäsche ausräumte und meine Badelatschen zum Röntgen gab. Ich wurde in eine Kabine gebeten, wo ich, darauf gefaßt, mich ausziehen und bücken zu müssen, lediglich abgetastet und mit einem Metalldetektor untersucht wurde. Vielleicht ist es ein Spiel, dachte ich, sie wollen uns aus der Ruhe bringen. Wenn jemand die Nerven verliert, haben sie gewonnen. Wahrscheinlich wetten sie hinter den grauen Trennwänden, wer durchdreht. Sie schachern um Touristen, lachen sich halbtot über peinliche Paßbilder und erzählen sich, welche Farbe die Unterwäsche einer beleibten Britin hatte, die sie tags zuvor durchsuchten. Es erinnerte mich an die Volkspolizisten, die mich früher kontrolliert hatten. Ich war es gewöhnt. Was haben wir denn falsch gemacht, Bürger? Und wenn ich antwortete, daß ich es nicht wisse und worum es sich denn handele, sagten sie: Ich will, daß Sie selbst draufkommen. Dann stand man da als ertappter Sünder. Vielleicht ist es ein erhebendes Gefühl, eine Arbeit zu verrichten, bei der man Menschen Angst machen kann.