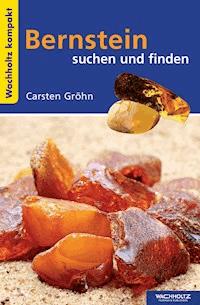
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Wachholtz Verlag
- Kategorie: Lebensstil
- Serie: Wachholtz Kompakt
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Mit dem neuen KOMPAKT-Führer des Bernstein-Experten Carsten Gröhn lassen sich auch unterwegs schnell und einfach die schönsten Bernsteine finden. Deutliche Abbildungen und übersichtliche Erläuterungen informieren kurz und knapp über Herkunft, Eigenschaften, Farben und Einschlüsse.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 74
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Carsten Gröhn
Bernstein
suchen und finden
Abbildungsverzeichnis
© Shutterstock/Aleksandrs Samuilovs: Titelbild
© Diebel, G.: Zeichnung des Bernsteinwaldes
© Hoffeins, C.: Spülsaum am Strand von Jantarny
© Kurverwaltung Baltrum: Luftaufnahme von Baltrum
© Diebel, G.: Zeichnung der Harzflussformen
© Kobbert, M.: Brennender Bernstein, aus„Bernstein – Fenster in die Urzeit“, 2005
© Nehring, S.: 4 Bernsteine und ein Phosphorstück
© Nehring, S.: Warnschild auf Usedom
© Von Holt, J.: Pressbernstein-Maschine, mehrere Bilder
© Kobbert, M.: Bernsteinhalskette, aus„Bernstein – Fenster in die Urzeit“, 2005
© Weitschat, W.: Foto von Dorota Golak mit Baltischem Bernstein
1. Auflage 2018© 2015 Wachholtz Verlag – Murmann Publishers, Kiel/Hamburg
Das Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Gesamtherstellung: Wachholtz VerlagE-ISBN 978-3-529-09267-1
Besuchen Sie uns im Internet:www.wachholtz-verlag.de
Inhaltsverzeichnis
Ein Wort vorweg
Entstehung des Bernsteins
Wo suche ich? Fundstellen
Wie suche und finde ich? Methoden
Bernstein erkennen
Bernstein sammeln
Bernstein bearbeiten
Weitere Informationen
Glossar
Über den Autor
Ein Wort vorweg
Urlaub in Norddeutschland – die beste Gelegenheit, um auf Bernsteinsuche zu gehen. So sieht man auch viele Nord- und Ostseeurlauber oft stundenlang am Strand entlanglaufen, den Blick immer nach unten gerichtet, in der Hoffnung, einen Bernstein zu finden. Die meisten von ihnen werden allerdings enttäuscht.
Wie, wo und wann finde ich Bernstein?
Bernstein kommt an Ost- und Nordsee – aber auch im (nord)deutschen Binnenland – gar nicht so selten vor. Warum also wird er von den Touristen so selten gefunden? Ganz einfach: Sie suchen am falschen Ort zur falschen Zeit und gehen nicht nach der richtigen Methode vor.
Es bedarf genauer Kenntnisse, um bei der Bernsteinsuche wirklich fündig zu werden – und die will dieses Buch vermitteln.
Zunächst sollten Sie eine Vorstellung davon haben, wo Bernstein überhaupt gefunden werden kann, wo die Suche also tatsächlich sinnvoll ist. Dazu sollte man etwas wissen von seiner Entstehung, Lagerung und Umlagerung. Ich muss wissen, wie ich den Bernstein finden kann, also mit welchen Methoden. Solche Kenntnisse erlauben dem Bernsteinsammler, Fundstellen selbst zielgerichtet zu suchen und mit größerer Wahrscheinlichkeit Bernstein zu finden.
Auch sollten Sie wissen, worauf bei der Suche zu achten ist, nach welcher Methode normalerweise vorgegangen wird. Nicht jeder Bernstein hat die allgemein bekannte klar honiggelbe Farbe, es gibt ihn in allen möglichen Farben und Varianten. Und wenn Sie die nicht kennen, können Sie mögliche Funde leicht übersehen. Wie Bernstein aussehen kann, woran er sich erkennen lässt, welche Eigenschaften er hat – diese Fragen sollten Sie vor einer Suche geklärt haben.
Wenn man dann aber den ersten Bernstein gefunden hat, lässt einen – so die Erfahrung – dieses faszinierende Erlebnis so schnell nicht mehr los. Häufig genug entwickelt sich eine Sammelleidenschaft und das Bedürfnis, möglichst viel über das Thema Bernstein in Erfahrung zu bringen – über seine Entstehung, die verschiedenen Formen und Farben, die Varianten, die Einschlüsse usw.
Zu all diesen Aspekten und vielen weiteren – wie zum Beispiel zu den Fragen, woran man Fälschungen erkennt, wie man Bernstein selbst bearbeiten kann, wie man eine Sammlung aufbaut, welche Messen es gibt oder auf welche Literatur man zurückgreifen kann – will ich Ihnen in den folgenden Kapiteln die nötigen Informationen geben. Auf dass Ihre Bernsteinsuche in Zukunft möglichst erfolgreich verläuft!
Ihr Carsten Gröhn
Entstehung des Bernsteins
Wer sich für Bernstein interessiert, der sollte sich zunächst mit der Entstehung des wunderschönen Gesteins, auch „Tränen der Götter“ genannt, befassen. Die Entstehung unseres heutigen Bernsteins soll in diesem ersten Kapitel umrissen werden – auf Seite 92 finden Sie einige Hinweise auf weiterführende Literatur, wenn Sie gerne noch mehr erfahren möchten.
Und noch eins: Lassen Sie sich durch eventuell auftauchende Fremdwörter nicht abschrecken – sie werden in einem Glossar ab Seite 93 erklärt.
Der Bernsteinwald
Vor 50 Millionen Jahren gab es die heutige Ostsee noch nicht. In dem Bereich, wo sie heute ist, stand ein großer Wald mit harzproduzierenden Bäumen, der sogenannte Bernsteinwald. Nachweislich waren Kiefern und Eichen stark vertreten. Dieser Bernsteinwald existierte sicher über viele Millionen Jahre.
Bäume harzen aus verschiedenen Gründen, zum einen, um sich gegen Fraßfeinde zu schützen, zum anderen, um Wunden zu verschließen. Nadelhölzer harzen gewöhnlich mehr als Laubbäume. Die Verletzungen können durch Käferfraß oder durch Windbruch entstehen oder einfach durch das Wachstum der Bäume. Beim Dickenwachstum wächst die Rinde weniger als der Holzteil, die Folge sind Risse in der Rinde, in die der Baum harzt.
Im Eozän herrschte subtropisches, feuchtes Klima. Wahrscheinlich regnete es häufig und stark. So wurden über viele Millionen Jahre hinweg nach und nach große Harzmengen in die Seen und Flüsse geschwemmt und lagerten dort gut geschützt vor Verwitterung. Das ist eine der wichtigen Voraussetzungen zur Bernsteinentstehung. Frisches Harz wird schon nach wenigen Tagen trocken und bekommt Risse, vergleichbar mit lehmigem Boden, der bei Trocknung aufreißt. Das Harz muss also schnell unter Luftabschluss geraten sein, und diese Bedingung war im feuchten subtropischen Wald gegeben.
Ob der Bernsteinwald so ausgesehen hat?
Um die eigentliche Entstehung des Baltischen Bernsteins verstehen zu können, muss man die Entwicklung des heutigen Ostseeraumes vom Eozän (vor ca. 50 Millionen Jahren) bis heute betrachten, vor allem die Regression und Transgression des Meeres, d. h. das Vordringen und Zurückziehen des Meeres.
Im Laufe des Eozäns schob sich das Meer immer weiter nach Osten vor, gegen Ende des Eozäns weit über das heutige Kaliningrad (ehemals Königsberg) hinaus. Es teilte den Bernsteinwald in einen nördlichen und einen südlichen Bereich. Unser Baltischer Bernstein ist ausschließlich aus den Harzen des nördlichen Bernsteinwaldes entstanden.
Der Bernsteinwald im Mitteleozän und der Eridanos-Fluss
Ob es den legendären Bernsteinfluss Eridanos wirklich gab, wird zwar häufig angezweifelt. Doch die sogenannte Blaue Erde von Jantarny (das ehemalige Palmnicken bei Königsberg) beweist meiner Meinung nach seine Existenz. Die Blaue Erde besteht aus Meeresablagerungen (Sedimenten), angereichert mit großen Mengen Bernstein. Sie kommt sehr begrenzt vor und zeigt uns in den Umrissen ein typisches Flussdelta mit einer ursprünglichen Flussmündung im Norden dieses Deltas. Also muss der Fluss von Norden aus dem Bereich des heutigen Schwedens und der heutigen östlichen Ostsee gekommen sein.
Der Eridanos transportierte das Harz aus dem Bernsteinwald ins Meer, dessen Küste vor ca. 40 Millionen Jahren nördlich des heutigen Kaliningrad verlief. Hier am Meeresgrund in den Sedimenten des Flussdeltas konnte nun die Entstehung des Bernsteins aus dem Harz seinen Lauf nehmen. Durch einen fortschreitenden Polymerisationsprozess verfestigte sich das Harz über die Kopal-Stufe im Laufe einer Million Jahre zu Bernstein. Erst nach dieser beinahe unvorstellbar langen Zeit war die Enstehung des Bernsteins abgeschlossen. Deshalb ist auch verständlich, dass nicht überall auf der Erde aus jedem Harztropfen ein Bernstein geworden ist. Für seine Entstehung bedarf es glücklicher Umstände über einen sehr langen Zeitraum.
Entwicklung des Ostseeraumes, Umlagerung des Bernsteins
Im Laufe der folgenden vielen Millionen Jahre änderte sich das Klima, es wurde trockener und kälter. Dies ist das Zeitalter Miozän, vor ca. 20 Millionen Jahren. Auch die Vegetation änderte sich entsprechend, den Bernsteinwald gab es nicht mehr. Immer mehr Ablagerungen überdeckten die Sedimente, in die das Harz geschwemmt worden war. Das fossile Harz verfestigte sich weiter. Heute liegt die Blaue Erde bei Jantarny in 30–40 m Tiefe, nach Norden unter die Ostsee ziehend in weniger als 10 m Tiefe, und an einigen Stellen erreicht sie sogar den Meeresgrund.
Im Miozän zog sich das Meer immer weiter aus dem Bereich der heutigen Ostsee zurück, um dann im Pliozän (vor ca. 3 Millionen Jahren) den Bereich der heutigen Nordsee einzunehmen.
Zwischen dem Miozän und dem beginnenden Pleistozän (dem Eiszeitalter) erstreckte sich der Baltische Urstrom mit seinen Nebenflüssen über 1000 km von Finnland über das Baltikum und Südschweden, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Niedersachsen bis zu den Niederlanden. Die Mündung lag im Beckenzentrum der heutigen Nordsee. Es war ein breites System mit vielen Nebenflüssen, das ständig seinen Verlauf änderte und im Oberlauf der Senke der späteren Ostsee folgte. In ihm wurden neben Sedimenten auch gefrorene Erdschollen transportiert, die Gesteine und Bernstein enthalten konnten. Nach dem Abschmelzen der gefrorenen Erdschollen hinterließen sie ihre Fracht am Boden. Nur dadurch ist zu erklären, dass einige Gesteine und Bernstein den langen Transport in eckigen Formen überstanden haben und nicht im Sand des Flusses abgerundet wurden. Möglicherweise hat der Urstrom hier schon Bernsteine aus der Blauen Erde gewaschen und Richtung Westen transportiert.
Der Baltische Urstrom – die Ostsee gab es noch nicht.
Die Gletscher der jüngsten der drei großen Eiszeiten, der Weichseleiszeit, schmolzen vor ca. 14 000 Jahren ab. Die Schmelzwasser bildeten hinter der westlichen Eisbarriere den großen Baltischen Eisstausee, die Vorstufe der heutigen Ostsee. Diese Senke wurde durch die Gletscher ausgeschürft. Vor ca. 10 000 Jahren war die Eisbarriere so weit abgeschmolzen, dass ein Teil des Baltischen Eisstausees über das heutige Mittelschweden abfloss.
Durch die Wassermassen des abschmelzenden Eises stieg der Meeresspiegel, und für wenige hundert Jahre wurden die Nordsee und der östliche Süßwassersee, unsere spätere Ostsee, über das heutige Mittelschweden verbunden.





























