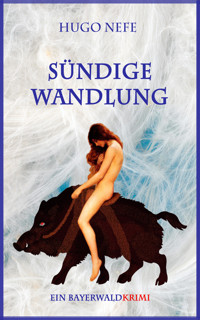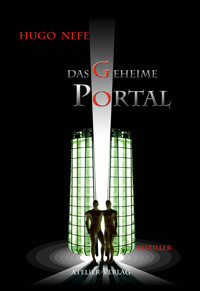6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Atelier Verlag Hugo Nefe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
“Alles Gute kommt von oben? Ganz und gar nicht! Vor vielen Jahrhunderten entdeckte das seefahrende Volk der Korri ein kleines Archipel in den unendlichen Weiten des Ozeans, dessen Bewohner dort noch lebten wie in der Steinzeit. Kurzerhand erklärte man die abgelegene Inselwelt zum geschützten Reservat, in dem sich Mensch und Natur, abgeschottet und unbehelligt vom Rest der Welt, auf ihre ureigene Weise weiterentwickeln sollten. Mit dem ZEIT-ZOO hatte man eine versiegelte Zeitkapsel geschaffen, die niemand von außen betreten noch von innen verlassen durfte. Nach Jahrhunderten totaler Isolation jedoch gelingt es einem jungen Hacker der Korri, per Drohne, Kontakt zu einer Schamanin der Inselwelt aufzunehmen... Für die junge Frau ist er zunächst ein Gott - doch schon bald muss sie erfahren, dass Götter auch nur Menschen sind...”
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Das Menschenopfer
1
Das Land der Götter
5
Die Prüfung
7
Die Sitten der Götter
11
Ein fragwürdiger Triumph
12
Der Blaue Falter
13
Schande
15
Götterspeise
16
Doki auf Bombor
17
Digidong
18
Der lebende Tote
19
Kleiner Lauschangriff
20
Eine unerwartete Wendung
21
Die weichgespülte Revolte
22
Blind Date mit einem Gott
23
Soufflé
26
Der geheime Pakt
27
Die Jugend von Korr erwacht
31
Luftkämpfe
32
Der Plan des Blauen Falters
33
Friedensvorbereitungen
34
Die Biber-Connection
35
Die Spaltung
36
Das Ende der T-Partei
37
Die Schlange erwacht
38
Leben in der Illusionsblase
39
Der Biss der Schlange
40
Genie und Wahnsinn
41
Trauer
42
Aufbruch ins Ungewisse
43
Der Machtwechsel
44
Das Kabinett tagt
45
Vollmond
46
Theater/I. Akt
47
Das Friedensopfer
48
Theater/II. Akt
49
Schlimme Botschaft
50
Pling... pling... pling
51
Die Spur der Götter
52
Das Zauberamulett
53
Der Deal
54
Eine unerwartete Entscheidung
55
HUGO NEFE
BESUCH
AUS DER
ZUKUNFT
ATELIER VERLAG
Impressum
ATELIER VERLAG / Hugo Nefe
D – 94363 Oberschneiding, Hauptstr. 42
E-Mail: [email protected]
Web: https://WWW.NEFE.DE
Das Menschenopfer
1
Niemand konnte das Mädchen jetzt noch retten.
Es war zu spät.
Zu weit war die makabre Zeremonie bereits fortgeschritten. Nicht einmal die Götter würden sich ihrer jetzt noch erbarmen, denn sie würden sich damit selbst der Opfergabe berauben, die ihnen gerade dargebracht wurde.
Die Götter von Bombor waren grausam. Sie waren grausam wie das kriegerische Volk der Bombori, das die Insel Bombor bewohnte, und wie alle Götter waren auch die der Bombori gierig. Noch nie war es vorgekommen, dass sie ein Opfer ausgeschlagen hätten. Im Gegenteil: Durch ihren Stellvertreter auf Erden, den Schamanen des Stammes, forderten sie in regelmäßigen Abständen ihren Blutzoll ein.
Galbo, der Schamane der Bombori, fungierte als ihr Sprachrohr. Was immer auch über seine Lippen kam, war der von allen Bewohnern Bombors akzeptierte Wille der Götter. Auch der Häuptling und die Ältesten des Stammes waren diesem Willen unterworfen – manchmal demütig, manchmal zähneknirschend. Denn ihre Macht und ihr Einfluss auf das Volk waren nur so groß, wie es die Götter und der Schamane zuließen.
Die Prozession der etwa 150 Bombori war jetzt am oberen Kraterrand angekommen. In ihrer Mitte das Mädchen, das als Opfergabe für den Vulkangott Malongo auserkoren worden war. Ein Dutzend bewaffneter Krieger bildeten einen Ring um sie. Doch die junge Frau schien nicht an Flucht zu denken. Sie schien überhaupt nicht mehr zu denken. Apathisch tat sie einen Schritt vor den anderen. Langsam zog sich der Pulk halbnackter Leiber auseinander und bildete eine lange Reihe entlang des Kraterrands. Dumpfe Gesänge hatten den Aufstieg der Prozession begleitet. Jetzt begannen auch die mitgebrachten Trommeln zu dröhnen und Hörner zu erschallen.
Es war Nacht. Nur die Glut des brodelnden Lavasees im Schlund des Kraters, dessen Schein sich an der niedrigen Wolkendecke brach, tauchte die ganze Szenerie in ein gespenstisches rotes Licht. Die Figuren der Akteure wirkten darin wie animierte Scherenschnitte und ihre Leiber wie über und über von Blut besudelt. Es war, als habe das flammende Geschwür des Kraters mit all dem Magma aus seinen tiefsten Eingeweiden auch eine teuflische Brut an die Oberfläche gespuckt – die Bombori.
Tatsächlich galten die Bombori bei den eher friedliebenden Bewohnern der beiden Nachbarinseln, Gali und Nogodai, als Geißel der Götter und als Teufel in Menschengestalt. Wehe dem, der in ihre Hände geriet! Sie tranken sein Blut und verspeisten sein Gehirn, um sich die Kraft und den Geist des besiegten Feindes einzuverleiben. Die Gestalten am Kraterrand begannen sich jetzt im Rhythmus der Trommeln zu wiegen. Der Gesang verlor nach und nach alles Melodische und ging über in ohrenbetäubendes nervenzerreißendes Jaulen, Kreischen, Brüllen und Schreien. Es war, als sei der Vorhang zur Hölle gefallen und gäbe den Blick aufs Inferno frei. Manchmal verschwand die ganze Szenerie hinter einem Vorhang von Rauch, der aus unzähligen verborgenen Ritzen im pechschwarzen Lavagestein aufstieg. Dann wiederum, wenn der Wind die Schwaden für Momente ausdünnte, wirkten die Tanzenden wie schemenhafte nichtstoffliche Wesen, die selbst nur aus verdichtetem Qualm und giftigen Gasen bestanden. Einem Beobachter in einiger Entfernung musste dies alles erscheinen wie ein schwereloser Reigen in den Lüften – der Reigen längst verblichener Ahnen, die ihrer Freude darüber Ausdruck verliehen, dass die uralten blutigen Rituale auf Bombor noch nicht in Vergessenheit geraten waren.
***
Etwa 60 Schritte entfernt, kauerte hinter mannshohen Lavabrocken eine kleine Gruppe von Jungkriegern, die von der Nachbarinsel Gali herübergekommen waren und sich heimlich an Land geschlichen hatten. Gebannt verfolgten sie aus ihrem Versteck heraus das Drama, das sich da vor ihren Augen abspielte. Sie hatten sich, ohne vorher die Erlaubnis der Stammesältesten einzuholen, auf eine lebensgefährliche Mission begeben. Ihr Ziel war es gewesen, Nima aus den Klauen der Bombori zu befreien, die diese bei einem Raubzug auf Gali gefangengenommen und nach Bombor verschleppt hatten. Nima war das Mädchen, das jetzt dort am Kraterrand stand und die Welt um sich vergessen zu haben schien. Sie war erst 15 Sommer alt und die versprochene Braut von Naki, dem Sohn des Schamanen von Gali.
Naki hatte das Rettungsunternehmen zusammen mit Doki, dem Häuptlingssohn, bis ins kleinste Detail geplant. Schon am Vorabend hatten sie sich mit einer Auswahl der besten Jungkrieger von Gali nach Bombor aufgemacht. Zwei Kanus. Acht Mann. Ihre Bewaffnung bestand aus Speeren und Messern mit Feuersteinklingen. Bögen und Schleudern hatten sie zu Hause gelassen. Nahkampf war bei diesem Unternehmen angesagt. Nur Wompi hatte als Einziger seine Keule mitgebracht. Wompi schwor auf seine Keule. Manchmal setzte er sie sogar als Fernwaffe ein - mit durchschlagendem Erfolg. Naki hatte zudem noch ein Kurzblasrohr im Gürtel stecken, mit dessen Betäubungspfeilen er geplant hatte, etwaige Wächter auszuschalten.
Anders als die Bombori, die ihre Schädel bis auf zwei schmale Haarstreifen an den Schläfen kahlschoren und sie mit rotem Baumsaft bemalten, bis sie aussahen wie gehäutete Tierkadaver, trugen die Jungkrieger der Gali ihr schulterlanges blauschwarzes Haar stolz hochgesteckt. Es war in einer Art Schnecke zusammengedreht, aus der oben noch ein kurzes Schwänzchen wippte. Sie alle waren nackt bis auf einen ledernen Lendenschurz und jeder hatte seinen bronzefarbenen Körper mit den von ihm bevorzugten Schutzzeichen bemalt. Es gab Schutzzeichen gegen fast alles, was einem als Bewohner der Inselwelt zustoßen konnte: Schutzzeichen gegen Haie und andere wilde oder giftige Tiere, gegen feindliche Speerspitzen und Pfeile, gegen bösen Zauber und Flüche, gegen Blitzschlag, unglückliche Verliebtheit und vieles mehr. Jeder der acht Jungkrieger trug an einem Bastriemen um die Schulter einen ausgehöhlten Flaschenkürbis mit frischem Trinkwasser und um den Hals, an einem Lederband, das heilige Woko, das ein männlicher Galo nach Erreichen seiner Volljährigkeit mit 16 Sommern erhielt und zeitlebens nicht mehr ablegen durfte.
Das Woko war ein etwa drei fingerbreites Plättchen, das aus dem harten schwarzen Holz der Steinpalme gespalten war. Darauf war von Bindo, dem Schamanen der Gali, ein geheimnisvolles Zeichen eingekerbt worden, das manchmal einem Tierkörper ähnelte, ein andermal einer stilisierten Frucht oder einem Gegenstand des alltäglichen Lebens. Jeder Einzelne hatte sein ganz eigenes Zeichen, das ein Hinweis für ihn sein sollte, wo sein Platz in der Welt zu suchen und zu finden war.
Der Schamane von Gali hatte die Gabe, unter die Oberfläche belebter wie unbelebter Erscheinungsformen zu schauen und ihren Wesenskern zu erkennen. Ob Tier, ob Mensch, ob Pflanze, Wasser oder Fels, alles war für ihn im innersten Kern wesentlich. Und hatte auch ein jedes seine ureigene Bestimmung, so war doch alles mit allem durch diese universelle Wesentlichkeit miteinander verbunden.
Weder Mimikry noch Verstellung konnten Bindos Blick täuschen. Nach seiner Auffassung war das Gleichgewicht der Welt und speziell das des Stammes der Gali nur gewährleistet, solange man sich an der Wesentlichkeit der Dinge orientierte. Nur durch diese Art der Achtsamkeit konnte sich einem die eigene Bestimmung überhaupt erschließen. Immer wieder hatte sich in der bewegten Geschichte des Stammes bestätigt, dass man das Unheil selbst heraufbeschwor, wenn man dem bloßen Schein von etwas mehr Wert beimaß, als seinem Wesen.
Bindo sah es als seine Aufgabe und Pflicht an, das innere Gleichgewicht seines Stammes zu bewahren. Er hatte verschiedenste Rituale entwickelt, mit denen er in regelmäßigen Abständen auslotete, wie es um den spirituellen Zustand des Stammes bestellt war. Doch nicht jeder schätzte seine Bemühungen gleichermaßen. Manch einer mochte seine Rituale für unnötiges Brimborium und faulen Budenzauber halten, und in der Tat waren sie das auch: Brimborium und Budenzauber. Allerdings weder faul noch unnötig, denn jedes Mal erfüllten sie den heiligen Zweck, das von banalen Alltäglichkeiten getrübte geistige Auge eines jeden wieder auf das Wesentliche zu fokussieren.
Der Schamane der Gali hegte keinen Groll gegen die heimlichen Spötter seines Berufes. Eher stimmten sie ihn traurig, denn allzu oft schon war er am Sterbelager eines solchen gestanden und hatte bemerkt, dass diesem die Gewissheit seines bevorstehenden Todes weniger Qualen zu bereiten schien als die späte Erkenntnis, im Leben keine Gewissheit erlangt zu haben.
Bindo glaubte, dass der universelle Wesenskern aller Dinge den permanenten Wandel ihrer äußeren Erscheinungsformen überdauerte. Er war überzeugt von seiner eigenen ewigen Existenz und träumte manchmal von den Formen, die er bereits durchlebt hatte und von denen, die ihm für die Zukunft noch bestimmt waren. Zugleich wusste er, dass er seinem Stamm diese Erkenntnis nicht mit dem stumpfen Instrument der Sprache allein vermitteln konnte. Denn wenn es etwas gab, das in seiner Komplexität mit allen Worten der Welt nicht zu beschreiben war, dann war es Sinn. Sinn war für den Verstand allein nicht fassbar, denn wenn dieser sich nach ihm auf die Suche machte, verlief er sich unweigerlich im Irrgarten von Logik und Vernunft. Die Aufgabe des Schamanen war es, Sinn für alle Sinne wahrnehmbar zu machen. Mit seinen bizarren Ritualen gelang es ihm, Logik und Vernunft für Momente abzulenken und jene Fesseln zu lösen, mit denen der Geist an sie gekettet war. Nur so war es dem Menschen möglich, Sinn in seiner heiligen Ganzheit zu erfahren.
Die Frauen der Gali, die ihre Volljährigkeit bereits nach 15 Sommern erreichten, erhielten eine ähnlich wichtige Schamanengabe wie die männlichen Stammesmitglieder. Allerdings wurde ihnen ihr persönliches Zeichen, ihr Woko, unterhalb des rechten Ohrläppchens auf den Hals tätowiert. Keiner vermochte zu sagen, warum nicht auch den Männern das Zeichen auf die Haut tätowiert wurde. Sicherer wäre es allemal gewesen, denn wer sein Woko verlor, der hatte zugleich seine Seele verloren. Um diese wiederzuerlangen, musste er sich gefährlichsten Prüfungen unterziehen, die nicht selten tödlich endeten.
Einige Alte wollten wissen, dass die Männer ihr Woko nur aus dem Grund an einem Lederband um den Hals tragen mussten, damit sie auch in Momenten höchster Gefahr und Erregtheit noch zu Wachsamkeit und Vorsicht gezwungen wären. Doch keiner wusste es genau. Zu alt und zu lang war die Kette der Überlieferung dieser Sitte, als dass die Erinnerung noch an ihren Ursprung zurückgereicht hätte. Jedenfalls war es unter den jungen Männern und Frauen der Gali ein beliebter Zeitvertreib, an der Bedeutung ihres persönlichen Zeichens herumzurätseln. Dieses Rätselraten konnte allein oder in der Gruppe stattfinden, doch so oder so kam es stets einer weihevollen Handlung gleich. Der Effekt war, dass man sich nach dieser Beschäftigung immer ein bisschen wirklicher fühlte, weil man die Rolle, die man in der Welt zu spielen hatte, klarer zu sehen glaubte als vorher.
Viele von den Alten hatten aufgehört, sich mit ihrem Woko zu beschäftigen. Sie waren überzeugt, ihren Platz in der Welt bereits gefunden zu haben. Sie hielten es zwar weiterhin in hohen Ehren, aber eher als Andenken an ihre verflossene Jugend. Es war schwer zu sagen, ob die dem Woko innewohnende Kraft nur in der Jugend wirksam war, oder ob die Alten nur irgendwann aufgehört hatten, an diese Kraft zu glauben.
2
Die ganze Nacht hindurch waren Naki und sein Kriegertrupp unermüdlich gen Bombor gepaddelt. Noch vor Morgengrauen hatten sie die Zahnklippen erreicht, die dem Fuß des Vulkans von Bombor vorgelagert waren. Sie hatten ihre Kanus dort auf der von der Insel uneinsehbaren Seite festgemacht und waren das letzte Stück an Land geschwommen. Das war unauffälliger, doch zugleich auch ein großes Wagnis, denn die Gewässer um die Zahnklippen wimmelten nur so von den Hyänen des Meeres – den Haien.
Alles war jedoch gutgegangen. Ohne unglücklichen Zwischenfall hatten sie den Strand erreicht und sich sofort in die Deckung des üppig wuchernden Urwalds geschlagen.
Noch bevor es zu tagen begann, hatten sie sich an das Häuptlingsdorf Golam herangeschlichen, in dem sie Nima vermuteten. Da der Überfall der Bombori erst vor drei Tagen stattgefunden hatte, war anzunehmen, dass sich das Mädchen immer noch dort befand. Bei der Verteilung der Kriegsbeute durch den Häuptling kam es nämlich immer wieder zu Streitigkeiten, die erst zeitraubend und manchmal blutig geschlichtet werden mussten, bevor sich die Krieger in ihre eigenen, verstreut liegenden Dörfer zurückzogen.
Naki, Doki, Wompi und die anderen wollten aus den Baumwipfeln heraus das Lager der Bombori beobachten, um herauszufinden, in welcher Hütte man Nima untergebracht hatte. Dann wollten sie sich ausruhen und die Nacht abwarten, bevor sie die Befreiung des Mädchens wagten.
Als sie jedoch von ihrem luftigen Ausguck ins Dorf hinabspähten, gewahrten sie eine seltsame Unruhe und Betriebsamkeit unter den Bewohnern, die zu dieser frühen Morgenstunde höchst ungewöhnlich war. Die Bombori strömten aus ihren Hütten, setzten sich in kleineren und größeren Gruppen auf dem Dorfplatz zusammen und fingen an, ihre halbnackten Körper gegenseitig mit Erdfarben und Pflanzensäften zu bemalen. Die leisen Gesänge, die sie dabei anstimmten, klangen aber nicht nach Kriegsliedern, mit denen sie sich für einen neuerlichen Feldzug aufpeitschen wollten. Im Gegenteil: die gesungenen Weisen hatten etwas Gesetztes und verbreiteten in diesem Dorf der mordlüsternen Teufel, so unvorstellbar es auch scheinen mochte, eine Atmosphäre von Feierlichkeit und würdevoller Andacht.
Irgendetwas lag in der Luft. Naki und seine in den Baumkronen versteckten Mitstreiter konnten es instinktiv spüren. Außerdem deutete etwas unmissverständlich darauf hin, dass sich hier ein Ereignis von Wichtigkeit anbahnte. Es waren die unheimlichen Vögel, auch „Donks“ genannt.
Ganze Schwärme von ihnen hatten sich am Himmel über dem Dorf versammelt und vollführten dort ihre bizarren Flugmanöver. Einige schienen in der Luft still zu stehen, andere zippten in alle Richtungen, und das mit einer Geschwindigkeit, dass ihnen das Auge kaum zu folgen vermochte. Eigentlich hatten die Donks gar kein Gefieder und ihr Körper war nahezu durchscheinend. Die meisten waren nur in Bewegung auszumachen, wenn sich das Licht an den Kanten ihrer vier rotierenden Flügel brach.
Leute, die einen Donk aus der Nähe gesehen hatten, berichteten, dass er mehrere Augen besäße und seine seltsam glitzernden Eingeweide durch die fast transparente Haut hindurchschimmerten.
Aber zu viele unglaubliche Gerüchte waren schon über die Donks in Umlauf gebracht worden, als dass man jedem davon noch hätte Glauben schenken mögen. Eins jedoch war sicher: Noch nie hatte je ein Krieger einen Donk erlegt, weder mit dem Blasrohr noch mit Pfeil und Bogen oder Schleuder. Diese Viecher schienen mehr als alles andere jagdbare Wild einen sechsten Sinn für Gefahr entwickelt zu haben. Was sie aber zu den unheimlichsten Geschöpfen der Inselwelt machte, war der Umstand, dass sie noch niemals beim Beutemachen, beim Fressen oder beim Fäkalienausstoß beobachtet worden waren. Außerdem hatte noch nie jemand ein Gelege oder ein Nest mit Jungbrut von ihnen entdeckt. Dies alles passte einfach nicht ins Schema der Natur. Es war äußerst makaber.
Einige von den Donks waren nicht größer als Libellen, andere besaßen die Flügelspannweite von Albatrossen. Doch das größte Erstaunen bei den Inselvölkern rief ihre beispiellose Neugier hervor. Wo immer auch sich mehr als zwei Leute zusammenfanden, um, sei es, auf die Jagd zu gehen, auf Fischfang auszuziehen oder eine Versammlung abzuhalten, da waren die Donks nicht weit. Ob Geburten, Sterbefälle, Hochzeiten oder Festgelage, den Donks schien kein Anlass zu nichtig, um sich nicht daran zu beteiligen. Fast schien es, als ergötzten sie sich an der Betriebsamkeit ihrer menschlichen Nachbarn, und manchem mochte der Gedanke durch den Kopf schießen, dass eben diese Betriebsamkeit ihr eigentliches Futter darstellte. Aber da sie sowieso nicht zu fassen waren und noch nie irgendwo Schaden angerichtet oder jemanden gefährdet hatten, duldete man sie als lästige Dreingabe der Natur.
Seit der Ankunft der Jungkrieger von Gali hatte die Erde von Bombor mehrmals gebebt. Malongo, der Vulkangott, schien erwacht zu sein und grollte missgelaunt.
Plötzlich stockte den Spähern hoch oben in den Bäumen der Atem.
Galbo, der Schamane von Bombor, trat jetzt aus seiner Hütte. Hinter sich zog er aus dem Dunkel der Behausung ein widerstrebendes Mädchen ins Licht der aufgehenden Morgensonne – es war Nima.
Wenn Naki jetzt seinen Bogen dabeigehabt hätte, dann hätte er, ungeachtet aller Konsequenzen, keinen Augenblick gezögert und Galbo einen Pfeil mitten in sein rabenschwarzes Herz geschossen. Doch so konnte er nur grimmig mit den Zähnen knirschen und auf eine bessere Gelegenheit warten, um es diesem Scheusal ein für allemal heimzuzahlen. Für ihn war Galbo kein Schamane, sondern ein teuflischer Hexer, der seine Kräfte nicht von den segenspendenden Göttern des Lichts erhalten hatte, sondern von den hasserfüllten Mächten der Finsternis. Auch war es Galbo gewesen, der Nakis Großvater bei einem Überfall vor ein paar Jahren erschlagen, seinen Kopf als Trophäe mit nach Bombor genommen und dort mit Sicherheit sein Gehirn verspeist hatte. Für Naki war es immer unfassbar gewesen, dass ein lebendes Wesen einem Angehörigen seiner eigenen Rasse so etwas antun konnte. Der Kopf war der Sitz von Geist und Seele. Ohne ihn konnte kein Verstorbener Aufnahme ins Reich seiner Ahnen finden. Er war dazu verdammt, auf ewig rastlos zwischen den Welten der Lebenden und der Toten umherzuirren.
Nakis Blick wurde jetzt gleichzeitig von zwei Dingen gefesselt. Einerseits war da seine geliebte Braut, die sich kreischend, spuckend und spitze Schreie ausstoßend im gnadenlosen Griff der Klauen Galbos wand, andererseits die grausige Dekoration, die den Eingang zur Hütte des Hexers zierte. Einer dieser mehr oder weniger skelettierten Schädel, die da auf armdicke Staketen gespießt waren, musste seinem Großvater gehören.
Naki hatte sich geschworen, auch diesen Schädel eines Tages zurück nach Gali zu bringen, um ihn mit dem kopflos beerdigten Leichnam seines Großvaters wieder zu vereinen. Aus der Nähe würde er den richtigen Schädel am Gebiss erkennen und an der Scharte am Hinterkopf, die ihm ein Hieb mit der Streitaxt in einer früheren Schlacht eingetragen hatte. Doch heute war nicht der Tag, sich um die Toten zu kümmern, heute ging es um die Lebenden, heute ging es um Nima und sonst nichts. Kein anderer Gedanke durfte seinen Geist jetzt von dem Ziel ablenken, sie zu befreien.
Galbo winkte jetzt zwei Frauen von massiger Körperstatur heran, die Nimas Arme unter ihre Achseln klemmten, sie beim Schopf packten und ihren Kopf in den Nacken zogen. Nima sträubte sich mit aller Kraft. Vergeblich versuchte sie sich aus der Umklammerung herauszuwinden, und ebenso fruchtlos blieben auch ihre Versuche, nach den Fingern Galbos zu schnappen, um ihre Zähne in sein verruchtes Fleisch zu versenken. Mit einer blitzschnellen Bewegung hatte dieser ihr ein Lederknäuel in den Mund geschoben, das groß genug war, dass sie es mit ihrer Zunge nicht mehr hinausbefördern konnte. Jetzt öffnete er eine kleine Kalebasse und tröpfelte eine Flüssigkeit auf das Leder, das dadurch nur noch weiter aufquoll. Wieder und wieder goss er Flüssigkeit nach, während er Nimas Nasenflügel zusammendrückte. Erst wenn sie geschluckt hatte, ließ er sie wieder nach Luft schnappen. Das ging so lange, bis die Kalebasse leer war.
Nimas Gegenwehr erlosch allmählich. Ihre angespannte Muskulatur erschlaffte. Ihr Blick, der anfangs verzweifelt und hilfesuchend in alle Richtungen geschossen war, wurde starr und wirkte wie in weite Ferne gerichtet.
Naki kochte innerlich.
Seine fiebernde Hand griff nach dem Woko. Er hob es an seine Lippen, küsste es heiß und innig und presste es dann an seine vor Zorn glühende Stirn. Nur die dem Woko innewohnende Kraft konnte jetzt noch bewirken, dass er einen kühlen Kopf bewahrte. Denn am liebsten hätte er sich augenblicklich von seinem Baum gleiten lassen, wäre ins Dorf gesprintet und hätte dem verhassten Galbo mit einem blitzschnellen Schnitt seines Feuersteindolchs die Kehle durchtrennt. Aber wie sagten die Alten auf Gali? „Zorn macht jede Waffe stumpf!“
Naki hatte für einen Moment die Augen geschlossen, um dem Aufruhr seiner Gefühle Herr zu werden und sein inneres Gleichgewicht wiederzuerlangen. Als er sie wieder öffnete, sah er, dass Galbo seinen Mund dicht an Nimas Ohr gebracht hatte und ihr zuzureden schien. Das dauerte eine ganze Weile, bis er schließlich zurücktrat, seine Kürbisrassel schwang, dreimal tief Luft holte und Nima seinen giftigen Atem direkt ins Gesicht blies. Daraufhin zog er das Lederknäuel aus ihrem Mund und gab den beiden Frauen, die sie immer noch im Klammergriff hielten, ein Zeichen, sie loszulassen.
Naki traute seinen Augen kaum.
Nima wandte sich wortlos um und kehrte wie selbstverständlich in Galbos Hütte zurück, ganz so, als sei diese schon von jeher ihr angestammtes Zuhause gewesen.
***
Gegen Nachmittag drangen vom Dorf her dumpfe Trommelrhythmen in das Versteck, in das sich Naki mit seinen Freunden zurückgezogen hatte, um sich über die sonderbaren Vorgänge im Dorf zu beraten und vielleicht noch ein wenig Schlaf nachzuholen, bevor sie ihren Plan ausführten. Sie hatten einen Späher in den Baumwipfeln zurückgelassen, der sie alarmieren sollte, sobald sich etwas Unvorhergesehenes in Golam tat.
Ihr Plan war es nach wie vor, die Dunkelheit abzuwarten und Nima weit nach Mitternacht aus den Händen ihrer Entführer zu befreien. Allerdings waren sie davon ausgegangen, dass sie Hütte und Bett mit einem einfachen Bomborikrieger teilen würde, was sonst das übliche Schicksal geraubter Frauen war. Während aber die Hütten der gemeinen Krieger rund um den Dorfplatz und am Rand des Dschungels standen, wo es leichter gewesen wäre, sich von der Rückseite anzupirschen und Zutritt zu verschaffen, war Nima nun in der Behausung des Schamanen untergebracht. Diese aber stand neben der des Häuptlings im Zentrum des Dorfes. Es würde fast unmöglich sein, unbemerkt dorthin zu gelangen.
Die Freunde überlegten hin und her, wie man es am besten anstellen könnte. Verschiedenste Strategien wurden entwickelt und theoretisch durchexerziert, doch am Ende allesamt wieder verworfen. Keine Idee schien perfekt zu sein. Die Möglichkeit, dass durch einen dummen Zufall oder eine noch so kleine Unachtsamkeit ein ganzes Dorf blutrünstiger Bestien aufgeschreckt würde, war nicht auszuschließen.
Was also tun?
Noch während sie sich darüber die Köpfe zermarterten, erschien der Späher im Versteck und berichtete, dass ein Großteil der Bombori in einer Art feierlicher Prozession das Dorf verlassen hatte.
„Und Nima?“, fragte Naki plötzlich bleich im Gesicht.
„Die haben sie mitgenommen... aber sie scheint nicht mehr sie selbst zu sein. Ohne nach links oder rechts zu schauen, ist sie mit ihnen getrottet, als wäre sie schon immer eine von ihnen gewesen.“
„Der Trank des Schamanen muss ihr die Seele geraubt haben!“, ächzte Naki.
„Außerdem hat man ihr, bis auf zwei Haarstreifen an den Schläfen, den Schädel kahl rasiert und ihren Körper mit grässlichen Bomborisymbolen bemalt!“, berichtete der Späher weiter.
Einige in der Gruppe stöhnten bei diesen Worten leise auf, andere wurden von einem Ekelschauer geschüttelt. Dann richteten alle ihren Blick auf Naki und sahen ihn fragend an.
Naki wusste, dass alle wie ein Mann hinter ihm stehen würden, egal wie und was er auch entschied. Doch plötzlich wurde ihm die Verantwortung bewusst, die er mit diesem spontanen Rachefeldzug auf sich geladen hatte. Er durfte sich jetzt nicht von seinem Zorn verleiten lassen, etwas Unüberlegtes zu tun. Acht hoffnungsvolle junge Leben standen hier auf dem Spiel. Das durfte er nicht vergessen.
„In welcher Richtung sind sie aus dem Dorf gezogen?“, fragte er mit fester Stimme.
„In Richtung der Hochebene, die zum Vulkan hinaufführt“, gab der Späher an.
Wieder wich das Blut aus Nakis Gesicht.
„Zum Vulkan, sagst du?“
Der Späher senkte seinen Blick und nickte nur stumm, denn ihm wie allen anderen wurde im selben Augenblick klar, was das bedeutete - die Bombori hatten sich auf einen ihrer berüchtigten Opfergänge begeben.
Fast als wolle er diese grausige Erkenntnis bestätigen, ließ Malongo, der Vulkangott, jetzt wieder die Erde erbeben. Diesmal allerdings so heftig, dass sich die Freunde – Tapferkeit hin oder her – aneinander festhielten, weil sie befürchteten, dass sich der Boden unter ihren Füßen öffnen und sie allesamt verschlingen könnte.
Einher mit dem Beben rollte ein Krachen und Donnern hoch oben in den Lüften, das aus dem tiefsten Schlund des Kraters zu kommen schien. Nur mählich flaute es ab, bis es in ihren Ohren irgendwann nur noch wie fernes hämisches Gelächter klang.
„Wir brechen auf!“, sagte Naki mit bebender Stimme, doch seine Miene zeigte absolute Entschlossenheit.
„Wohin?“, fragte Wompi, der aufgesprungen war und seine kampferprobte Keule ein paarmal auf seine überdimensionierte Handfläche patschen ließ. Er grinste. Ihm war alles recht, außer hier herumzusitzen und etwas zu bequatschen, für das es sowieso nur eine einzige Lösung gab – Action!
Das Patschen von Wompis Keule wirkte auf die Freunde anspornend wie ein Schlachtruf. Sie erhoben sich und folgten Naki geschmeidig wie Schlangen in das Halbdunkel des Dschungels.
„Wir werden ihnen nicht folgen“, raunte ihnen Naki über die Schulter zu „sondern über die steile Südflanke des Vulkans aufsteigen! Dann sind wir lange vor ihnen oben und können sie dort erwarten.“
3
Die Sonne war bereits untergegangen, als die Jungkrieger von Gali, die sich hinter einen mannshohen Lavabrocken geduckt hatten, beobachteten, wie die Prozession der Bombori am Kraterrand eintraf.
Wenig später schien das Opferritual seinen Höhepunkt zu erreichen. Das Dröhnen der mitgeführten Trommeln wurde lauter, die Rhythmen hektischer. In das ohrenbetäubende Kreischen der Frauen mischte sich das kehlige Gebrüll der Bomborikrieger, und als wäre dieser Lärm noch nicht genug, ließ auch Malongo immer wieder seine furchterregende Stimme ertönen. Das an- und abschwellende Rumpeln, Dröhnen und Donnern, das aus den tiefsten Tiefen des Feuerberges heraufscholl, ließ auch dem wackersten Gali-Krieger das Mark in den Knochen gefrieren. Auf Gali gab es keine aktiven Vulkane, deshalb flößte ihnen diese unvertraute Naturgewalt Furcht und Schrecken ein.
Anders, die Bombori: Sie kannten die Sprache Malongos und hatten mit seinen Launen umzugehen gelernt. Anscheinend wussten sie immer genau, in welcher Stimmung er sich gerade befand. Unbeeindruckt von seinem grollenden Gepolter tanzten sie ihren wahnsinnigen Tanz. Röhrende Männerkehlen, schrill kreischende Frauenstimmen, und wohin man auch blickte, ekstatisch stampfende Füße und wie im Fieberwahn zuckende Leiber. Das ganze höllische Spektakel war in den blutroten Schein getaucht, den die kochende Lava im Krater an den überzogenen Himmel warf.
Hin und wieder kam es vor, dass einer der Tänzer, der sich in Trance getanzt hatte, einen Fehltritt tat, strauchelte und über die Schrägwand der Kaldera unaufhaltsam in die Tiefe rutschte. Seine Schreie gingen im allgemeinen Gegröle, dem Lärmen der Trommeln und dem dumpfen Grollen Malongos unter. Nur ein kurzes helles Aufblitzen am Rand des Lavasees zeugte Augenblicke später von der Himmel- oder Höllenfahrt einer menschlichen Seele. Doch niemand kümmerte sich sonderlich darum. Solche Vorfälle waren bei einem Opferritual keine Seltenheit und für die Geschichten, die man sich später am Lagerfeuer darüber erzählen konnte, das Salz in der Suppe.
Ab und zu schossen leuchtende Fontänen flüssigen Gesteins zum Himmel empor und regneten in glühenden Fetzen und Fladen wieder herab. Es war wirklich schwer zu sagen, ob diejenigen Tänzer, die sich mit ihren akrobatischen Sprüngen und Verrenkungen besonders hervortaten, ihre erstaunliche Energie nicht aus einem dieser leuchtenden Geschosse zogen, das sie unversehens getroffen hatte.
Das infernalische Treiben, das sich da nur 60 Schritte von ihrem Versteck entfernt abspielte, hatte die Nerven der Jungkrieger von Gali bloßgelegt. Es war ihnen schier unmöglich, einen klaren Gedanken zu fassen. Zu viele extreme Eindrücke hagelten da gleichzeitig auf sie ein.
Jetzt sahen sie, wie Galbo, der Schamane, Nima an einen Felsvorsprung führte, der wie der Bug eines großen Schiffes weit in die Caldera hineinragte. Nachdem er ihr ein paar Worte ins Ohr geflüstert hatte, schritt Nima allein weiter, bis sie die Spitze der Felsnase erreicht hatte. Sie schien ihre Außenwelt nicht mehr wahrzunehmen, war nur noch fixiert auf die teuflische Order, die Galbo in ihr von Drogen betäubtes Gehirn gepflanzt hatte.
„Kommt, lasst uns Nima da raushauen!“, schlug Wompi jetzt keuchend vor Erregung vor. Dabei schloss sich seine massige Pranke so fest um den Griff seiner Keule, dass seine Knöchel knackten.
Das war typisch Wompi! Nicht zu Unrecht trug er den Spitznamen „Rammbock“ - immer mit dem Kopf durch die Wand!
Wompis Körper unterschied sich merklich von dem der anderen. Seine Freunde waren schlank und die Muskeln ihrer sehnigen Gestalt klar definiert. Er hingegen war schon als Kleinkind an Größe und Gewicht allen voraus gewesen. Erschwerend kam sein ständiger Heißhunger auf deftigen Wildschweinbraten und süße Früchte hinzu. So hatte sein grenzenloser Appetit mit der Zeit dazu geführt, dass seine beachtliche Muskelmasse von einem schützenden Fettpanzer umgeben war. Doch nichts an ihm wirkte schwammig oder wabbelig, da jedes Gramm seines Kampfgewichts im idealen Verhältnis zu seiner Größe stand.
Doki, der Häuptlingssohn, konnte sich keinen besseren Kumpel als Wompi vorstellen. Für ihn war Wompi wie ein leiblicher Bruder. Wompi war freigiebig, hilfsbereit und zuverlässig. Jeder suchte im Kampf seine Nähe, denn wo Wompi seine Keule schwang, lichtete sich das Schlachtgetümmel beträchtlich. Das ermöglichte einem für Momente tief durchzuatmen und Kraft für den nächsten Angriff zu sammeln. Das Einzige, was an diesem Koloss, an diesem menschlichen Bollwerk, gewöhnungsbedürftig war, war seine Art zu kommunizieren. Egal, was man zu Wompi sagte oder ihn fragte, er konnte oder wollte nie prompt darauf reagieren. Es dauerte immer erst ein paar Herzschläge, bevor er antwortete - wenn überhaupt.
Doki war sich noch nicht klar darüber, ob dieses Verhalten daher rührte, dass auch Wompis Mahlsteine im Kopf mächtiger waren als die aller anderen und deshalb mehr Anlaufzeit brauchten, oder ob diese auffälligen Verzögerungen bedeuteten, dass er sich genauer als alle anderen überlegte, was über seine Lippen kommen sollte und was nicht. Wompi verabscheute Palaver um des Palavers Willen. Er meinte einmal zu Doki, dass die meisten Menschen viel zu viele unnötige Geräusche machten. Deshalb war es besser, sich in der Verständigung mit ihm auf eindeutige Worte und Handzeichen zu beschränken. Ein knappes „Wompi, hau rein!“, genügte schon, um ihn für die Schlacht zu aktivieren. Ein kurzer Fingerzeig auf eine vom Feind bedrängte Gruppe im Schlachtgetümmel, und der Rammbock walzte in die angegebene Richtung, um dort alles plattzumachen, was sich ihm in den Weg stellte. Das verstand er. Dafür war er gebaut, dafür war er zu haben.
Wompi war kein verschraubter Umstandskrämer, der um die Ecke denken konnte. Gedankliche Abstraktionen ließen in seinem Oberstübchen kein Glöckchen klingeln. Er sah die Welt nicht, wie sie sein könnte, sondern wie sie war: Konkret. Und dementsprechend war sein Handeln. Das Wenige, das er sagte, war ein Ergebnis geradlinigen Denkens und hatte in den allermeisten Fällen auch Hand und Fuß. Kurzum, Wompi war ein Mann für alle Fälle. Man konnte sich auf ihn verlassen. Für Doki war Wompi berechenbarer als der Lauf der Sonne. Wompi irrte nicht ab von seinem Weg. Er war immer nur Wompi, immer nur er selbst. Diese Berechenbarkeit war es, die über die Jahre zu tiefem Vertrauen und aufrichtiger Freundschaft zwischen ihnen geführt hatte.
Wompis Vorschlag, Nima den Bombori jetzt noch mit Gewalt zu entreißen, stieß keineswegs auf ungeteilte Begeisterung. Zunächst einmal herrschte nur betretenes Schweigen. Ein paar kauten nervös auf ihrer Unterlippe. Keiner wollte der Erste sein, der dem fiebernden Rammbock das unausweichliche Ergebnis seines Vorschlags erläuterte, denn hier und jetzt kam jede Hilfe zu spät. Das war allen klar.
Auch wenn sie es schafften, in wütendem Rasen 20 oder 30 der ameisengleich schwärmenden Bombori ins Jenseits zu befördern, die Übermacht war einfach zu groß.
Wie sollten sie außerdem die willenlos gemachte Nima über die steile Südflanke des Vulkans zum Strand hinunterschaffen... mit all den Verfolgern auf den Fersen? Es war ja nicht einmal sicher, ob Nima sie überhaupt noch erkannte. Was, wenn sie sich weigerte, mitzukommen? Was, wenn sie in ihrer Verhextheit eher dem Willen des Schamanen gehorchte?
Nein, es war aussichtslos!
Am Ende würde nicht nur Nima dem Stamm der Gali verlorengehen, sondern obendrein auch Doki der Häuptlingssohn, Naki, der Sohn des Schamanen und eine Handvoll der besten Jungkrieger.
Und was wäre damit erreicht?
Nichts!
Nichts, außer dass sie ihrem wahnsinnigen Zorn und ihrer unermesslichen Wut freien Lauf gelassen und diesen kurzen Moment der Genugtuung alle mit dem Leben bezahlt hätten.
Ursprünglich waren sie ja ausgezogen, um Nima mit List aus den Händen der Bombori zu befreien, das hätte wenigstens den Hauch einer Chance gehabt. Doch ein Sturmangriff auf einen Gegner von über zehnfacher Stärke hatte nichts mehr mit Heldenmut und ehrenvoller Todesverachtung zu tun – das war einfach nur Wahnsinn. Als Wompi jetzt in die Gesichter seiner Freunde sah, begann auch ihm zu dämmern, dass hier mit bloßem Draufhauen nichts mehr auszurichten war. Es war vorbei! Nima gehörte dem Vulkangott Malongo, und dies schon von dem Augenblick an, als ihr der verruchte Schamane sein teuflisches Gebräu eingeflößt hatte.
Einzig Naki machte noch Anstalten, blindlings loszustürmen. Verständlich. Im Zustand seiner wahnsinnigen Aufgewühltheit war ihm jetzt alles egal. Ohne Nima hatte sein Leben jede Bedeutung verloren. Sie hätten das ideale Paar abgegeben. Nicht nur hatten sie sich körperlich voneinander angezogen gefühlt, sondern auch ihre Seelen schienen aus demselben Stoff gewoben und waren schon seit langer Zeit untrennbar miteinander verknüpft. Was für ein Gewinn wäre ihre Nachkommenschaft für den Stamm gewesen! Stärke hätte sich mit Edelmut gepaart, Scharfsinn mit Güte und Weitsicht.
Nakis Hand umklammerte den Griff seines Dolches. Sehnen und Muskeln waren aufs Äußerste gespannt. In seiner kauernden Haltung glich er einem Panter vor dem Sprung. Der Sohn des Schamanen hatte seine Mitte verloren... er stand neben sich... in seinen Augen loderte der nackte Wahnsinn.
Als sein irrer Blick jetzt auf Wompi fiel, fühlte sich dieser wie von einem eiskalten Wasserstrahl getroffen. Seine eigene Angriffslust kühlten weiter ab. Das heftige Pulsieren in seiner geschwollenen Halsschlagader ließ nach und sein Verstand gewann wieder die Oberhand. Die anderen registrierten es mit Erleichterung. Denn wenn sich Nakis abgrundtiefe Verzweiflung mit Wompis Zorn vereinigt hätte, wenn die beiden plötzlich aufgesprungen und mit dem Schlachtruf der Gali zum Kraterrand gestürmt wären, dann wäre auch ihnen nichts anderes übriggeblieben, als den beiden mit gezückter Waffe in den sicheren Tod zu folgen.
Doch es kam anders.
Wompis Kehlkopf machte ein paar kräftige Klimmzüge... rauf und runter... rauf und runter. Es hatte den Anschein, als würge er seinen rasenden Ingrimm Brocken für Brocken hinunter. Langsam wich die Spannung aus seinen Gliedern. Jetzt legte er seine Keule beiseite, schloss die Augen und atmete ein paarmal tief durch. Dann legte er seine mächtige Pranke sanft auf Nakis Hand, die immer noch krampfhaft den Dolch umklammert hielt.
„Dooom!“, raunte er jetzt mit rollendem Bass in Nakis Ohr. „Dooom, Naki... dooom! “
Die tiefere Bedeutung dieses Wortes war mit Worten eigentlich gar nicht zu beschreiben, noch viel weniger seine Wirkung. Denn das Wort selbst war Wirkung. Eine der einfachsten Deutungsformeln war vielleicht: „Ich bin alles und alles ist ich! Der Wille der Götter geschehe!“
Aber nicht das Wort allein transportierte die ungeheure Wirkungsmacht des „Dooom“, sondern die ganze Art, wie man es übermittelte. Es kam auf die innere Einstellung an, mit der man sich in diesem Moment mit allem gleichmachte. Es kam darauf an, wie lang man das Wort dehnte, wie hoch oder tief die Tonlage war, welches Timbre in der Stimme mitschwang und von welchen Blicken, Gesten und Berührungen es begleitet wurde. Es war ein Weitergeben von feinsten und allerfeinsten Schwingungen, die Auswirkung auf den gesamten Wahrnehmungsapparat eines Wesens hatten. Alles zusammengenommen, drückte „Dooom“ das Staunen vor der sichtbaren wie der unsichtbaren Schöpfung aus und die Bereitschaft, sich ehrfürchtig ins Mysterium göttlicher Planung zu fügen.
Die Alten auf Gali wussten zu berichten, dass es auf der Insel Leute gegeben hatte, die durch die meisterhafte Anwendung des „Dooom“ selbst rasende Bestien mitten im Angriff gestoppt hatten.
Nakis Blick bohrte sich jetzt in den Wompis. Ein trotziges Ringen und Kräftemessen kam in Gang, ein Kampf mit unsichtbaren Waffen, ein Wettstreit zweier ebenbürtiger Geister, von denen der eine zu besänftigen, der andere aufzustacheln versuchte.
Doch nicht lange, und die heiße Diskussion ohne Worte war entschieden. Nakis Augenlider begannen zu flackern und sein Kopf sank langsam zwischen die Schultern. Die Anspannung wich aus seinen Gliedern und sein Atem wurde flacher. Er hatte Wompis Botschaft erhalten und schließlich akzeptiert – Ich bin alles und alles ist ich! Der Wille der Götter geschehe!
Plötzlich ließ ein hundertfacher grässlicher Aufschrei der Bombori die Freunde hochschrecken. Als sie zum Kraterrand hinübersahen, war Nima verschwunden.
Leichenblass starrte Naki zu der Stelle hinüber, wo die Blume seines Herzens, die Freude seines Lebens und Verbündete seiner Seele noch vor wenigen Augenblicken gestanden hatte.
Mit einem unterdrückten Schluchzen schlug er die Hände vors Gesicht und schloss die Augen. Doch der Versuch, die grausame Realität, wenn auch nur für Momente, auszublenden, misslang. Selbst mit geschlossenen Augen sah er Nima immer noch einsam und weltverloren am Abgrund stehen. Dieses Bild, das sein Gehirn als letztes von ihr abgespeichert hatte, schien sich für alle Ewigkeit auf der Innenseite seiner Lider eingebrannt zu haben. Er, Naki, der Sohn des Schamanen von Gali, würde in alle Zukunft keinen Schlaf mehr finden.
***
Beim Abstieg über die steile Bergflanke musste jeder Schritt gut überlegt sein. Ihr Rückzug gestaltete sich als vorsichtiges Vorantasten über messerscharfes Gestein. Die Stellen, die zu heiß waren, um sie mit nackten Füßen zu betreten, verrieten sich glücklicherweise durch den roten Schein, der durch Ritzen, Risse und Löcher glomm und den Verlauf der unterirdischen Lavaströme markierte.
Schon auf halber Höhe war das Zischen, Fauchen und Bersten von der Küste herauf zu hören, wo die Glutströme auf das ihnen feindlich gesinnte Element Wasser stießen, das in der Brandung kurzen Prozess mit ihnen machte und sie gnadenlos erstarren ließ.
Manch einem der niedergeschlagenen Freunde mochte dieses Naturschauspiel als Sinnbild dafür erscheinen, dass vom Leben nichts anderes als Kampf zu erwarten war. Selbst in der Natur belauerte sich alles und jedes, nur um im geeigneten Moment den eigenen Vorteil auszunutzen und über den anderen herzufallen. Allenthalben herrschte Krieg. Im Kleinen wie im Großen. Im Innen wie im Außen. Was man gelegentlich als friedliche Idylle wahrnahm, war nur ein kurzes Atemholen dieses archaischen Kampfes, ein eingebildeter Blumenteppich, unter dem im Verborgenen die Krallen geschärft und die Messer gewetzt wurden.
Vielleicht sehnte sich sogar der blutrünstige Bomboro tief in seinem Innersten uneingestanden nach einer Kraft, die das eherne Gesetz von Fressen-und-gefressen-Werden aufheben konnte. Doch hieße das nicht, die Natur aus ihren Angeln heben und eine völlig neue Welt erschaffen... von Grund auf? Wer konnte das? Wer, unter den Menschen, hatte die Kraft, die Macht und Stärke dazu? Nein, noch war es nicht so weit, sich gegen das Diktat der Natur aufzulehnen, und bis es so weit war, war es allemal edler, im Kampf zu fallen, als ein Opfer seiner Illusionen zu werden. Tatsächlich schwelte schon jetzt wieder in den Köpfen der Jungkrieger von Gali der Gedanke an einen gewaltigen Rachefeldzug gegen die Bombori, und diesmal einen besser überlegten. Tod allen Bombori!
Doki bemerkte jetzt, dass Naki zurückgeblieben war. Er gab den anderen ein Zeichen, dass sie warten sollten. Er kletterte ein Stück des Wegs zurück, bis er dessen schattenhafte Gestalt vor einer Öffnung wahrnahm, wo das erstarrte Oberflächengestein eingebrochen war und den Blick auf den knisternden zähfließenden Lavastrom freigab. Naki stand reglos da. Manchmal wanderte sein Blick zum Gipfel hinauf, dann wieder starrte er in das gefährlich klaffende Feuerloch. Fast schien es, als warte er darauf, dass die Leiche Namis auf dem Lavastrom an ihm vorübertreibe. Oder sollte er etwa den Entschluss gefasst haben, sich...
Doki schauderte.
„Naki!“, rief er seinem Freund zu und gab ihm ein ungeduldiges Zeichen. „Was trödelst du da herum? Komm endlich, wir müssen zu den Kanus!“
Naki folgte ihm nur widerstrebend. Immer wieder drehte er sich um und warf einen sehnsuchtsvollen Blick zum Gipfel hinauf.
Nach einer Weile hatten sie zu den anderen aufgeschlossen und der Trupp bewegte sich langsam hangabwärts zu der Stelle, von wo aus sie zu den weit draußen liegenden Zahnklippen schwimmen wollten, wo ihre Kanus vertäut lagen.
Am Fuß des Feuerberges angelangt, griffen alle nach ihrem Woko und murmelten dabei ein kurzes Stoßgebet. Gerade hier und zu dieser nächtlichen Stunde kostete es, bei allem jugendlichem Wagemut, doch einige Überwindung, seinen schutzlosen Körper den pechschwarzen Fluten der See anzuvertrauen. Überlieferung und Erfahrung hatten sie gelehrt, dass es gefährlich war, in das Reich des Meergottes einzudringen, ohne ihm vorab Opfer dargebracht zu haben. Leichtsinnigerweise hatten sie sich dieses Ritual in der Eile ihres Aufbruchs von Gali gespart – und das konnte böse Folgen haben.
Letzte Nacht, als sie von den Zahnklippen an Land geschwommen waren, hatten sie sich nicht allzu viele Gedanken gemacht, da strotzten sie noch vor Abenteuerlust und Unternehmungsgeist und in ihrem Kopf war nur Platz für einen einzigen Gedanken gewesen: Wir holen Nami zurück! Koste es, was es wolle! Nun aber, da ihr hochfahrender Plan von Galbo durchkreuzt und ihr Rettungsversuch so kläglich gescheitert war, fühlten sie nichts als Schwäche, Scham und Schande.
Doki beobachtete Naki aus den Augenwinkeln. Der Zustand seines Freundes gefiel ihm nicht. Es war nicht der Ausdruck der Niedergeschlagenheit und Enttäuschung, wie er auf den Gesichtern der anderen zu lesen stand, sondern die absolute Ausdruckslosigkeit von Nakis Antlitz, die ihm Sorge bereitete. Es war unmöglich, zu erraten, was in dem Sohn des Schamanen vor sich ging. Sein Blick war aufs Meer hinaus gerichtet. Nicht zu den Zahnklippen, sondern nach Norden, wo der Überlieferung nach das geheimnisvolle Land der Götter liegen sollte. Von weit dort draußen, wo das Dunkel von Wasser und Himmel in einheitliches Schwarz überging, schien er auf ein Zeichen zu warten. Auch hatte Naki als Einziger nicht nach seinem Woko gegriffen, um sich dem Schutz der Götter anzubefehlen. Er stand nur da, als ob ihn das alles nichts mehr anginge.
Doki gab sich einen Ruck und schob die düsteren Gedanken um Naki beiseite. Er musste jetzt an die Gruppe denken. Um das zerrüttete Innenleben des Schamanensohns würde man sich später kümmern, wenn man wieder zurück im heimischen Dorf war. Jetzt mussten sie erst einmal von hier verschwinden. Bei Morgengrauen musste die Entfernung zwischen ihnen und Bombor so groß sein, dass sich eine Verfolgung für die Bombori nicht mehr lohnte.
Wompi schien seine Gedanken erraten zu haben. Er befestigte den Stiel seiner Keule am Gürtel und hechtete als Erster in die Fluten. Der mächtige Platscher, den er verursachte, war das Kommando für die anderen. Einer nach dem anderen folgte ihm. Zuletzt auch Naki.
Die starken Strömungen, die um die Zahnklippen herrschten, waren unberechenbar. Mal musste man mit aller Kraft gegen sie anschwimmen, mal sich von ihnen treiben lassen. Es war ein Geschicklichkeitsspiel, das keine Spielfreude aufkommen ließ. Kämpfte man zu lange gegen eine Strömung an, lief man Gefahr, frühzeitig zu ermatten. Ließ man sich zu lange treiben, war das ähnlich fatal, weil man es dann verpasste, mit ein paar kräftigen Schwimmzügen in eine günstige Gegenströmung zu gelangen, die die Abdrift vom Ziel wieder korrigierte.
Alles in allem aber war jeder von ihnen ein erfahrener Schwimmer und das Meer, mit all seinen Tücken und Fährnissen, fast von Geburt an ihr zweites Element.
Ihr Ziel war für sie in der Dunkelheit nur an der weißen Gischt der Wellen auszumachen, die sich an den schroffen Felsnadeln der Zahnklippen brachen. Es erforderte sorgfältigste Koordination aller Kräfte, um es sicher zu erreichen.
Die Strömung hatte die Kette der Schwimmer weit auseinandergezogen, und so dauerte es eine Weile, bis schließlich alle schnaubend und prustend bei den mit Lianen vertäuten Kanus eintrafen - alle bis auf einen.
Naki!
4
Die Freunde warteten auf Naki.
Rufe erschallten nach allen Richtungen, doch sie wurden fast augenblicklich vom Krachen der Brandung verschluckt.
Die Zeit verging, doch Naki tauchte nicht auf.
„Wer hat ihn hinter sich gehabt?“, fragte Doki schließlich und musterte die bedrückten Gesichter seiner Kameraden.
„Ich“, meldete sich einer zu Wort, der am Fuß des Vulkans als Vorletzter in die See gesprungen war. „Ich habe das Platschen seiner Arme und Beine noch eine Zeit lang hinter mir gehört, dann war es weg und ich nahm an, Naki habe sich treiben lassen, um Kraft zu sparen.“
Das Warten wurde zur Qual.
Von Naki keine Spur... nichts zu hören, nichts zu sehen. Auf einen Wink Dokis stiegen sie in die Kanus und umrundeten die Felsnadeln in verschiedenen Abständen. Wieder Rufe in alle Richtungen.
Keine Antwort.
Es war ein letzter Verzweiflungsakt, den sie da unternahmen, denn in der langen Zeit, die sie auf Naki gewartet hatten, konnte dieser bereits sonst wohin abgetrieben sein – und das war noch die angenehmste Vorstellung, die sie sich von seinem Verschwinden machen konnten.
Doki richtete seinen Blick jetzt besorgt nach Osten. Dort, weit draußen, zeichnete sich bereits eine kaum wahrnehmbare graue Linie ab, die das Schwarz der Nacht zerschnitt.
„Seht, der Horizont kommt schon in Sicht!“, rief er den anderen zu. „Wir müssen schleunigst zurück nach Gali, sonst sitzen wir hier auf dem Präsentierteller. Wenn die Späher der Bombori uns bei Tagesanbruch entdecken und Alarm auslösen, dann sind wir verloren!“
Einer nach dem anderen tat mit einem Nicken oder einem gepressten Ausruf seine Zustimmung kund. Keinem war wohl dabei. Das unbekannte Schicksal Nakis belastete sie. Doch jedem war klar, dass sie augenblicklich mit ihren Paddeln die Wellen schlagen mussten, wenn sie nicht als Festschmaus der Bombori enden wollten.
„He, hierher! Ich glaube, ich sehe da etwas!“, rief plötzlich einer im ersten Kanu und deutete auf etwas, das im Wasser trieb.
Mit ein paar Paddelschlägen waren sie dort und konnten es kaum fassen – es war Naki.
Ohne Arme oder Beine zu bewegen, trieb der Schamanensohn in den Wellen. Seine Augen waren weit aufgerissen und starrten himmelwärts.
„He, Naki, rein mit dir ins Boot!“, rief ihm Doki zu. „Komm schon, es ist höchste Zeit, von hier zu verschwinden!“
Auch die anderen, denen die Erleichterung darüber, dass der Vermisste endlich doch noch aufgetaucht war, ins Gesicht geschrieben stand, riefen ihm scherzhaft zu, ob er vielleicht eingeschlafen sei. Freudig streckten sie ihre Arme nach ihm aus, um ihn ins Boot zu ziehen.
Doch Naki reagierte völlig unerwartet.
Die anfängliche Freude der Freunde über das Wiedersehen verwandelte sich unversehens in Bestürzung, ja Grauen, als sie gewahr wurden, dass Naki sich auf den Bauch drehte und von den Kanus wegzukraulen begann.
„Naki! Naki!“, schallte es vielstimmig.
Doki war der Erste, der handelte. Geschmeidig wie ein Seeaal ließ er sich über den Bootsrand ins Wasser gleiten und schwamm Naki nach. Die anderen folgten mit den Kanus. Als er den Schamanensohn eingeholt hatte, begann er auf ihn einzureden. „He, bist du verrückt geworden? Blei hier! Wo, in aller Götter Namen, willst du hin? Willst du etwa nach Hause schwimmen? Wenn ja, dann ist das die falsche Richtung!“
„Lasst mich alle einfach nur in Frieden!“, rief Naki ihm gereizt zu, und dann mit leiserer Stimme, als ob er zu sich selber spräche: „Ich bin fertig mit dieser Welt!“
Doki war einen Moment geschockt vom Verhalten seines Freundes, doch dann packte er Naki entschlossen bei einem Arm, um ihn aufzuhalten. Naki reagierte wie ein angestochener Eber. Das Wasser schäumte, als er versuchte, von Doki loszukommen. Dieser wiederum trachtete danach, ihn in einen Würgegriff zu bekommen, der es ermöglichte, seinen Widerstand so weit zu drosseln, dass ihn die anderen endlich ins Boot ziehen konnten. Der Schmerz über den Tod Namis schien Naki tatsächlich den Verstand geraubt zu haben.
Irgendwann hatten beide Kombattanten so viel Salzwasser geschluckt, dass sie erschöpft voneinander abließen. Würgend und spuckend wandte sich Doki den anderen zu und machte eine Geste der Hilflosigkeit. Betroffen sahen diese zu, wie Naki sich mit matten Schwimmzügen wieder entfernte, bis ihn das Dunkel, das ihn vor kurzem so unverhofft ausgespuckt hatte, wieder verschluckte. Eine Weile hörten sie noch das Patschen seiner Arme und Beine auf dem Wasser, dann wurde es vom Geräusch der Wellen überlagert und sie wussten, dass sie Naki niemals wiedersehen würden.
Die ferne Küstenlinie von Gali lag noch im Finster der Nacht. Es war nicht leicht, bei wolkenverhangenem Nachthimmel zu navigieren, doch die Kunst der Navigation war seit Urzeiten von einer Generation an die nächste weitergegeben worden und schien sich mittlerweile in den Genen der Inselbevölkerung verankert zu haben. Außerdem wurden von den Alten Skizzen der Strömungen, die zwischen den Inseln dahinzogen, Wellenarten und -formationen sowie die jahreszeitlichen Hauptwinde mit Stöcken so oft in den Sand des Strandes gemalt, bis sie die Jungen mit geschlossenen Augen nachzeichnen konnten. Nach etwa zwölf Sommern hatte jeder Inselbewohner eine imaginäre Karte in Kopf und Gefühl gespeichert, die es ihm wie einem Zugvogel erlaubte, auch ohne einen Blick auf die Sternbilder, sein angesteuertes Ziel zu erreichen.
Doki hörte plötzlich zu paddeln auf. Schon seit einer Weile war ihm, als sei sein Wesen aus dem Gleichgewicht geraten. Als habe sein Körper eines seiner Glieder verloren. Das Gefühl der Ganzheit war gestört.
Etwas fehlte! Etwas von großem Gewicht... etwas, das gleich jedem seiner Organe eine lebenswichtige Funktion für ihn erfüllte.
„He, bleib gefälligst im Takt!“, riefen ihm die anderen im Boot zu.
Doki griff sich jetzt an den Hals und erstarrte.
Sein Woko war weg!
Angst und Schrecken fuhren ihm eiskalt durch die Glieder und ein erstickter Schrei drang aus seiner zugeschnürten Kehle.
„Was ist los mit dir?“, fragte sein Vordermann im Kanu und warf ihm über die Schulter einen verärgerten Blick zu.
Doki war unfähig zu antworten. Mit weit aufgerissenen Augen patschte er nur immer wieder mit der flachen Hand auf seine Brust. Jetzt sahen auch die anderen, was los war. Das schwarze Holzplättchen aus Steinpalme mit dem eingekerbten Zeichen, das einem Vogel im Flug glich, baumelte nicht mehr um den Hals des Häuptlingssohns. Es musste bei der Rangelei mit Naki abgerissen sein.
Unbemerkt von den Jungkriegern in den beiden Kanus schwirrte hoch über ihnen ein kleiner Schwarm von Donks am Nachthimmel.
Das Land der Götter
5
Drei Monate später.
Etwa 3000 Seemeilen nördlich der hermetisch abgeriegelten Inselwelt von Gali, Bombor und Nogodai erstreckte sich ein riesiger Kontinent namens Korr, auf dem sich über die Jahrtausende eine hochzivilisierte Gesellschaft entwickelt hatte.
Die Korri, wie sich die Bewohner dort nannten, hatten im Laufe der Zeit eine Unzahl von Genies in allen Bereichen der Wissenschaft und Kultur hervorgebracht. Die Früchte dieses nie versiegenden Erfindergeistes prägten ihr Alltagsleben mittlerweile bis ins kleinste Detail. Niemals hätten sie sich vor 10000 Jahren, als Feuersteinwaffen noch die höchste technische Innovation darstellten, träumen lassen, dass sie einmal mit ausgeklügelten Apparaten die Lüfte erobern und wie Vögel fliegen würden. Nicht der Fantasiebegabteste unter ihnen hätte sich in jener dunklen Vorzeit ausmalen können, dass man sich zehn Jahrtausende später über geheimnisvolle Signale im Äther mit Freunden am anderen Ende der Welt zu einem Video-Schwätzchen würde treffen können, ganz so, als säße man ihnen leibhaftig gegenüber.
Irgendwann auf ihrem Weg durch die Zeit hatten die Korri Glaube, Geduld und Vertrauen in den einstmals ehernen Grundsatz verloren, dass die Götter und die Natur schon alles richten würden. Nachdem sie ihre Götter als Wunschtraum ihres unterentwickelten Selbstbewusstseins entlarvt und deren Tempel zu Museen umfunktioniert hatten, war die Natur in den Fokus ihres Interesses bzw. ihrer Kritik gerückt.
Unisono warf die geistige Elite von Korr dieser Natur vor, dass sie bei der Verrichtung ihrer Aufgabe, die Welt möglichst annehmbar zu gestalten, mit unerträglicher Gemächlichkeit vorgehe. Man bemängelte, dass sie sich immer wieder in aberwitzige Experimente verstricke, deren haarsträubende Ergebnisse oft erst nach Äonen offenbar würden und dann nicht mehr reparabel seien.
Einer der unzähligen Kritikpunkte war z.B. das frühe Verfallsdatum menschlicher Organe. Ihre Fehleranfälligkeit und Verschleißfreude waren ein absolutes No-Go für einen Apparat, der das weitest entwickelte Gehirn auf Erden mit Energie versorgen sollte. Perfektionsorgane wurden deshalb in der Retorte gezüchtet und in speziellen Baumärkten, nebst ambulantem Installationsservice, zum Verkauf angeboten.
Ein weiterer Kritikpunkt war, dass im gesamten Schaffen und Streben der Natur nicht der Ansatz einer zielgerichteten Absicht zu erkennen war. Sie begnügte sich mit dem Sein. Chaos und Ordnung waren ihr einerlei. Sie brauchte keinen Grund für ihre Existenz und selbst für das barbarischste ihrer Experimente forderte sie nachträglich vom Rest aller Lebensformen strikte Anpassung ein.
Natürlich konnte ein so simples Konzept wie „Friss oder stirb! Biege dich oder breche!“ ein intelligentes Wesen nicht lange begeistern. Entlarvend für die Beliebigkeit ihres Schöpfungsrausches war, dass die Natur mit dem Menschen sich selbst einen ewig nörgelnden Kritiker geschaffen hatte. Plötzlich wurden ihre Aktionen hinterfragt und in der scheinbaren Willkür ihres Waltens – wenn auch bisher vergeblich - nach etwaigen roten Fäden von Sinn und Logik geforscht. Doch auch im Falle dieses Kritikers auf zwei Beinen, würde sich erst in ferner Zukunft herausstellen, ob der Natur mit ihm ein noch nie da gewesener Coup gelungen war, oder ob es sich dabei nur wieder mal um einen ihrer unzähligen Lapsi gehandelt hatte.
Die Korr’schen Wissenschaftler jedenfalls hatten das Wirken der Natur nach und nach als gefühllosen blutleeren Mechanismus entlarvt, der vor Urzeiten versehentlich oder absichtlich, von wem auch immer, in Gang gesetzt worden war. Vielleicht, so resümierten einige von ihnen, war die Welt ja nur ein gigantisches Versuchslabor, in dem Wesen einer anderen Dimension ein Experiment gestartet hatten, das ihnen zu riskant erschienen war, um es in ihrer eigenen Dimension zu wagen; ein Experiment unter sterilen Bedingungen so zu sagen, das in einem versiegelten Labor stattfand, aus dem nichts entweichen und in das nichts hineingelangen durfte, was den Ablauf hätte stören können.
Möglicherweise war dieses Experiment bei seinen Urhebern auch schon längst in Vergessenheit geraten, oder man hatte frühzeitig erkannt, dass es sich nicht wunschgemäß entwickelte und seine Aufmerksamkeit wieder anderen vielversprechenderen Versuchen zugewandt. Kurzum, die Gelehrten der Korri waren zu dem Schluss gelangt, dass alles Leben im ihnen bekannten Kosmos auf sich selbst gestellt war. Hilfe von außen war mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht zu erwarten. Nicht nach 14 Milliarden Jahren, die das Experiment schon andauerte. Da hätte in der Zwischenzeit längst schon mal ein Verantwortlicher vorbeischauen müssen, um nach dem Rechten zu sehen - und sei es auch nur aus Langeweile.
Im Grunde gab es nur eine einzige Lösung für die an diesem Experiment beteiligten Laborratten: Sie mussten Intelligenz entwickeln. Viel Intelligenz. Hohe Intelligenz. Intelligenz, die sie dazu befähigte, den Mechanismus der Natur, die gleichzeitig ihr Zuhause wie ihr Käfig war, zu steuern. Sei es, um sich in ihrem Gefängnis nach eigenem Gutdünken einzurichten oder irgendwann aus ihm auszubrechen, um den verantwortlichen Versuchsleiter zu lynchen.
***
Das Mädchen mit dem schulterlangen braunen Haar, in dem sich durch Sonneneinwirkung reizvolle flachsblonde Strähnen gebildet hatten, kam mit ihrem Surfboard gerade vom Strand zurück. Es war ein Privatstrand, der zum Anwesen ihrer Familie gehörte. Sie trug einen zitronengelben Bikini. Ihre rehbraunen Augen verstrahlten tiefe innere Ruhe und Gelassenheit und ihrem sonnengebräunten durchtrainierten Körper sah man an, dass sie zu den passionierten Outdoor-Typen zählte. Eine Aura von Frische und Natürlichkeit umgab sie, was selten geworden war in ihrer Altersgruppe der 16-Jährigen. Ihre Bewegungen waren geschmeidig wie die einer Katze und graziös wie die einer Tänzerin.
Korina stellte ihr Board vor dem kleinen Badehaus ab, das direkt an den Bootsschuppen angebaut war, brauste sich unter der Außendusche den Sand aus den Haaren und trabte dann locker die Stufen hinauf, wo auf einer Felsplattform eine feudale Strandvilla aus Glas und Beton in den azurblauen Himmel ragte – der Familiensitz der Tongs.
Roger Tong lag auf einer Liege am nierenförmigen Skypool und verfolgte den auf sein Brillenglas projizierten News-Live-Stream von KKC World. Neben ihm, auf einem Servierwagen aus poliertem Messing, ein Kristallpokal mit einem knallroten Softdrink, in dem ein giftgrüner Limettenschnitz dümpelte. Er trug weiße Badeshorts von Luigi Delmonte und ein Muskelshirt von Cees Vandenbrinck. Der Shortcut seines schwarzen Haares wirkte klassisch elegant und sein gleichmäßig gewachsener Körper hatte nach der ersten Urlaubswoche bereits die angenehme Bräune von dunklem Waldhonig erreicht.
„Schau mal, Paps, was auf den Wellen getrieben ist! Ist das nicht wunderschön?“ Mit diesen Worten hielt das Mädchen ihrem Vater die ausgestreckte Hand entgegen.
„Wunderschön, Korina, wunderschön...“, murmelte Roger Tong. Doch Korina merkte an seiner Augenstellung, dass er noch immer auf den eingespielten News-Stream fixiert war.
„Jetzt guck doch mal, Paps“, beharrte sie und hielt ihm ihr Fundstück direkt unter die Nase.
Roger Tong seufzte, beendete mit einem Klicklaut der Zunge die Übertragung von KKC World, schob seine KI-Brille auf die Stirn und betrachtete den Gegenstand auf der Handfläche seiner Tochter. Als er erkannte, um was es sich dabei handelte, setzte er sich ruckartig auf.
„He, woher hast du das?“, fragte er überrascht.
„Sag ich doch... aus den Wellen gefischt!“
Tongs mandelförmige Augen blickten für einen Moment aufs Meer hinaus Richtung Süden.
„Du weißt, was das ist?“
Korina blickte auf das dunkle Objekt in ihrer Hand. Ein Zeichen war darauf eingekerbt, ein Zeichen, das einem Vogel im Flug glich.
„Na klar, weiß ich, was das ist! Jedes Kind, das schon mal eine Staffel der Zeit-Zoo-Show gestreamt hat, weiß, dass es sich hierbei um ein Woko handelt.“
„Ja, Liebes“, meinte Roger Tong mit nachdenklich zusammengezogenen Augenbrauen, „aber was du da aus dem Meer gefischt hast, ist keine billige Kopie aus einem der vielen Zeit-Zoo-Fanshops, sondern ein Original.“
Korina war baff. „Glaubst du wirklich?“
„Sieh es dir genau an! Es ist aus dem schwarzen Holz der Steinpalme geschnitten, die ausschließlich auf den Inseln des Zeit-Zoos gedeiht.“ Und Roger Tong musste es schließlich wissen, denn er gehörte dem Verwaltungsrat des Zeit-Zoo- Projekts an. „Wenn du das zur Versteigerung freigibst, werden sich die Mitglieder der Zeit-Zoo-Fanclubs mit ihren Geboten überschlagen. Es würde dir eine hübsche Summe einbringen, mit der du dir eins dieser neuen selbstsurfenden Powerboards finanzieren könntest.“
„Paps, du solltest endlich begreifen, dass ich Puristin bin, was den Surfsport anbelangt. Solche Bretter sind nur was für bewegungsfaule übergewichtige Kids. Nein Danke!“
„Aber du könntest dir beim Surfen nebenbei die Nägel lackieren... oder einen Schal stricken“, meinte Roger Tong augenzwinkernd. Er genoss es, wenn er seine Tochter dazu bringen konnte, ihre Krallen auszufahren und sich klar und deutlich zu positionieren. Das war eine wichtige Trainingseinheit für ihre Zukunft.
„Täusch ich mich, oder versuchst du wieder mal, mich gegen den Strich zu bürsten?“, fragte Korina mit schief geneigtem Kopf. „Damit hast du heute leider keine Chance, Paps, nach einem Surftrip bin ich nämlich tiefenentspannt. Außerdem denke ich gar nicht daran, dieses Woko zu verkaufen. Wenn es tatsächlich echt ist, wie du sagst, dann ist es eine Seltenheit... dann ist es wie ein vom Himmel gefallener Stern... wie eine Botschaft aus einer anderen Welt!“
***
Als das erste Schiff der Korri mit dem Namen „Korina“ vor vielen hundert Jahren die Inselwelt von Gali, Bombor und Nogodai entdeckte, traf die Besatzung dort auf menschliche Wesen, die noch wie in der Steinzeit lebten. Nur der Weitsicht des Kapitäns, eines gewissen Gung Tscha, war es zu verdanken, dass sich ihre Kultur, ungestört von äußeren Einflüssen, in dem ihr eigenen Rhythmus weiterentwickeln konnte.
Tscha, dessen Steckenpferd die Anthropologie war, erkannte auf Anhieb die Besonderheit, ja, die Einzigartigkeit seiner Entdeckung. Kaum in die Heimat zurückgekehrt, versuchte er alles, um die Regierung von Korr von der Schützenswürdigkeit des abgelegenen Inselarchipels zu überzeugen.
Dank seiner unerschütterlichen Hartnäckigkeit, seines brachialen Seemanncharmes und der Fähigkeit zu schmeicheln, wo logische Argumente nichts auszurichten vermochten, gelang es ihm schließlich, die Mehrheit des Hohen Rats der Korri von seiner Vision einer versiegelten Zeitkapsel zu begeistern. Es sollte eine Investition in die Zukunft sein, ein Schatz, den man der Nachwelt erhalten wollte.
Das Mega Projekt „Zeit-Zoo“ wurde gestartet.
Wie zu Gung Tschas Zeiten noch üblich, überschrieb sich die Regierung von Korr die territoriale Souveränität über die Inselwelt in einem unspektakulären Verwaltungsakt selbst und verleibte die neu entdeckte Welt so dem eigenen Staatsgebiet ein. Das Reservat des Zeit-Zoos wurde für sakrosankt erklärt. Nichts durfte von außen hinein, nichts von innen hinaus.
Die ersten Maßnahmen, die man ergriff, beschränkten sich damals noch auf die Abriegelung des Schutzgebietes. Eine Armada schneller Segler patrouillierte in einem 100 Seemeilen breiten Korridor außerhalb der 350-Seemeilenzone um die Inselwelt und sorgte mit unerbittlicher Härte dafür, dass nichts und niemand diese Grenzlinie verletzte.
Die wenigen Kanus der Inselbewohner, die sich aufgemacht hatten, neues bewohnbares Land zu entdecken, wurden gnadenlos versenkt. „Mit Mann und Maus!“, lautete bis heute der eiserne Befehl. Kein Augenzeuge sollte zu den Inseln zurückkehren können, um zu berichten, dass es dort, weit draußen auf dem Meer, eine Blockadelinie gab, wo mächtige Schiffe mit noch mächtigeren Waffen kreuzten. Das hätte in den Augen der Korri zu einer psychischen Infektion der Inselbevölkerung geführt, die man genauso vermeiden wollte wie die Einschleppung von Viren und Keimen, gegen die die Menschen und viele endemische Arten der Inselwelt noch keine Abwehrstoffe entwickelt hatten. Die Begegnung mit der Besatzung der Korina sollte die einzige Erfahrung bleiben, die die Eingeborenen mit der Außenwelt gemacht hatten. Mit der Zeit würde auch diese Begebenheit in ihrer Erinnerung verblassen und nur noch in Sagen und Geschichten weiterleben.