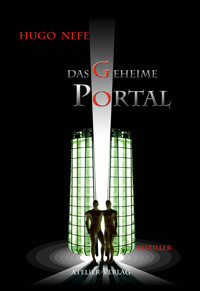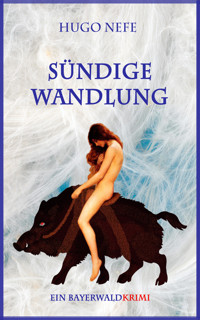
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ATELIER VERLAG
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ludwig hat sich nach einem traumatischen Erlebnis in seiner Jugend weitestgehend in sich selbst zurückgezogen. Nur ab und zu lädt er zu skurrilen Seminaren und Workshops in seinen abgelegenen Einödhof im Bayerischen Wald ein. Als dort eine Frau erscheint, die ihn an seine tragische Jugendliebe erinnert, bricht eine alte Wunde in ihm auf... Eine Verkettung unglücklicher Umstände zwingt Ludwig Schritt für Schritt zu immer makabreren Entscheidungen, bis schließlich die Grenze zwischen Schein und Sein für ihn verschwimmt. Liebe oder Wahnsinn? Täter oder Opfer? Schuld oder Unschuld?Diese Fragen bleiben in diesem eiskalten Thriller bis zur letzten Seite offen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Prolog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
EPILOG
HUGO NEFE
SÜNDIGE WANDLUNG
Atelier-Verlag
Alle Rechte vorbehalten!
© 2021 Atelier Verlag / Hugo Nefe
94363 Oberschneiding
https://www.nefe.de
„Was du liebst, das lasse frei!
Kommt es zurück,
dann gehört es dir – für immer.“
Konfuzius
Prolog
Ramona F. hatte sich schon oft gefragt, wie es wohl wäre, an ihrer eigenen Beerdigung teilzunehmen. Sie war jetzt 28, aber sie wollte nicht warten, bis sie gestorben war, um es herauszufinden.
Im Wartezimmer ihres Arztes war sie beim Blättern durch ein Magazin auf einen Artikel gestoßen, in dem es hieß, dass Scheinbeerdigungen in Südkorea gerade der volle Hype seien. Bei einer anschließenden Recherche im Internet stieß sie dann tatsächlich auf jemanden, der auch hier in Deutschland ein Seminar zu diesem Thema anbot.
Ramona F. liebte Seminare – je skurriler desto besser. Doch nahm sie nicht etwa daran teil, um sich fortzubilden, oder weil sie ein überzeugter Anhänger einer bestimmten Zeitgeistströmung gewesen wäre, sondern einzig aus dem Grund, ihre Zeit totzuschlagen. Zeit und Geld hatte sie genug – ein Umstand, der schon von jeher die ausgefallensten Wünsche weckte.
Der Mann bewarb sein Seminar mit dem vielversprechenden Slogan: „Gönn dir den 20-Minuten-Tod, um das Leben wieder zu genießen!“
Leider fiel der Termin des nächsten Seminars genau in den Zeitraum, in dem sie ihre dritte Psychotherapie am Bezirksklinikum Regensburg antreten sollte.
Der Umzug von Berlin und ihre zweite Scheidung hatten ein gewaltiges Loch in ihr soziales Netzwerk gerissen. Ein Großteil ihres Bekanntenkreises war weggebrochen und mit ihm etliche Zacken aus der Krone ihres Selbstwertgefühls. Leider hatte sie zu spät erkannt, dass viele ihrer sogenannten Freunde nur Gesinnungsgenossen waren – Gesinnungsgenossen ihres Mannes, dessen Gesinnung sie allzu bedenkenlos übernommen hatte, statt auch nach der Hochzeit noch an ihrer eigenen weiterzubasteln.
Das Job-Angebot, das ihr eine Regensburger Bank gemacht hatte, bot in keiner Weise die Karrieremöglichkeiten, wie sie sie in Berlin gehabt hätte, und so war sie erst mal zu Hause geblieben, um sich um die vielen Gäste zu kümmern, die in ihrer Villa in Lappersdorf, einem Vorort von Regensburg, ein und ausgingen.
Anfangs hatte es ihr sogar noch Spaß gemacht. Nach und nach aber zeichnete sich klar und deutlich ab, was ihr Umfeld wirklich an ihr schätzte – es war nicht ihre Persönlichkeit, es war ihre gesellschaftliche Funktion. Von da an begann der Wurm der Unzufriedenheit in ihr zu nagen. Als dann auch noch eine Affäre ans Licht kam, die ihr Mann – Chefarzt am Regensburger Klinikum, Halbgott in Weiß – mit einer Krankenschwester begonnen hatte, hing der Haussegen vollends schief. Alles wäre nicht so schlimm gewesen, wenn besagte Krankenschwester nicht auch noch schwanger von ihm geworden wäre. Das schmeckte bitter wie Galle, weil sie selbst keine Kinder mehr bekommen konnte.
Ihr Gatte war einsichtig – einsichtig allerdings auf seine ätzend überhebliche Art. „Du hast ja recht, Schatz“, hatte er Zerknirschung heuchelnd gemeint, „niemals mit dem Personal!“
Dies als Entschuldigung anzunehmen, hätte bedeutet, ihm selbst das Hintertürchen zu öffnen, das es ihm in Zukunft gestattete, auf alles Jagd zu machen, was sich außerhalb des Klinikbereichs herumtrieb.
Denkste! Sie war zwar in vielen Bereichen noch unerfahren, aber sie war auch nicht doof.
Sie besuchte etliche Scheidungsanwälte, bis sie schließlich auf den richtigen stieß: weiblich, bissig, selbst geschieden. Diese Qualifikation garantierte, dass das Feuer, das sie unter dem Hintern ihres Noch-Gatten zu entfachen gedachte, auch heiß genug sein würde.
Es war heiß genug.
Vielleicht ein bisschen zu heiß. Unbeabsichtigt hatte sie ihrem Ex den Status „Gegrillter Märtyrer“ verschafft, was seine Sympathiewerte in die Höhe schnellen ließ, während ihre eigenen drastisch sanken.
Einen um den anderen Namen musste sie aus ihrer Adresskartei streichen. Die Neueinträge, die jetzt darin erschienen, lasen sich wie das „Who is Who“ des Therapeutischen Gewerbes. Seelentröster jeglicher Couleur drängten sich jetzt in das Vakuum, das die abgefallenen Freunde und Bekannten hinterlassen hatten.
Ihr war klar, dass es sich dabei um nichts anderes als bezahlte Zuwendung handelte. Aber lieber bezahlte Zuwendung als gar keine, wenn man schon keinen mehr hatte, der sie einem schenkte.
Geld war kein Thema für sie. Zumindest in dieser Hinsicht waren ihre Scheidungen segensreich gewesen.
Ihren ersten Mann – 12 Jahre älter als sie – hatte sie mit 20 geheiratet. Nach drei Jahre, in denen jeder von ihnen seiner eigenen Karriere nachgegangen war – sie, bei einer Berliner Bank, er, als Gründer einer Softwarefirma, die er schließlich an die Börse brachte und kurz darauf für etliche Millionen verkaufte – war die Ehe zu Ende. Darauf folgten zwei Jahren Chaos in ihrem Leben: Reisen, Partys, Schönheitsoperationen und ein beträchtlicher Verschleiß an Männern – Männern für eine Nacht. Es war aber nicht unersättliche Lust, die sie in ihre Arme trieb. Vielmehr war der involvierte Sex nur eine unerwünschte Nebenwirkung dieser Medizin gegen die Einsamkeit. Sie nahm die Männer wie Notfalltropfen gegen die Angst allein zu sein; regelmäßig, automatisch und ohne großen Gefühlsaufwand – ex und hopp!
Dem Gros der Männer kam dies entgegen, weil sie schon von Natur aus eher hardware- als softwareorientiert waren. Für Ramona F. waren Männer in dieser Zeit eine Droge mit Kurzzeitwirkung, deren Dosis ständig erhöht werden musste, um noch zu wirken – ein Teufelskreis.
Dann lernte sie Max ihren zweiten Mann kennen. Er war Oberarzt an der Charité. 18 Jahre älter als sie. Ihr Hang zu älteren Männern wurde ihr damals bewusst. Es war Liebe auf den ersten Blick. Ekstase. Heirat folgte. Dann die Berufung ihres Mannes als Chefarzt an die Uni-Klinik Regensburg. Sie wurde schwanger. Fehlgeburt. Die Ärzte rieten von weiteren Schwangerschaften ab. Sie ließ sich sterilisieren. Von da an war es, als habe die Verödung ihrer Eileiter auch die seelische Befruchtung in ihrer Beziehung unterbrochen – ihre Ehe trocknete aus. Ihr Mann begann mit seinen geheimen Exkursionen in andere Feuchtgebiete. Wenig später dann, die unvermeidliche Scheidung Nr. 2.
Ramona F. war der Typ, der keine Ruhe gibt, bis er erreicht hat, was er sich in den Kopf gesetzt hat. Sie wollte dieses Seminar, und sie wollte es sofort. Das Motto „Gönn dir den 20-Minuten-Tod ...“ klang zu verlockend. Wenn sie nur daran dachte, bekam sie eine Gänsehaut. Gedanken an den Tod hatten bei ihr schon immer ein erotisches Prickeln ausgelöst. Die Verbindung von Tod und Eros hatte was von einer Schwulenehe – sie war ein Triumph des Geistes über die Natur.
Spontan hatte sie zum Telefon gegriffen und den Mann, der das Seminar veranstaltete, angerufen.
Mit ruhiger Stimme hatte er ihr erklärt, dass sein Seminarplan bereits feststehe und er des Aufwands wegen nur mit mindestens fünf Teilnehmern arbeite. „Kein Problem!“, hatte sie erwidert. „Ich bin bereit, auch die fünffache Kursgebühr zu zahlen, wenn Sie für mich einen Einzeltermin ermöglichen können. Gleich morgen! Ich brauche diese Erfahrung nicht irgendwann, ich brauche sie jetzt!“
„Cash?“, hatte der Mann gefragt, und ihre Antwort war: „Bar auf die Hand!“
Der Deal war abgeschlossen. Sie hatte wieder mal bekommen, was sie wollte.
Jetzt lag sie, nur mit einem weißen Leinenumhang bekleidet, in einem schlichten Sarg aus Fichtenbrettern und hörte das Dröhnen der Hammerschläge, mit denen der Mann den Deckel über ihr zunagelte.
Dies alles gehöre zum Ritual, hatte er ihr bei Kerzenschein und Weihrauchduft in seinem Einführungsgespräch erklärt. Sein Vortrag hatte sie tief berührt. Seine Worte waren Balsam für ihre wunde Seele gewesen.
Anschließend hatte er ihr noch ein Video gezeigt, in dem das Prozedere der Scheinbeerdigung zu den Klängen von Mozarts Requiem in D-Moll vorgestellt wurde. Dazu gehörte es auch, dass sie an einem Pult, das neben ihrem Sarg stand, einen Abschiedsbrief verfasste, in dem sie ihren Wunsch zu sterben ausführlich begründete. Sie sollte mit allem abschließen. Was bedingte, dass sie sich auch über die Verteilung ihres Vermögens Gedanken zu machen hatte. Das Ergebnis sollte sie, gleich einem Testament, ebenfalls zu Papier bringen.
Ramona F. war aber auf die Schnelle niemand eingefallen, dem sie aus Überzeugung irgendetwas hätte vermachen wollen. Ihre beiden Ehen waren kinderlos geblieben, und mit der Verwandtschaft hatte sie schon längst gebrochen. Sie war ein Einzelkind, aber auch zwischen ihr und den Eltern herrschte seit ihrer zweiten Scheidung Sendepause. Sie hatte deren biederes Lamento über ihre Bindungsunfähigkeit satt. Fragen wie „Was haben wir nur falsch gemacht, Liebes?“ oder Seufzer wie „Was ist doch, trotz liebevollster Aufzucht, für ein Widerborst aus dir geworden!“, hatte sie irgendwann nicht länger mehr ertragen.
In einem Anflug von augenzwinkerndem Galgenhumor hatte sie schließlich ihren Seminarleiter als Alleinerben eingesetzt. Was soll’s, dachte sie, ist ja nur für 20 Minuten.
Anschließend sollte dieses Testament nebst Abschiedsbrief von ihr eigenhändig verbrannt werden. In dem alten Kanonenofen, der da weiter hinten in dem düsteren Raum, der früher mal ein Stall gewesen war, vor sich hin wummerte. Alles würde bei diesem letzten Akt des Sterberituals in Rauch aufgehen, und sie wäre als neuer Mensch geboren.
Es konnten nicht mehr als vier Nägel gewesen sein, die der Kursleiter eingeschlagen hatte. Jetzt herrschte Ruhe und absolute Dunkelheit um sie.
Es war enger in dem Sarg, als sie gedacht hatte.
Tatsächlich war es eher eine Kiste, deren Deckel nicht wie bei regulären Särgen konisch aufgebaut war, sondern flach. Alles drehte sich ja nur um die Illusion.
Sie lag auf einer Steppdecke. Im Nacken ein Polster.
Wenn sie ihren Kopf zu heben versuchte, stießen Stirn und Nase nach wenigen Zentimetern an das Holz des Deckels. Ihre Arme lagen an den Außenwänden an. Kein angenehmes Gefühl. Aber darauf hatte sie der Mann hingewiesen und gemeint, sie solle sich auf eine Erfahrung gefasst machen, die unter die Haut ginge. Das war der Zweck der Übung. So musste es sein. Denn schließlich sollte sie aus diesem Ritual seelisch erfrischt und mit klaren Perspektiven für ihre Zukunft hervorgehen.
In der letzten Zeit hatte sie mehrere Suizidimpulse verspürt. Zunächst hatte sie diese wie den Ruf eines Geliebten empfunden, der um sie lockte und warb. Doch irgendwann wandelte sich diese Empfindung. Der Ruf wurde eindringlicher. Er wurde zum Kommando, dessen Echo nicht mehr aufhörte, in ihrem Kopf nachzuhallen. Das musste aufhören ... ein für alle Male! Deshalb die Psychotherapie, deshalb auch dieses Seminar.
Jetzt nahm sie den intensiven Harzgeruch wahr, und für einen Moment fühlte sie sich wie ein Käfer, der in Bernstein eingeschlossen war – starr, bewegungsunfähig, konserviert für die Ewigkeit.
Wie viel Zeit war schon vergangen?
Sie wusste es nicht.
Ihre Armbanduhr, ihr Handy und ihr Schmuck befanden sich in der Handtasche hinter dem chinesischen Paravent, wo sie ihre Kleidung gegen das Totenhemd ausgetauscht hatte. Alles hatte sie ablegen müssen. Nichts von Wert durfte sie auf dieser Scheinreise in den Tod begleiten. Das war die Regel.
Kein Lichtstrahl drang von außen durch die hölzernen Planken. Das Schwarz um sie herum war vollkommen.
Nach einer Weile, die ihr vorkam wie eine Ewigkeit, glaubte sie, kleine Lichtblitze zu sehen. Doch auch wenn sie die Augen schloss, waren sie da. Es konnte sich also nur um eine Gaukelei ihres über- oder unterforderten Gehirns handeln.
Dann kam die erste Welle der Angst, und sie brandete wie heiße Lava durch ihr Bewusstsein.
Sie fing zu rufen an.
Zaghaft zuerst, dann lauter und lauter, doch niemand antwortete.
O.K., logisch! Gehörte ja auch alles so zum Programm. Der Film hatte sie darüber aufgeklärt, dass es immer mindestens einen Teilnehmer gab, der schon nach den ersten Minuten zu rufen anfing, weil er das Zeitgefühl komplett verloren hatte. Sekunden dehnten sich in diesem abgrundtiefen Schwarz zu Äonen.
Sie hielt den Atem an und lauschte in das Nichts.
Nur das Klopfen ihres Herzens war da. Noch nie hatte sie es so laut vernommen. „Bubum ... bubum ... bubum ...“ wie ein SOS-Signal, das nach dem Ende aller Zeiten durch das leergefegte All pulste.
Das war’s! Sie hatte genug!
Vorstellung beendet!
Mit einem Bewusstseinserweiterungstrip hatte das nichts mehr zu tun. Das war Freiheitsberaubung! Das war Folter!
Sie drohte dem Mann, ihn anzuzeigen, wenn er nicht augenblicklich den Deckel öffnete.
Alles blieb still.
Dann kam die Panik und mit ihr das Adrenalin.
Massenhaft Adrenalin.
Sie begann zu strampeln. Doch die Enge des Raums begrenzte ihren Bewegungsspielraum drastisch. Zog sie ihre Beine nur ein wenig an, stießen ihre Knie sofort an den Deckel.
Jetzt versuchte sie es mit den Händen. Aber der Abstand zum Deckel war so gering, dass sie nicht genügend Kraft entfalten konnte, um ihn vielleicht ein wenig zu lockern.
„Bubum ... bubum ... bubum“, trommelte ihr Puls. Ansonsten herrschte Stille ... absolute Stille ... Totenstille.
Was war nur los mit diesem Kerl? War er nur eben mal aufs Klo gegangen, oder war er ... Nein, ein Freak war der nicht. Sie hatte die echten Freaks in der Psychiatrie kennengelernt. Dieser Mann aber hatte durch seine einfühlsame ruhige Art von Anfang an ihr Vertrauen gewonnen. Als er am Telefon hörte, dass sie wegen ihrer Medikamente nicht fahrtauglich sei – sie war zurzeit vollgepumpt mit einer bunten Mischung Psychopharmaka – hatte er sich sofort erboten, sie mit seinem Wagen vom Busbahnhof in Freyung abzuholen. Sie war mit dem Zug von Regensburg nach Passau gefahren und von dort mit dem Bus weiter nach Freyung. Eigentlich hatte sie vorgehabt, sich dort in einem Gasthof ein Zimmer zu nehmen und nach dem Seminar vielleicht noch einen weiteren Tag in dem kleinen Städtchen zu verbummeln. Doch der Mann hatte ihr angeboten, die Einliegerwohnung in seinem Haus zu benutzen und am nächsten Tag noch mit ihm und seiner Mutter zu frühstücken, bevor er sie wieder zum Busbahnhof bringen wollte. Nach kurzer Überlegung war sie darauf eingegangen. Sie war neugierig, wie er lebte. Etwas an ihm wirkte seltsam anziehend auf sie. Doch war es weniger sein Äußeres, als vielmehr etwas, das sie aus seinem Inneren heraus anstrahlte. Schon als er sie am Busbahnhof begrüßte, hatte sie verwundert den Ausdruck der Überraschung auf seinem Gesicht wahrgenommen – freudige Überraschung, verehrungsvolle Überraschung. Selig lächelnd hatte er sie von oben bis unten gemustert wie eine lange vermisste Person, die plötzlich wieder in seinem Leben aufgetaucht war. Noch nie hatte sie sich so herzlich willkommen gefühlt ... so angenommen ... so ganzheitlich umarmt.
Nein, dieser Mann hatte nichts zu verbergen, weil er nichts verbergen konnte! Sein Innenleben spiegelte sich auf seinem Gesicht wie eine Leuchtreklame.
Diese Gedanken beruhigten sie für einen Augenblick. Alles würde gut werden. Sicher würde sie schon bald genauso befreit auflachen wie die Kursteilnehmer auf dem Video ... Lauter strahlende Gesichter, aus denen der Triumph leuchtete, der Triumph über den 20-Minuten-Tod.
Jetzt merkte Ramona F. plötzlich, wie ihr das Atmen schwerer fiel.
War es nur Einbildung?
Angst konnte ja Empfindungen ins Surreale übersteigern. Doch nein, sie täuschte sich nicht. Ihre Lungenflügel pfiffen ein anderes Lied. Die Luft in ihrem Gefängnis wurde definitiv knapp.
Ein nie gekanntes Grauen befiel sie jetzt. Ein Grauen, das sich wie Gift in ihrem Körper ausbreitete und nach und nach all ihre Glieder lähmte. Wieder versuchte sie zu schreien, doch diesmal kam kein Laut mehr über ihre Lippen. Horror und blankes Entsetzen schnürten ihr die Kehle zu. Auf ihrer Stirn stand kalter Schweiß. Ihr Herzschlag – ein höllisches Trommelfeuer, das ihre Brust zu sprengen drohte. Dann schwanden ihr die Sinne.
1
Auszug aus dem Tagebuch der Magdalena Grünzinger vom 08. März 1974.
– Meine Tage sind ausgeblieben!!!
Geschieht mir recht, mir dummen Dirn. Hab mich halt geschämt, unsern Doktor, der was auch im Kirchenrat sitzt, um die Pille zu fragen. Außerdem habe ich nie nicht damit gerechnet, daß mich das heiße Blut so packt. Hab immer gedacht, mir kann das nicht passieren. Kann nur einem Flietscherl passieren, was keinen rechten Glauben hat. Ich glaub an die Keuschheit vor der Ehe und geh jeden Sonntag zur Mess, aber es ist trotzdem passiert.
Hätt letzte Woch daheim bleiben und nicht auf den Faschingsball gehen sollen. Alles Narren dort, und ich die Obernärrin! Aber die Stimmung war so gut und das Bier hat mir auch geschmeckt.
Tanzt hab ich nur mit zwei Burschen. Mit dem Sepp und mit dem Walter. Der Sepp hat beim Tanzen geratscht und gelacht, der Walter hat mich nur angeschaut … angeschaut hat der mich, daß mir ganz anders worden ist.
Am End bin ich dann mit dem Schaugerten heimgegangen, also mit dem Walter. Ich war wie hipnottisiert von ihm und hab ihn heimlich in meine Kammer lassen. Dort haben wir es gemacht. Und jetzt hab ich den Dreck im Schachterl. Hat sich seitdem nicht mehr bei mir blicken lassen, der Lump!
Zu all dem Schreck kommt heut auch noch die Trudi vorbei und erzählt mir, daß sie sich verliebt hat. In wen frag ich, und sie sagt in den Walter.
Ist dieser Schuft doch ohne mich gleich auf die nächsten Bälle gegangen und hat mit anderen angebandelt, als ob nichts gewesen wär zwischen uns!
Mir ist auf einmal ganz schlecht geworden, aber ich hab mir nichts anmerken lassen vor der Trudi, obwohl ich ihr am liebsten ins Gesicht hätt speiben mögen.
Habt ihr was gehabt miteinand, frag ich die Trudi, und sie sagt: Dreimal darfst raten.
Ich hab der Trudi nichts erzählt vom Walter und von mir, aber ich hab ihr gesagt, daß ich glaub, daß der Walter kein Mann zum Heiraten ist. Drauf sie: Das werden wir schon sehn!
Soll sie ihn ruhig haben, den Hallodri. Ich brauch keinen, den was ich daheim anbinden muß, damit er die spreizgeilen Henner nicht nachsteigt.
Heilige Jungfrau Maria, steh mir bei! –
Das kleine Kreisstädtchen Freyung mit seinen 7000 Seelen liegt im Südosten des Bayerischen Waldes im Dreiländereck. Zur tschechischen Grenze im Norden sind es 17 Kilometer, zur österreichischen im Osten 27 und zur Dreiflüssestadt Passau im Süden 33. Es ist die Gegend, wo die Leute so klingende Namen wie „Aschenbrenner“, „Kandlbinder“, „Hitzenbichler“, „Brodinger“, „Duschl“, „Atzinger“, „Blumenstingel“, „Irlesberger“ oder „Gibis“ tragen. Dort wo es üblich ist, dass man dem Namen eines Freundes oder guten Bekannten auf Biegen und Brechen ein „ei“ anhängt, egal, was dabei herauskommt. So wird aus Duschl „Duschei“, aus Blumenstingel „Bluamastingei“, aus Gibis „Gibisei“ und so fort. Dieses kleine Anhängsel drückt Vertrautheit aus und ist ein Prädikat der Zugehörigkeit. Wo dieser Brauch herrührt, weiß heute niemand mehr genau zu sagen, doch hält man hier eisern daran fest.
Der städtische Tourist dieser Tage mag die Gegend immer noch als ein Paradies der Abgeschiedenheit und Ruhe empfinden, doch die älteren Waldler lächeln nur darüber. Sie wissen noch, was echte Einsamkeit ist.
Nach dem Zweiten Weltkrieg starben hier ganze Dörfer wegen Abwanderung aus. Es gab nicht genug Arbeit und Brot für alle. Niemand, den sein Geschäft nicht dazu zwang, ließ sich freiwillig in dieser gottverlassenen Gegend nieder. Hier war das Ende der Welt. Im Norden die unüberwindbare Barriere des Eisernen Vorhangs und nach Süden hinunter nur die B12, eine kurvenreiche und gefährliche Verkehrsader, die das Leben im Wald mit der Außenwelt verband. Doch auch diese Straße war in den schneereichen Wintern von damals oft nicht mehr befahrbar. Man war vom Rest der Welt buchstäblich abgeschnitten.
Das war Einsamkeit! Eine Einsamkeit, die diejenigen, die blieben und ausharrten, dichter zusammenrücken ließ und einen ganz eigenen Menschenschlag prägte: an Leib und Seele abgehärtet, herb bis rau im Umgang miteinander und für den Fremden keineswegs leicht zugänglich.
Das änderte sich erst, als um 1960 ein 650 Mann starkes Panzergrenadierbataillon in der Kaserne „Am Goldenen Steig“ stationiert wurde. Dieser Außenposten gegen die „Rote Gefahr“, der sich aus Soldaten zusammensetzte, die mit ihren Familien aus ganz Deutschland hierher versetzt wurden, sicherte von da an den wirtschaftlichen Aufschwung des kleinen Städtchens. Der Wohnungsbau kam in Schwung. Rechts und links der Böhmerwaldstraße, hinauf zum Oberfeld, der „Soldatensiedlung“, ragten jetzt teils dreigeschossige Wohnblöcke in den Himmel. Diese terrakotta-, ocker- und umbrafarbenen Monumente einer neuen Ära, denen das alte Freyung nichts Vergleichbares entgegenzusetzen hatte, kündeten nun schon von Weitem von Aufbruchsstimmung und einem Wandel der Zeiten.
Der Umsatz der Wirtshäuser stieg, der Einzelhandel florierte. Oben in der Soldatensiedlung experimentierte ein waghalsiger Geschäftsmann sogar mit dem ersten Selbstbedienungsladen der Region – eine unerhörte unternehmerische Eskapade seinerzeit. Weitere folgten seinem Beispiel und bezahlten ihre Risikobereitschaft in den ersten Jahren mit erheblichem Warenschwund. Der Begriff „Selbstbedienung“ war noch nicht klar genug definiert. Die Kundschaft, die bisher wie Melkvieh vor Ladentheken und Schranken auf Bedienung zu warten hatte, war vom freien ungehinderten Zugang zu den Waren schlichtweg überfordert und bedurfte erst einer kostspieligen Umerziehung. Für sie galt das Motto: „Der Laden ist groß, die Frau an der Kasse ist weit!“
Als dann Truppen des Warschauer Pakts 1968 die CSSR besetzten, um den „Prager Frühling“ zu stoppen, und das dumpfe Dröhnen russischer Panzer jenseits der Grenze bis hinüber nach Philippsreut zu hören war, da tauchte der Name „Freyung“ sogar deutschlandweit in den Abendnachrichten auf.
So schlecht diese Nachrichten auch waren, man war für einen Wimpernschlag in den Fokus des öffentlichen Interesses gerückt – man war plötzlich wer.
Die Grenzlandbewohner waren jetzt nicht mehr die unterentwickelten Hinterwäldler der Nation, sondern die tapfere Vorhut, die zuerst vom Feind überrannt werden würde. Ganz Deutschland klopfte ihnen in Gedanken auf die Schulter.
Auch der Kaugummi kauende „Große Bruder“ zeigte Präsenz. Farbige, die damals noch „Neger“ hießen, befuhren in Jeeps und klirrenden Kettenfahrzeugen die Straßen und teilten an Pulks neugieriger Kinder „Chewing Gum“ und „Candy“ aus, wie schon damals in der Besatzungszeit. Der Spruch „Nach dem Krieg ist vor dem Krieg“ leuchtete in jenen Tagen jedem ein. Zu nahe war man der Katastrophe dort im Grenzland, wo ein Funke genügt hätte, um die Pulverfässer dies- und jenseits des Eisernen Vorhanges in die Luft zu jagen.
Als in den 70ern auch noch der Tourismus in Fahrt kam und am Geyersberg, wo früher Tag und Nacht die Feuer einer offenen Mülldeponie schwelten, das Postkartenvorzeigeprojekt einer Feriensiedlung, mehrerer Hotels und einer Reha-Klinik in Angriff genommen wurde, da war es plötzlich vorbei mit der Dunkelheit der Nichtexistenz. Da lichtete sich der Schleier und das kleine Städtchen Freyung erwachte endgültig aus seinem Dornröschenschlaf.
***
Über Nacht war der erste Schnee gefallen.
Das kleine Anwesen von Magdalena Grünzinger lag abseits der FRG14, die von Freyung nach Herzogsreut führte. Nur ein schmaler Feldweg ging von der Straße hinauf zu ihrem versteckt gelegenen Sachl, einem Einfirsthof: Wohnhaus, Stall und Scheune – alles unter einem Dach. Die hölzernen Dachschindeln waren irgendwann durch Blechplatten ersetzt worden. Das Untergeschoß bestand aus Bruchsteinmauerwerk, geschlagen aus den Granitblöcken, die bei Rodungs- und Feldarbeit im Weg gewesen waren. Darüber bildete dunkles Balkenwerk das Obergeschoß, in dem ihre Schwiegereltern bis zu ihrem Tod gelebt hatten. Später hatte sich ihr Sohn Ludwig dort eingerichtet, bis er vor ein paar Jahren ein rot gestrichenes Einfamilienhaus in die oberhalb des Altbaus gelegene Wiese gestellt hatte, das er jetzt bewohnte – ohne Familie. Daneben ein länglicher Anbau mit hohen schmalen Milchglasfenstern, den er sein „Labor“ nannte. Dort schloss er sich oft tagelang ein und arbeitete an seinen Tierpräparaten und an was sonst noch allem; Magdalena Grünzinger hatte den Anbau nie betreten, er war tabu für sie.
Wenn man sich dem Anwesen über den Feldweg hinauf näherte, schien es, als sitze der Neubau dem Altbau direkt im Nacken. Er wirkte dort ähnlich deplatziert wie eine künstlich eingefärbte Cocktailkirsche auf einer gegrillten Schweinshaxe.
„Bunker“ nannte Magdalena Grünzinger den Neubau und hatte sich bisher standhaft geweigert, darin die kleine Einliegerwohnung zu beziehen. Sie war bis heute im Altbau geblieben, wo ihr verstorbener Mann, ein Jahr nach ihrer Hochzeit, ein richtiges Bad mit Toilette installiert hatte. Luxus pur! Für Warmwasser sorgte seitdem ein Boiler in Bad und Küche. Als Heizung fungierte nach wie vor der große Küchenherd, dessen gemauerte Züge in einen Kachelofen mündeten, der seine Wärme durch eine Lüftungsklappe auch an die Schlafkammer abgab.
Das waren noch Zeiten gewesen, als sie bei Wind und Wetter durch Schnee und Kälte zum Außenklo neben dem Gemüsegarten stapfen musste ... nachts mit der Taschenlampe.
Freilich hatte man fürs „kleine Geschäft“ ein Potschamperl unter dem Bett stehen, doch wehe, wenn einen Schwereres drückte!
Hui, wie es da aus dem schwarzen Loch heraufzog, wenn man in eisigen Winternächten den hölzernen Deckel von der Latrine hob! Jeder Gang zum „Häusl“ war ein schauriges Ereignis – ein Kreuzweg.
Das Toilettenpapier war damals noch einlagig, aber mit Doppelfunktion. Bei längeren Sitzungen konnte man sich die Zeit damit vertreiben, zu lesen, was darauf gedruckt stand. Es handelte sich in der Regel um Bögen von Zeitungspapier, die sorgfältig in ein handliches Format zerrissen worden waren.
So lange Magdalena Grünzinger denken konnte, war der Hof von der Sippe der Grünzinger bewirtschaftet worden. Der Gründer des Hofes allerdings, wie aus einer alten Urkunde hervorging, war ein gewisser Sebastian Krückl gewesen. Und wenn sie die Leute nicht „die alte Leni“ nannten, so war sie für jedermann nur die „Krücklin“.
***
Leni erwachte wie jeden Morgen um halb sechs Uhr und tat, was sie immer tat, wenn sich der Schaum von Schlaf und Traum aus ihren Gedanken verflüchtigt hatte und sie im Hier und Jetzt angekommen war – sie sprach ihr Morgengebet. Stumm. Doch ihre welken Lippen bewegten sich dabei, als würde sie von himmlischem Nektar nippen. Ihre Hände waren über der Brust gefaltet. Wind und Wetter hatten ihr Gesicht gegerbt. Das Leben mit all seinem Glück und Unglück hatte über die Jahre seine Spuren darauf hinterlassen – Spuren wie in Stein gemeißelt.
Jetzt schlug sie das dicke Federbett zurück, tastete nach dem Schalter der Nachttischlampe und knipste das Licht an. An der Wand am Fußende des Bettes tauchte ein Kruzifix auf. Es war flankiert von zwei Öldrucken, die mit den Jahren so nachgedunkelt waren, dass sie nur noch die Silhouette der Madonna und des Heilands erkennen ließen. Den einzigen Kontrast lieferte ein Hauch von Schimmel, der sich unter dem Glas des Rahmens wie ein Schleier des Vergessens über die verehrten Idole gelegt hatte. Neben der Tür stand ein schwerer dunkler Schrank aus Massivholz, der so oft überstrichen worden war, dass die gerissenen Farbschichten darauf anmuteten wie die versteinerte Haut einer Urzeitechse. Sicher hätte dieses kastenförmige Möbel ähnliche Geschichten zu erzählen gewusst wie die Falten im Gesicht der alten Leni. Obendrauf stapelten sich bis zur Decke abgestoßene Kartonagen von unterschiedlicher Größe. Allesamt waren mit vergilbten Etiketten versehen. Nur auf wenigen davon ließ sich die verblasste Beschriftung noch entziffern. „Christbaumschmuck“, „Mein Brautkranz“, oder „Ludwigs Kommunionkerze“ stand da zu lesen. Aus einem abgegriffenen Schuber ragte der Rücken eines dicken, in Leder gebundenen Buches hervor. Auf dem Etikett waren nur noch die Buchstaben „Me. T.ge..uch“ auszumachen. Den Rest der Lettern, die dem Geschriebenen einen Sinn hätten geben können, hatte die Zeit ausgelöscht, wie sie alles auslöschte, was einmal Sinn und Namen hatte.
Leni ließ jetzt ihre Beine über die Bettkante baumeln und wartete, bis sich ihr Kreislauf stabilisiert hatte. Ihr wurde in letzter Zeit öfter schwindlig, wenn sie zu schnell aufstand. Erst gestern war sie in der Küche gestürzt und hatte sich eine Prellung am Gesäß und eine Beule am Kopf zugezogen. Gab es für jemand, der sich inwendig so jung wie eh und je fühlte, überhaupt etwas Ärgerlicheres als zu altern?
Vor kurzem hatte sie ihren 67. Geburtstag gefeiert. Gefeiert? Nein, das traf es nicht. Sie hatte ihn als Datum auf dem Abreißkalender an der Küchenwand registriert. Das war alles. Ludwig hatte ihr eine Woche später nachträglich gratuliert.
„Ach, Ludwig, Ludwig ...“, seufzte sie.
Der Bub hatte sich so seltsam entwickelt, nachdem ihm damals der Strohballen auf den Kopf gefallen war. Gerade mal zwölf Jahre alt war er gewesen, als das Unglück geschah.
***
Josef, ihr Mann, arbeitete wie immer oben auf dem Heuboden und warf durch eine Luke ein paar Ballen Stroh in den Stall hinunter, die Ludwig aufzuschneiden und einzustreuen hatte. Wahrscheinlich rechnete Ludwig nicht mehr mit dem letzten Ballen, der ihn zu Boden warf und seinen Kopf auf das Steinpflaster knallen ließ.
13 Wochen lang lag er danach im Freyunger Krankenhaus und starrte reglos an die Decke. Sein kleiner Brustkorb hob und senkte sich. Er atmete. Sein Herz schlug. Seine Verdauung funktionierte. Doch er selbst schien sich in einer weit entfernten anderen Welt aufzuhalten. Kein Streicheln, kein Küssen, kein Zureden, kein Zwicken oder Rütteln konnte ihn zu einer Rückkehr in diese Welt bewegen.
Nach vier Wochen tat Leni in ihrer Verzweiflung ein Gelübde und versprach der Heiligen Jungfrau Maria, zu ihr nach Lourdes zu pilgern, wenn Gott ihren Buben durch ihre Fürsprache wieder genesen ließ. Aber es sollte noch weitere neun Wochen dauern, bis Ludwigs entrückter Geist wieder in seinen Körper zurückfand.
Als er aus dem Koma erwachte, war ein anderer aus ihm geworden. Der lebhafte Junge von einst schien jetzt die Einsamkeit zu suchen. Oft verkroch er sich für Stunden auf dem Heuboden und rührte sich nicht, wenn man nach ihm rief. Er zog sich in eine Welt zurück, zu der andere keinen Zugang hatten. Manchmal sah man ihn völlig abwesend in der Wiese hinterm Haus sitzen und auf einen toten Käfer oder eine tote Maus in seiner Hand starren, so, als könne er sie durch höchste Konzentration wieder zum Leben erwecken. Dieses Verhalten hatte nichts mehr mit der natürlichen Selbstschutz-Apathie der pubertierenden Jugend zu tun; sein Rückzug in sich selbst ging tiefer – es war ein Sturz ins Bodenlose.
Wenn man ihn aus seinen Träumereien riss, sah er einen mit einer Mischung aus Hochmut und Verachtung an, als habe man nicht die geringste Befugnis, ihn in seinen Betrachtungen zu stören.
Eines Tages, als sie abends noch an seinem Bett saß und ihn fragte, warum er sich auf einmal so hartnäckig weigere, mit zur Sonntagsmesse zu gehen, erhielt sie eine Antwort, auf die sie nicht gefasst war. Er vertraute ihr an, dass er, bevor er im Krankenhaus erwacht war, im Himmel gewesen sei, und dass dort alles ganz anders sei, als die Leute immer erzählten. Mit wachsendem Unbehagen lauschte sie dem, was er über sein himmlisches Erlebnis zu berichten hatte. Es war ihr dabei, als griffe eine eiskalte Hand nach ihrem Herzen. Bis sie ihm schließlich den Mund verbot, sich bekreuzigte und beinahe fluchtartig seine Schlafkammer verließ.
Wie um alles in der Welt war ein 13-jähriger Junge plötzlich zu so gottloser Rede fähig? Er hatte die heiligen Sakramente der Taufe und Firmung erhalten. Er ging zur Beichte und zur heiligen Kommunion... und dann das! Wirres Gerede! Sicher war durch den Unfall in seinem kleinen Kopf etwas verschoben worden ... verrückt worden.
Lenis eigenes Bild vom Himmel, das bis zu diesem Tag wie ein prächtiges Barockgemälde in ihrem Herzen gehangen hatte, war nach dem Gespräch mit ihrem Sohn in Schieflage geraten. Ja, es hatte seinen goldenen Rahmen verloren – den Rahmen, der ihren Glauben zusammenhielt. Alles brauchte einen Rahmen. Ein Rahmen fasste zusammen, er begrenzte und schloss den Zweifel aus. Alles brauchte Grenzen, damit der Verstand nicht daran irreging.
Deshalb hielt sie an ihrem liebgewonnenen Bild auch weiterhin fest, so gut es ging. Mochte es auch beschädigt sein – sie hatte nichts anderes. Es war wie mit einem bequemen Gewand, das man lieber unzählige Male flickte, als es wegzuwerfen. Man trug es weiter auf, obwohl es immer unansehnlicher wurde, und trotzdem fühlte man sich darin wohler als in einem neuen.
***
„Ach Ludwig, Ludwig ...“, seufzte Leni wieder.
So schnell war die Zeit verronnen. Ihr Sohn war jetzt schon 43. Und was hatte er aus seinem Leben gemacht? Keine Frau! Keine Kinder! Und nichts als Grillen im Kopf!
Da waren diese seltsamen Leute, mit denen er sich umgab: lauter überdrehtes Volk! Überzüchtete Geister! Gescheiterte Existenzen! Schiffbrüchige des Lebens! Die meisten von ihnen kamen aus den großen Städten – dünnhäutig wie gegerbte Schweinsblasen und bis oben hin voll mit heißer Luft. „Seminare“ nannte er das gottlose Treiben, das er mit ihnen veranstaltete.
Erst gestern hatte er ihr wieder so ein „Pflänzchen“ vorgestellt. Ramona hieß sie. Schön war sie, jung war sie und gut gekleidet, aber ihre Augen konnten einen nicht betrügen: zwei ausgebrannte Sterne, aus denen Erfahrungen sprachen, für die andere Leute neun Leben brauchten.
„Mam“, hatte Ludwig gesagt, als sie ihn wieder mal auf seinen Umgang mit diesen Gestalten angesprochen hatte, „diese Leute suchen Hilfe!“
„Hilfe von dir? Hilfe von jemandem, der sich selbst nicht zu helfen weiß?“ Sie hatte es nicht so direkt sagen wollen, aber sie konnte nicht anders. Es war nun mal ihre Art, die Dinge beim Namen zu nennen. Wenn ihr was auf der Leber lag, spuckte sie es aus, ohne lange darauf herumzukauen.
Ludwig hatte sie mit seinen durchdringenden Augen lange angeschaut und dann gesagt: „Man kann nur echte Hilfe leisten, wenn man weiß, was Hilflosigkeit bedeutet, Mam.“ Der Bub sagte oft so verdrehtes Zeug, das jeden gesunden Menschenverstand quälte.
67 Jahre hatte Leni jetzt auf dieser Welt gerackert, und es war tatsächlich eine einzige Plackerei gewesen. In ihrer Empfindung verdichteten sich die Jahre immer mehr zu Tagen, Tage, die jetzt nur noch tropften wie auf heißen Stein. Puff, war schon wieder einer verdampft! Und sich an Einzelheiten zu erinnern, fiel ihr immer schwerer.
Alles wiederholte sich, und je öfter es sich wiederholte, desto schneller schien es sich zu wiederholen. Ihr Leben glich mehr und mehr einer Zeitrafferaufnahme von ziehenden Wolken, deren Formen sie bereits auswendig kannte.
Vielleicht war es ein Notprogramm ihres Gehirns, wenn es ihr vorgaukelte, dass die Zeit schneller verging als früher. Vielleicht versuchte es durch solche Tricks nur davon abzulenken, dass es ausgebrannt war, dass es nicht mehr in der Lage war, Ereignisse, gleich welcher Art, als neu zu empfinden ... also wahrhaftig zu erleben. Wenn dem so war, dann waren alle Schüsseln leergelöffelt. Dann war die Speise ihres Lebens aufgezehrt und jedes Weiterlöffeln nur noch ein stumpfes Abspulen andressierter Gewohnheiten.
Just in diesem Augenblick kam Leni sich vor wie ein Apfel – ein Apfel hoch am Baume, der faulte und nicht fallen konnte.
Erschrocken über ihre eigenen Gedanken bekreuzigte sie sich, fischte ihr Gebiss aus dem Wasserglas auf dem Nachttisch, schob es in den Mund und fixierte es mit einer routinierten Kaubewegung.
Bevor sie in ihre Filzpantoffel schlüpfte, die vor dem Bett auf dem schütter gewordenen Flickenteppich standen, betrachtete sie sie eine Weile.
Sie musste schmunzeln.
Ihr vertrauter Anblick machte ihr jeden Morgen warm ums Herz. „Guten Morgen, meine Lieben!“
Die Pantoffel sahen aus wie zwei graue Dampfnudeln, die sich verängstigt aneinander gekuschelt hatten, um die Dunkelheit der Nacht gemeinsam zu überstehen.
Es gab einige Dinge im Haus, von denen sie hätte schwören können, dass sie eine Seele besaßen. Vor allem die älteren, die schon immer da waren. Diese Dinge unterhielten sich mit ihr. Sie erzählten Geschichten, zu denen sie nur zu nicken brauchte, weil sie sie selbst erlebt hatte.
Doch ihre vertrauteste Mitbewohnerin war eine alte Kaffeetasse. (Die letzte Überlebende eines ganzen Services, das sie von ihren Eltern zur Hochzeit geschenkt bekommen hatte.) Diese war sehr gesprächig und meistens auch ihrer Meinung. Sie stand jetzt im Küchenschrank und wartete bestimmt schon ungeduldig auf ihr gemeinsames Morgenschwätzchen. Sie war mit zartblauen Vergissmeinnicht bemalt. Eigentlich waren es nur eingebrannte Abziehbilder, aber das war Leni egal. Wenn der heiße Kaffee aus dieser Tasse dampfte und sie ihre schrundigen Hände um sie legte wie um ein schutzbedürftiges Küken, dann durchströmte sie ein so unsägliches Gefühl von Wärme und Geborgenheit, wie sie es nur damals vor vielen Jahren empfunden hatte, wenn ihr die Mutter über Haar und Wangen streichelte.
Als Leni jetzt in den kalten Flur hinaustrat, blieb sie einen Moment stehen, schloss die Augen und lauschte. Ihre Nasenflügel zuckten. Sie witterte wie ein Tier.
Ohne noch aus dem Fenster gesehen zu haben, wusste sie, dass die Nacht den ersten Schnee gebracht hatte. Denn für Menschen, die lange Zeit in der Natur gelebt haben, ist dieser auch mit dem Gehör- und Geruchssinn wahrzunehmen. Nicht etwa, weil er selbst einen charakteristischen Duft besessen oder ein bestimmtes Geräusch verursacht hätte, sondern weil er alle Düfte und Geräusche an ihrer Entfaltung hinderte. Es war wie mit der rätselhaften Dunklen Materie, für deren Vorhandensein es nur den einen Beweis gab, dass sie auf ihre Umgebung wirkte.
Leni schlurfte ins Bad hinüber, wusch sich das Gesicht und begann, ihr dünn gewordenes graues Haar zu kämmen. Sie tat es mit einer Andacht, als handle es sich dabei um ein heiliges Ritual. Dann flocht sie es zu einem langen Zopf, den sie am Hinterkopf mit Nadeln zu einem Dutt zusammensteckte.
Was war nur aus ihrem kräftigen strohblonden Haar geworden?
Sie umschloss den Dutt mit einer Handfläche und dachte mit Wehmut daran, dass er früher dreimal so dick gewesen war. Jetzt lag er in ihrer Hand wie ein verdorrter Knödel.
Nachdem sie sich angekleidet hatte – lange Unterwäsche von ihrem verstorbenen Mann, wollene Kniestrümpfe, Leinenkleid, Strickjacke, Strickhaube, kurze Gummistiefel – ging sie in die Wohnküche, um Feuer im Herd zu machen. Seit sie den Trick anwendete, auf den Holzbrand des Vorabends noch ein Kohle-Brikett zu legen, bevor sie zu Bett ging, war morgens in der Regel noch genügend Glut vorhanden, um das Reisig, das sie zum Anfeuern benutzte, sofort aufprasseln zu lassen.
Heute nicht.
Die Glut war erloschen und jeder ihrer Versuche, ein Feuer zu entfachen, misslang.
Der Kamin zog nicht.
Unter der Decke des Raumes lungerten bereits erste Rauchschwaden herum.
Leni gab es auf. Sie öffnete Tür und Fenster, um den Rauch abziehen zu lassen.
Wahrscheinlich hatte sich eine Schneehaube auf dem Kamin gebildet.
Wie oft hatte sie Ludwig schon gebeten, ein Abdeckblech dort oben anzubringen! Doch Ludwig sah jeden Euro, den er in den Altbau investieren sollte, als Verschwendung an. „Du kannst ja umziehen!“, hieß es dann. „Das alte Graffel ist es nicht mehr wert!“
Sie wusste nicht, warum sie es jedes Mal persönlich nahm, wenn er so sprach.
Leni holte jetzt die alte Kaffeetasse aus dem Schrank und stellte sie vorsichtig auf den Tisch. Doch dann fiel ihr ein, dass sie ja gar kein Wasser auf den Herd stellen konnte. Das Wasser aus den beiden Boilern in Bad und Küche wurde nicht mehr heiß genug, um einen anständigen Kaffee damit aufbrühen zu können. Die Boiler waren wie sie selbst in die Jahre gekommen, und die Jahre hatten so manches Zipperlein mit sich gebracht.
Ach, das war zu ärgerlich!
Als sie jetzt ging, um Tür und Fenster wieder zu verschließen, bevor der Raum noch ganz auskühlte, überfiel sie wieder dieser Schwindel. Halt suchend griff sie nach der Tischkannte.
Das Tischtuch verrutschte.
Die Tasse mit den zartblauen Vergissmeinnicht fiel zu Boden.
Voller Entsetzen starrte sie auf das Häuflein Scherben zu ihren Füßen.
Ihr war, als sei plötzlich eine Saite in ihrem Herzen gerissen. Sie begann, am ganzen Körper zu zittern. Mit einer Klarheit, die ohne Zweifel war, erkannte sie, dass es an der Zeit war, umzuziehen.
2
Auszug aus dem Tagebuch der Magdalena Grünzinger vom 22. Juni 1974.
– Gestern haben der Sepp und ich geheirat.
Bin jetzt in der 17. Woch und hab noch keinen Bauch. Nur um die Hüften spannt es ein bisserl. Ein paar alte Weiber auf der Hochzeit haben vielleicht was gemerkt. Macht nix. Sollen sie sich das Maul ruhig zerreißen, ich hab jetzt jedenfalls einen Vater für mein Kind.
Hab dem Sepp gleich nach dem Fasching schöne Augen gemacht und mich nicht lang scheniert, wie er mir an die Wäsch hat wollen. 14 Tag drauf hab ich ihm gesagt, daß ich von ihm schwanger bin. Zuerst hat er geschaut wie der Ochs vorm Berg, dann aber hat es ihn gefreut ... und mich erst recht. Hat gemeint, daß bald geheirat werden muss … wegen der Leut! Ist ein kreuzbraves Mannsbild der Sepp! –
Ludwig Grünzinger war für die Leute der „Luk“, der „jung Sepp“ (nach dem Namen seines Vaters) oder der „Krückl“ (nach dem Hofnamen). „Herr Grünzinger“ nannte man ihn nur auf Ämtern, und wenn es anderweitig offiziell wurde.
Luk hatte seine Schullaufbahn am Freyunger Gymnasium ein Jahr vor dem Abitur wegen eines Vorfalles abgebrochen, der eine Welt in ihm hatte zusammenstürzen lassen. Seitdem war er noch schweigsamer geworden, als er schon gewesen war. Er hatte dann eine Lehre bei einem Tierpräparator begonnen. Seine Lehrer schüttelten seinerzeit nur verständnislos den Kopf. Seine Leistungen in allen Fächern waren gut bis ausgezeichnet. Wie konnte man nur so liederlich mit seiner Zukunft umgehen! Tierpräparator! Ein seltsamer Beruf! Ein Beruf für seltsame Menschen!
Nach der dreijährigen Ausbildung verschwand er und war dann neun Jahre lang verschollen. Niemand wusste, wo in Gottes weiter Welt er sich herumtrieb, und den meisten war es auch egal, ob der notorische Sonderling je wieder in seiner Heimat auftauchen würde. Nur seine Mutter erreichten in dieser Zeit ein paar wenige Briefe aus fernen Ländern Südamerikas, aus dem Kongo, aus Angola und aus Indonesien. Aus ihnen ging hervor, dass ihr Sohn bei verschiedenen Eingeborenenstämmen lebte, um deren Sitten und Gebräuche zu studieren. Sein spezielles Interesse galt den Medizinmännern und Schamanen dieser Naturvölker, die er als seine Lehrmeister ansah.
Seine Briefe, so sehr sie sich auch nach ihnen sehnte, hatten bei seiner Mutter nur Unbehagen hervorgerufen. Die Vorstellung, dass ihr einziger Sohn bei den Wilden lebte und deren heidnische Bräuche studierte, machte sie traurig.
Kurz vor seinem 30. Geburtstag war Luk nach Hause zurückgekehrt. Der Jüngling hatte sich zum Mann gemausert: braungebrannt, langhaarig, von asketischer Hagerkeit und mit tiefliegenden ausdrucksstarken Augen. Diese Augen durchdrangen sein Gegenüber wie Röntgenstrahlen und lieferten ihm ein detailgetreues Bild der Persönlichkeit. Luk war das eher unangenehm. Er empfand es wie Diebstahl, auf diesem Weg mehr über seine Mitmenschen zu erfahren, als sie freiwillig bereit gewesen wären, ihm anzuvertrauen. Die Gabe, durch ihre Masken hindurchzusehen und das Ausmaß ihres inneren Chaos zu erkennen, war für ihn Vorteil und Bürde zugleich. Die wahre Natur eines Menschen zu erkennen und dann mit seinem Verhalten konfrontiert zu werden, das diese Natur oft genug in Wort und Tat verleugnete, war eine bittere Erfahrung. Dann schlug er die Augen nieder und vermied den direkten Blickkontakt. Manche legten ihm das als Schwäche oder Schüchternheit aus. Doch es waren meist die, die sich hinter ihrer Maske allzu sicher wähnten und nicht ahnten, dass die Tür zu ihrer Seele für Luk sperrangelweit offenstand.
Sie konnten sich nicht vorstellen, dass es keinen schärferen Beobachter als den Schüchternen gab.
Schon im Dschungel von Borneo hatte Luk die Erfahrung gemacht, dass in extremen Situationen nur der Schüchterne überlebte, denn niemand erwog sein Handeln sorgfältiger als er.
Sein Körper war bedeckt von seltsamen Tätowierungen. Nicht vergleichbar mit den comichaften, größtenteils dilettantisch fabrizierten Motiven abendländischer Geschmacksrichtung. Nein, seine Tattoos waren anders. Rätselhafte Linien zogen sich über seinen Rücken, seine Brust, seine Beine und Arme. An manchen Stellen traten die Muster wie Narben und Noppen hervor und vermittelten den Eindruck einer Schatzkarte, die nur wenige Eingeweihte auf der Welt zu lesen verstanden.
Dann machte sich Luk als Tierpräparator selbständig, und es dauerte nicht lange, bis sich herumgesprochen hatte, dass er ein wahrer Künstler seines Fachs war. Aufträge kamen aus Nah und Fern. Museen, Schulen und wissenschaftliche Institute gehörten bald zu seiner zahlungskräftigen Kundschaft.
Die Seminare, die er veranstaltete, waren für ihn ein Ausgleich. Sie verschafften ihm Abstand zu seiner blutigen Arbeit mit Gedärmen, Knochen, Gefieder und Fellen. Aber sie waren noch etwas anderes: eine Mission, zu der er sich berufen fühlte, seit er als Zwölfjähriger das Paradies geschaut hatte – und er hatte es geschaut, dessen war er sich ganz sicher.
Auch wenn ihm mit den Jahren immer klarer wurde, dass mit Worten unmöglich auszudrücken war, was er während seiner Wiederbelebung am Unfallort oder im darauffolgenden Koma „erlebt“ hatte, so fühlte er sich doch verpflichtet, den Menschen auf irgendeine Weise die Angst vor dem Sterben zu nehmen. Denn das unbeschreibliche Glücksgefühl, das ihn noch heute durchströmte, wenn er an die grandiose Erfahrung zurückdachte, die er gemacht hatte, suchte ein Ventil. Glück wollte nun mal geteilt sein, um sich in seiner ganzen Kostbarkeit zu entfalten.
Es wäre nicht übertrieben gewesen, wenn er behauptet hätte, alles zum Thema „Nahtoderfahrung“ gelesen zu haben. Trotz unzähliger anekdotischer Berichte darüber, war dieses Phänomen bis heute nie wirklich systematisch untersucht worden. Es war, als sträube sich die seriöse Wissenschaft, ihren Heimvorteil aufzugeben und ihr angestammtes Spielfeld zu verlassen. Nichts widerstrebte ihr mehr, als in die Sphäre der Mystik einzudringen. Doch das musste sie, wenn sie Einblick in diese heikle Thematik gewinnen wollte.
Das Fazit seiner eigenen Recherchen war erhellend und frustrierend zugleich. Luk pflegte via Internet weltweiten Kontakt zu Menschen, die wie er eine Nahtoderfahrung gemacht hatten. In ihren Berichten tauchten immer wieder bestimmte Muster auf. Muster, die sich auf geheimnisvolle Weise selbst kopierten: Strahlendes Licht am Ende eines dunklen Tunnels – Empfindung der allumfassenden göttlichen Liebe – Treffen mit Verstorbenen – Ablauf von Erlebtem im Zeitraffertempo. Es war wie mit Ufo-Sichtungen. Bei einer Häufung setzte sich immer irgendwann ein bevorzugtes Modell durch – je flacher, desto glaubwürdiger.
Luk stand all diesen Berichten skeptisch gegenüber. Zu deutlich zeichneten sie ein Bild der soziologischen und religiösen Prägung der Betroffenen. Nichts davon war wirklich neu. Alles war mit dem banalen Sehnsuchtsballast des Diesseits behaftet. Alles entlarvte sich bei genauerem Hinsehen als Projektion einer naiven Erwartungshaltung. Keiner dieser Berichte transportierte etwas von der köstlichen Fremdartigkeit, die er selbst erfahren hatte.
Bis zum Zeitpunkt seiner eigenen Nahtoderfahrung mit zwölf Jahren war er definitiv nicht mit dieser Thematik konfrontiert gewesen. Insofern war es ihm auch nicht möglich gewesen, aufgeschnappte Berichte anderer unbewusst zum Katalysator für seine eigene Geschichte zu machen. Zwar war auch er von der katholischen Religionslehre geprägt worden, die die Auferstehung predigte, doch war dieser Begriff damals für ihn noch ein ungeklärtes Rätsel gewesen. Das einzige, was es in seiner kindlichen Vorstellung hervorgerufen hatte, war immer ein und dieselbe Vision gewesen: Die mit duftenden Köstlichkeiten vollgepackte Fleisch- und Wurstwarentheke der Metzgerei Brodinger – Auferstehung im Fleische!
Was eine Wursttheke mit dem Paradies zu tun hatte, hinterfragte er damals noch nicht. Was immer für die Gemeinschaft der Gläubigen, in deren schützenden Kokon man ihn so fürsorglich eingesponnen hatte, Fakt war, wurde von ihm als Fakt akzeptiert. Da gab es kein Wenn und kein Aber. Egal welche Bilder die noch bescheidene Anzahl von Synapsen seines kindlichen Gehirns ihm dazu lieferte, er akzeptierte sie fraglos.