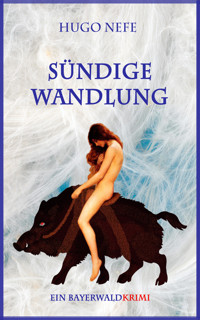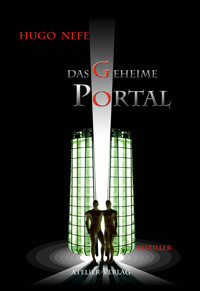
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Zwei Millionen Jahre vor unserer Zeitrechnung wird die Erde von einer hoch intelligenten außerirdischen Spezies entdeckt. Schon bald hat sich der Blaue Planet für diese nichtstofflichen Geistwesen zu einer Wellness-Oase in den endlosen Weiten des Alls entwickelt. Um jedoch Erfahrungen in der materiellen Welt machen zu können, benötigen sie ein geeignetes Wirtstier. Ihre Wahl fiel auf den Menschen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Hugo Nefe
Das geheime Portal
1. Auflage 2012
© Atelier-Verlag / Hugo Nefe
D-94363 Oberschneiding, Hauptstr. 42
https://www.nefe.de
„Ich habe nicht die Hälfte von dem erzählt,
was ich gesehen habe,
weil mir keiner geglaubt hätte…“
Marco Polo
Prolog
Im Frühjahr des Jahres 1974 stießen die Bauern eines chinesischen Dorfes im Kreis Lintong, bei den Bohrungen für einen Bewässerungsbrunnen, auf seltsam geformte Tonscherben.
Die Terrakottaarmee, das gewaltige Jenseitsheer des 1. Kaisers von China war entdeckt.
Doch die Ausgrabungsarbeiten beförderten neben unschätzbaren Artefakten noch etwas anderes ans Licht des Tages – etwas, das für diese Welt nicht geschaffen war…
Im Jahr 210 v. Chr. bricht Qin Shihuang, der erste Kaiser von China, im Alter von 50 Jahren, zu einer seiner zahlreichen Inspektionsreisen durch das gewaltige Qin-Reich auf – eine Reise, von der er nicht lebend in seine Hauptstadt Chang-an zurückkehren wird.
Sein Weg führt ihn diesmal bis an das große Ostmeer. Von dort zieht der lärmende Tross der 60.000 Soldaten, die sein Leben schützen sollen, weiter nach Norden.
Keiner seiner gewöhnlichen Untertanen bekommt ihn zu Gesicht. Er verbirgt sich in einem geschlossenen Reisewagen, von denen gleich mehrere auf unterschiedlichen Wegen mitgeführt werden. Bis auf wenige handverlesene Vertraute weiß niemand, in welchem sich der Herrscher gerade befindet.
Es ist Sommer. Eine gnadenlos herabbrennende Sonne hat den Boden der Landstraßen ausgetrocknet und zerklüftet. Die Fortbewegung ist zu einer Plage für Mensch und Tier geworden. Nur in den sumpfigen Niederungen, durch die sich die Riesenschlange gepanzerter Leiber schlängelt, gibt es jetzt noch genügend Wasser, um die Trinkschläuche aufzufüllen. Es schmeckt brackig, und viele Soldaten werden von Durchfall und Fieber dahingerafft. Wer vom Pferd fällt oder in der sengenden Hitze nicht mehr weitermarschieren kann, wird am Wegrand mit einem letzten „Es lebe der Kaiser!“ zurückgelassen.
An einem von den ortskundigen Führern „Sandhügel-Terrasse“ genannten Ort ziehen sich die endlosen Kolonnen der Reiterei und des Fußvolkes wie durch Geisterhand zusammen und beginnen ein Lager aufzuschlagen.
Erst allmählich legt sich die gewaltige Wolke aus orangefarbenem Staub, die von der geschäftigen Truppe aufgewirbelt worden ist. Die Sonne hat sich dahinter zu einem blutroten Glutball aufgeblasen, der sich nun träge anschickt, hinter den westlichen Horizont zu gleiten.
Die kaiserliche Karosse aus Bronze und Gold steht in der Mitte eines dreifachen Ringes von schwerbewaffneten Mannschaften einer treu ergebenen Leibgarde. Der Wagen kann von außen nicht geöffnet werden, nur durch ein winziges Fenster dringt Frischluft hinein.
Einsam sitzt der Gottgleiche, im verstaubten Prunk seiner engen Reisebehausung und starrt aus der kleinen Luke auf das verlöschende Himmelsgestirn. Kalter Schweiß dringt aus den Poren seines wächsernen Gesichts, rinnt in Strömen wie von flüssigem Kupfer hinab und netzt den Kragen seines kostbar bestickten Seidengewandes. In den tiefliegenden Augen des Herrschers spiegelt sich die ganze Schwermut eines Lebens ohne wahre Liebe wider, und manchmal flackert ganz unverhohlen die Angst in ihnen auf.
Seit Tagen schon plagt auch ihn ein heftiges Fieber. Sein Atem riecht faul und aus seinen Ohren rinnt ein stinkendes Sekret. Nachts fließt ein unkontrollierter Speichelstrom aus seinem Mund und durchnässt seine Kissen. In seinem Kopf murmeln wirre Stimmen durcheinander, und oft ist ihm, als höre er das Angriffssignal feindlicher Hörner.
Alle Heilkunst seiner geschwätzigen und gegeneinander intrigierenden Leibärzte hat bisher keine Linderung gebracht. Zudem scheint es ihm ein schlechtes Omen, dass all sein Denken in letzter Zeit nur noch um die Vergangenheit kreist. Mit unerbittlicher Klarheit tauchen plötzlich längst vergessen geglaubte Ereignisse wieder in seiner Erinnerung auf und rauben ihm den Frieden und den Schlaf.
Auch in diesem Augenblick baut sich die Vergangenheit wie eine drohende Gewitterwand vor seinem geistigen Auge auf.
259 v. Chr. war er unter dem Namen Ying Zheng geboren worden. Nach dem Tod seines Vaters Zhuangxiang, des Königs des Qin Staates, trat er mit 13 Jahren dessen Nachfolge an. Seine offizielle Krönung erfolgte jedoch erst neun Jahre später.
Mit dem unfehlbaren Instinkt und der eiskalten Berechnung des geborenen Machtmenschen hatte er bald alle Hindernisse auf dem Weg zur absoluten Alleinherrschaft beseitigt, darunter seine eigene Mutter, hohe Politiker und Generäle. In einer zehnjährigen Folge von blutigen Feldzügen unterwarf er sich die Nachbarstaaten Han, Zhao, Wei, Chu, Yan und Qi und beendete dadurch die Ära der Sieben Streitenden Reiche.
Mit 38 Jahren ließ er sich zum Kaiser ausrufen und nannte sich fortan Qin Shihuang.
Er hatte seinen General Meng Tian damit beauftragt, zum Schutz gegen die einfallenden Horden der wilden Nordvölker eine riesige Mauer zu bauen, welche die alte Mauer aus dem Reiche Zhao strategisch integrierte. Er ließ Meng Tian Berge abtragen und Täler auffüllen, um durch das ganze Land Straßen zu bauen, über die seine Hauptstadt aus allen Himmelsrichtungen bequem zu erreichen war. Die von ihm angeordneten Volkszählungen hatten ergeben, dass er über 20 Millionen Untertanen herrschte. Etwa 500.000 Soldaten, Sträflinge und Gepresste waren ständig mit dem Mauerbau beschäftigt. Weitere 700.000 bauten traditionell schon seit seiner Jugendzeit an seinem Mausoleum, das mit seiner Größe und Pracht alles in den Schatten stellen sollte, was menschlicher Totenkult bisher geleistet hatte.
Nach den traditionellen kosmischen Regeln angelegt, entstand eine gigantische Totenstadt für ihn, die von einer gewaltigen Mauer umgeben war. Südlich des Zentrums erhob sich der eigentliche Grabhügel, in dessen Innerem der „Tian Xia“, das ganze zivilisierte Universum, en miniature wiedergegeben war. An der Decke der Gruft wölbte sich ein bronzener Himmel, dessen Sternbilder von unzähligen Edelsteinen wiedergegeben wurden. Am Boden war die Landschaft mit den hundert Flüssen des Reiches nachgebildet. Flüsse und Ozeane waren in reinem Quecksilber dargestellt, das sich, mechanisch beeinflusst, in ständiger Bewegung befand. Ungeheure Schätze sollten ihm dereinst in dieses Grab folgen; ebenso seine kinderlos gebliebenen Konkubinen, die der Baupläne kundigen Architekten und die Handwerker, die die Fallen und Selbstschussanlagen in der Grabanlage installiert hatten.
Auch seine so erfolgreiche Armee wollte er im Schattenreich um sich versammelt wissen. Tausende von Kriegern aus allen Waffengattungen sollten als überlebensgroße Tonfiguren seine Totenstadt bewachen. In erprobter Schlachtordnung aufgestellt, bildeten sie einen Schutzschild gegen die östlich gelegenen, gefährdeten Pässe, die zur Großen Zentralebene führten.
Was in seinem Namen geschaffen wurde, war großartig. Er hatte alles erreicht, was man sich vorstellen konnte. Nur eines nicht: Die Liebe seines Volkes. Ganz im Gegenteil waren bereits mehrere Attentate auf ihn verübt worden. Der letzte Attentäter hatte es sogar geschafft, bei einer Audienz mit einem in einer Landkarte verborgenen Dolch in seine unmittelbare Nähe zu gelangen. Beinahe wäre der Anschlag damals auch geglückt, denn ihm war es nicht gelungen, sein überlanges Prunkschwert rechtzeitig aus der Scheide zu ziehen. Nur der Geistesgegenwart eines Lakaien, der dem angreifenden Attentäter ein Bein stellte, war es zu verdanken, dass er noch am Leben war.
Die ständig nagende Sorge um das eigene Leben, die ihn seit frühester Jugend zermürbte, hatte bei ihm nach diesem Ereignis paranoide Züge angenommen. Nach einem nur ihm selbst und engsten Vertrauten bekannten Zeitschema wechselte er auch im heimischen Palast beständig seinen Aufenthaltsort. Außer seinen Magiern, seinem Kanzler Li Si und dem Obereunuchen Zhao Gao, ließ er keinen mehr in seine Nähe.
In die Kunst seiner Magier setzte er die allergrößte Hoffnung, aber sein unerschütterlicher Glaube, dass es Mittel und Wege geben müsse, die das Leben verlängerten, wenn nicht gar totale Unsterblichkeit gewährten, machte ihn zu Wachs in ihren Händen.
Er hatte Unsummen für fragwürdige Tinkturen, geheimnisvoll riechende Pülverchen und wunderlich schäumende Tränke ausgegeben. Er hatte Quecksilberpräparate und Schwefelpillen geschluckt, er hatte Carbamid-Kristalle und Zinnober eingenommen; die Gewissheit aber, ob all diese Drogen auch in der Lage waren, sein Leben zu verlängern, konnte ihm niemand geben. Er konnte es nur hoffen.
Doch sein Zweifel war seiner Hoffnung ebenbürtig, und so ließ er rastlos nach immer neuen Mitteln gegen das Altern und den Tod forschen.
Schon vor Jahren hatte ein Gerücht seiner Hoffnung neuen Auftrieb verliehen. Es besagte, dass auf Penglai, einer geheimnisumwobenen Insel, die irgendwo frei im großen Ostmeer umhertreibe, das sagenhafte Kraut der Unsterblichkeit wachse.
Bereits dreimal hatte er seinem Chefmagier Hsu Fu von Qi eine Expedition ausgerüstet, die diese Insel zum Ziel hatte. Zwei davon waren erfolglos abgebrochen worden, weil schwere Seestürme und Ansammlungen von riesigen Fischen jede Weiterfahrt unmöglich gemacht hatten oder die Insel bei der Annäherung der Schiffe plötzlich in einem seltsamen Nebel verschwunden war.
Vor sieben Jahren nun schon war Hsu Fu zu seiner dritten Reise nach Osten aufgebrochen und galt seitdem als verschollen. Mit ihm, mehrere Tausend geweihte Knaben und Jungfrauen, die er sich als Begleitung auserbeten hatte, um, wie er sagte, die Unsterblichen durch deren kindlich reinen Geist wohlgesonnen zu stimmen.
Die Bedenken seines Kanzlers Li Si, dass sich der schlaue Hsu Fu nur absetzen und mittels des menschlichen Materials irgendwo sein eigenes Königreich etablieren wolle, hatte er damals nicht geteilt. Mit jedem Jahr aber, das ohne Kunde von Hsu Fu verstrichen war, hatte ihn das in ihn gesetzte Vertrauen mehr gereut.
Nach Jahren des Wartens musste er sich schließlich eingestehen, dass sein Kanzler wohl Recht mit seiner Einschätzung über die wahren Absichten des Magiers gehabt hatte. Verbittert und zornig hatte er deshalb erst unlängst im ganzen Reich verlauten lassen, dass jeder, der den Namen Hsu Fus auch nur ausspreche, sein Gedankengut und seine Schriften verbreite oder in deren Besitz angetroffen werde, die Todesstrafe zu gewärtigen hätte.
Doch dann geschah etwas, das ihm zeigte, dass sein Vertrauen in Hsu Fu vom Schicksal nur auf eine harte Probe gestellt worden war, eine Probe, die er nicht bestanden hatte.
Es war jetzt etwa zwei Wochen her, da hatten die Späher seiner Vorhut an den Gestaden des Ostmeeres einen jungen Mann aufgegriffen, der Schiffbruch erlitten hatte und sich in einem jämmerlichen Zustand befand. Seine Kleidung hing ihm in Fetzen vom Leib und sein Geist schien durch die ausgestandenen Schrecken auf See verwirrt. Seine Reden beim Verhör durch einen Offizier der Vorhut ergaben wenig Sinn. Die Erwähnung Hsu Fus jedoch, dessen Namen er fortwährend beschwörend und wild gestikulierend ausrief, besiegelte sein Schicksal. Außerdem fand man einen ledernen Beutel um seinen Hals geschlungen, dessen Inhalt mit dem Siegel des ehemaligen Hofmagiers versehen war, das im ganzen Reich mit dem kaiserlichen Bannspruch belegt war. Dieser Umstand kostete den Unglücklichen seinen Kopf, noch ehe die Kunde des Geschehens die Haupttruppe und das Ohr des Herrschers erreicht hatte.
Die Sonne ist seit geraumer Zeit schon untergegangen. Nur noch die Ahnung eines rötlichen Streifens spannt sich dort am westlichen Horizont, während die Nacht in würdevoller Majestät von Osten her ihre dunklen Schleier über das Firmament schleppt.
Qin Shihuang fröstelt. Mit einer matten Handbewegung greift er nach einem seidenen Tüchlein, das in einem seiner weiten Ärmel steckt und tupft sich den Schweiß von der heißen Stirn. Dann schließt er die Luke seiner Karosse und starrt auf den „Ding“, der neben ihm auf einem kunstvoll bemalten Lacktischchen steht. Das dreibeinige Kultgefäß aus Bronze, das aus dem Beutegut eines seiner früheren Feldzüge gegen Wei stammt, ist für ihn seit Tagen zum heiligen Tabernakel all seiner Hoffnung geworden. In ihm liegt der lederne Beutel, den der exekutierte Schiffbrüchige um den Hals getragen hat.
Hat Hsu Fu es nun endlich doch noch entdeckt, das Mittel für die Unsterblichkeit?
Seit man ihm den Beutel überbracht hat, plagt ihn diese Frage. Doch erst heute fühlt er sich kräftig genug, die Antwort darauf zu erfahren.
Magisch von seinem Inhalt angezogen, bewegt sich seine Hand jetzt auf den Deckel des schweren Gefäßes zu, packt ihn und setzt ihn mit einem dumpfen metallischen Klang auf dem Lacktischchen ab. Dann greift er entschlossen in die runde Öffnung. Heute muss es sein! Heute wird er das Siegel Hsu Fus erbrechen. Genug des Zögerns und der leidigen Unentschlossenheit... er will endlich Gewissheit haben!
Langsam zieht er den ledernen Beutel hervor und drückt ihn mit einer raschen Bewegung an sein pochendes Herz.
Sein Atem geht schwer. Nach einem Moment der inneren Sammlung, beginnt er mit unsicheren Fingern an dem Riemen zu nesteln, der den Beutel verschlossen hält.
Etwas gleitet in seinen Schoß.
Die von der Decke baumelnde Tranampel des Reisewagens wirft ein gespenstisches Licht auf ihn und lässt den Schatten seiner Gestalt wie einen bewegten Scherenschnitt über die mit Seide bespannten Wände huschen. Qin Shihuang starrt auf ein längliches, in Leder eingenähtes Päckchen, das mit einem einfachen Siegel aus gebranntem Ton versehen ist – dem Siegel Hsu Fus.
Mit einer entschlossenen Bewegung zieht er seinen kostbaren Prunkdolch aus der Scheide und beginnt die Nähte des Päckchens vorsichtig aufzutrennen; schon wenig später gibt die in Öl getränkte geschmeidige Tierhaut ihren Inhalt preis.
Andächtig schweift sein Blick über ein zusammengerolltes Bündel von Bambusstäben, auf denen sich zahlreiche Kolonnen filigran gravierter Zeichen drängen.
„Ohne Zweifel“, flüstert er erregt, „die Handschrift Hsu Fus!“
Als er das Bündel jetzt entrollt, entdeckt er darin einen weiteren, sehr viel kleineren und ebenfalls in Leder eingenähten Gegenstand. Im Verhältnis zu seiner geringen Größe besitzt dieser jedoch ein ungewöhnlich hohes Gewicht. Versonnen wägt er das kleine Etwas in seiner vom Fieberschweiß feuchten Hand. Dann breitet er mit zittrigen Fingern die mit einem dünnen Faden verbundenen Stäbe auf seinen Schoß und fängt zu lesen an.
Vor seinem Geist taucht dabei die hagere Gestalt seines Magiers auf, sein von schlohweißem Haar umrahmtes Haupt und sein vom Alter verwittertes Gesicht mit dem langen schütteren Kinnbart...
Dem Kaiser ist jetzt, als beginne die altbekannte Stimme Hsu Fus zu ihm zu sprechen:
„Erhabener! Strahlende Sonne von Qin!
Dies ist nun bereits der siebente Reisebericht, den ich an Euch verfasse, ohne zu wissen, ob Ihr die vorangegangenen erhalten habt. Denn wisset: Das große Meer, das uns von unserer geliebten Heimat Qin trennt, ist von einer mörderischen Heimtücke, der nur die eines betrogenen Eheweibes gleichkommt.
Durch gewaltige Stürme, die beinahe aus heiterem Himmel über unsere Flotte hereingebrochen sind, habe ich einen Großteil der mir anvertrauten Leute verloren. Weitere Verluste erlitten wir bei blutigen Scharmützeln mit den wilden Bewohnern von Inseln, die wir angelaufen hatten, um unsere Vorräte aufzustocken.
Nach unsäglichen Mühen sind wir nun stark dezimiert an einem Ort gelandet, dessen Einwohner uns freundlich gesonnen sind. Viele von ihnen, wenn man ihnen Glauben schenken darf, sind weit über hundert Sommer alt. Sie ernähren sich mitunter von bitteren Gurken, deren Schale von unförmigen Warzen bedeckt ist. Aber auch diese Menschen sterben. Die Insel der Unsterblichen scheint es also auch diesmal nicht zu sein, an deren Gestade uns das Schicksal gespült hat.
Allerdings, waren einige meiner Leute unlängst Zeugen einer seltsamen Erscheinung, von der ich Euch heute berichten will. Das Ereignis rief sowohl bei uns als auch bei den Eingeborenen großen Schrecken hervor, und die Bestürzung darüber hält bis zum heutigen Tage an.
Eines Nachts wurde ich von einem ohrenbetäubenden Geräusch aus dem Schlaf gerissen, und alsbald kamen die Wachen in meine Hütte gestürzt. Alle schrien durcheinander und schilderten mir in größter Erregung, dass soeben eine Horde feuriger Drachen über den nächtlichen Himmel gezogen sei, von denen sich einer mit loderndem Schweif in unmittelbarer Nähe unseres Lagers in der Erde verkrochen habe.
Wenig später zeigten sie mir aus sicherer Entfernung die Stelle, an der sich dies zugetragen hatte.
Nun, ich habe solcherlei Ehrfurcht heischende Erscheinungen auch schon des Öfteren am Himmel über Qin beobachten können, aber noch nie habe ich dabei ein Geräusch vernommen, und niemals noch ist mir zu Ohren gekommen, dass sich eines dieser feurigen Wesen je auf die Erde gestürzt hätte. Bei meinen Beobachtungen waren sie jedes Mal ebenso schnell wieder am Himmel verschwunden wie sie sich dort entzündet hatten.
Am darauffolgenden Tag fand sich unter den tapfersten meiner Leute auch nicht einer, der mich zu der Stelle begleitet hätte, wo das Ding, das sie als Drachen bezeichneten, in den Boden gefahren war. Vorsichtig machte ich mich daher ganz allein auf den Weg und näherte mich einem frisch aufgeworfenen Krater, dessen Durchmesser etwa eineinhalb Schritte betrug.
Nach einer Weile ermannte ich mich, die ungefähr zwei Fuß tiefe Mulde näher in Augenschein zu nehmen. Mit größtem Bedacht begann ich mit meinem Dolch darin herumzustochern und legte so schließlich einen seltsamen Gegenstand frei. Ich berührte ihn zunächst nur mit der Spitze meines Dolches, als aber nichts weiter geschah, überwand ich mich, nahm ihn behutsam zwischen zwei Finger und hielt ihn gegen das Licht der Sonne. Er war für seine geringe Größe sonderbar schwer, leicht durchscheinend und von grünlicher Farbe. Nach sorgfältiger Erwägung nahm ich ihn mit in meine Hütte und meditierte drei Tage und drei Nächte über ihm, ohne Nahrung zu mir zu nehmen. In dieser Zeit rief ich alle guten Geister an, damit sie mich erleuchten und mir das Geheimnis dieses rätselhaften Gegenstandes verraten mögen.
Erhabener!
Ich wurde von den Geistern erhört!
Sie gaben mir unmissverständlich zu verstehen, dass es sich bei diesem Fundstück um eine äußerst kostbare Rarität handle – den Samen eines männlichen Drachen!
Gottgleicher!
Ich werde dieses einzigartige Kleinod dem Vertrauenswürdigsten meiner Leute übergeben und ihn mit den erfahrensten Seeleuten auf die Reise zu Euch schicken. Allerdings sehe ich mich bei all meiner Weisheit und all meinem Wissen nicht in der Lage, Euch eine Empfehlung für den Gebrauch dieses Objekts auszusprechen. Doch eins ist meine unerschütterliche Überzeugung: Der Same birgt die Kraft der Unsterblichen in sich, die ihre ewigen Bahnen am nächtlichen Himmel ziehen. Ich konnte es mit all meinen Sinnen spüren, dass dieses kleine Ding ein Geheimnis aus grauer Vorzeit in sich birgt!
Möge Euch nun, Strahlende Sonne von Qin, tausendjähriges Leben beschieden sein!
Zu ewigem Dank verpflichtet,
Euer ergebener Hsu Fu.“
Qin Shihuang erwacht wie aus einem tiefen Traum.
Abermals tupft er sich den Fieberschweiß von der glühend heißen Stirn, dann schneidet er das geheimnisvolle kleine Objekt aus seiner ledernen Hülle.
Mit spitzen Fingern hält er schließlich etwas gegen das Licht der flackernden Ampel, das in Form und Größe einer unregelmäßig gewachsenen Erbse entspricht. Sein Gewicht vermittelt ihm jedoch das Gefühl, einen faustgroßen Stein in der Hand zu halten. Die irisierende Oberfläche ist glatt und kalt, die Farbe changiert von tiefdunklem bis hin zu leuchtend hellem Grün.
Entzücken und Furcht zugleich spiegeln sich in den Zügen des Kaisers wider.
Lässt sich die sagenhafte Kraft der göttlichen Drachen etwa auf einen Menschen übertragen? Ist dies vielleicht der geheimnisvolle Stoff, nach dem er sein ganzes Leben suchen und forschen hat lassen? Das Tor zum ewigen Leben? Trägt dieses so ungewohnt schwere Stückchen himmlischer Materie tatsächlich den Samen der Unsterblichkeit in sich?
Sein von jahrzehntelanger vergeblicher Suche zermürbter Geist ist nur allzu bereit dies zu glauben und sein vom Fieber gezeichneter Körper aufs Höchste empfänglich für das langersehnte Wunder.
Jede Faser seines Leibes beginnt ihm zuzuflüstern, dass seine Suche mit dem heutigen Tag ein Ende gefunden hat.
Langsam öffnet er den Mund und legt das zierliche Gebilde auf seine beschlagene Zunge. Er wartet, bis sich genügend Speichel gesammelt hat, dann wirft er seinen Kopf in den Nacken und schluckt...
Der Same des Drachen fällt wie ein Stück Blei in seinen Schlund. Ist es nur Einbildung oder macht sich da tatsächlich eine wohlige Wärme in seinen Eingeweiden breit? Auch sein fieberheißer Kopf wird ihm mit einem Mal leicht und prickelnde Euphorie bemächtigt sich seiner.
Plötzlich kommt ihm ein Lied wieder in den Sinn, das er in den seltenen ungezwungenen Momenten seiner Kindheit geträllert hat. Verzückt beginnt er es mit brüchiger Stimme zu intonieren:
„Jiao Jiao Huang Niao…
...die gelben Vögel kommen und gehen,
sie sitzen auf dem Jujubebaum.
Wer folgt ins Grab dem Herzog Mu?
Yanshi von den Ziju...“
Wenig später nähern sich der Obereunuch Zhao Gao und der Kanzler Li Si der Karosse, um dem Kaiser mitzuteilen, dass sein Zelt aufgebaut und alles für die abendliche Konferenz vorbereitet sei.
Zhao Gao trägt einen schweren, bauchigen „Hu“, einen bronzenen Krug, der mit kühlem Wein gefüllt ist. Er weiß, dass sich der Kaiser mit einigen wohlgefüllten Bechern auf dieses ihm öde gewordene Zeremoniell einzustimmen pflegt.
Nach strengem Protokoll klopft der Kanzler zuerst an die Tür der Reisekarosse. Dann erhebt er seine schrill winselnde Stimme und meldet: „Euer Majestät oberste Beamte bitten um Gehör!“
In der Karosse bleibt es ruhig.
Nach einer Weile klopft Li Si erneut und wiederholt seinen protokollarischen Bittgesang.
Nichts rührt sich.
Der Kanzler runzelt die Stirn und wirft dem Obereunuchen einen fragenden Blick zu. Noch einmal klopfen sie und lassen den formellen Spruch verlauten, wiederum ohne die geringste Reaktion aus dem Wageninneren.
Von einem plötzlichen Unbehagen befallen, stellt Zhao Gao seinen Krug ab und geht um das Gefährt herum, um an die über dem großen Speichenrad angebrachte Luke zu gelangen. Li Si folgt ihm zögerlich. Er ist bemüht, die auch in ihm aufkeimende Unruhe vor den unweit patrouillierenden Wachposten zu verbergen.
Zhao Gao versucht jetzt vorsichtig die Luke zu öffnen. Tatsächlich gelingt es ihm, denn der Kaiser hat sie nur zugeschoben, ohne sie zu verriegeln.
Was sie im Dämmerlicht des Wagens erblicken, erfüllt beide zunächst nur mit ungläubigem Staunen, aber schon nach wenigen Augenblicken dringt das volle Ausmaß der vorgefundenen Situation und ihre immense Tragweite für den ganzen Staat mit Eiseskälte in ihr Bewusstsein.
„Eure Majestät!“, stammelt Li Si mit vor Grauen bebender Stimme.
„Göttlicher!“, entfährt es kaum hörbar den zitternden Lippen des Obereunuchen.
Der erhabene Gottkaiser des mächtigen Qin-Reiches antwortet nicht mehr...
Mit herabhängenden Armen und in den Nacken gefallenem Kopf sitzt er in seiner Reisekarosse und starrt mit glasigen Augen in das flackernde Licht der Tranampel. Auf seinem Antlitz aber liegt der verklärte Ausdruck höchster Glückseligkeit.
Um seinen Tod zu verschleiern und den Geruch seines Leichnams zu überdecken, lassen der Kanzler und der Obereunuch eine Karre voll verdorbenem Fisch hinter der kaiserlichen Karosse herfahren. Erst als sie in die Hauptstadt Chang-an zurückgekehrt sind und die Thronfolge in ihrem eigenen Sinne geregelt haben, verkünden sie den Tod des Herrschers und lassen seine sterblichen Überreste im kaiserlichen Mausoleum beisetzen.
Nur 15 Jahre hat das Haus der Qin, das sich im Namen seines ersten Herrschers Qin Shihuang eine ewige Dauer vorgesetzt hatte, das Reich innegehabt. Dann verschwindet es im Dunkel der Geschichte
1
Wie eine Fata Morgana ragte in majestätischer Erhabenheit Schloss Neuschwanstein aus den weiß wabernden Frühnebeln empor, die sich träge durch die Täler der nördlichen Voralpen schoben.
Erster Schnee war gefallen und hatte die Gipfel der Berge, die im Glanz der aufgehenden Sonne schwerelos auf den dichten Dunstschwaden dahinzudriften schienen, mit seiner glitzernden Pracht überzogen.
König Ludwig II. von Bayern stand bewegungslos am Fenster eines Balkonerkers und blickte versonnen über das wallende Wolkenmeer zu seinen Füßen. Er war zufrieden mit den Baumeistern, denn auch das virtuelle Panorama war ihnen bis an den fernen Horizont hin gelungen.
Zuerst hatte er überlegt, ob er in seiner ordengeschmückten Generalsuniform zu der von ihm einberufenen Ratsversammlung erscheinen sollte, hatte sich dann aber doch für ein bescheidenes graues Beinkleid mit schwarzem Gehrock, weißem Stehkragenhemd und Fliege entschieden.
Der Grund dieser Zusammenkunft des Hohen Rates waren Ereignisse auf der Erde, genauer gesagt in China, die zu größter Sorge Anlass gaben.
Auf seinem ebenmäßigen Gesicht lag ein verträumter Ernst, als er sich jetzt umwandte und in den Thronsaal zurückkehrte, wo sich bereits zahlreiche Ratsmitglieder eingefunden hatten.
Seine jugendliche Gestalt von etwa 23 Jahren hätte jedem Kenner seiner Biografie sofort verraten, dass sie historisch gesehen nicht in Einklang zu bringen war mit dem baulichen Zustand des Schlosses. Aber was war schon Historie in diesen Gefilden...
Mit freundlichem Nicken nach allen Seiten schritt er über das prunkvolle Mosaik des Bodens, das aus Ornamenten, Pflanzen- und Tiermotiven bestand. Dann stieg er gemessenen Schrittes die neun marmornen Stufen zur gegenüberliegenden Apsis empor.
Nachdem er die Scharen der Anwesenden eine Weile aufmerksam gemustert hatte, hob er in einer symbolischen Umarmungsgeste beide Hände.
Das Gemurmel der vielen Stimmen erstarb, und auch die auf den oberen Wandelgängen des zweigeschossigen Saales Versammelten traten nun an die vergoldete Brüstung mit ihren lapislazuliblauen Säulen und blickten erwartungsvoll zu ihm hinab.
„Seid mir gegrüßt, ehrwürdige Räte, liebwerte Legna-Brüder! Das Wetter ist schön, der Anlass unserer Zusammenkunft leider weniger!“
Ludwig II. legte eine zwei Atemzüge währende Pause ein, dann fuhr er fort: „Ich bin überzeugt, keinem von euch ist das Phänomen entgangen, das wir zur Zeit in der östlichen Hemisphäre des Planeten Erde beobachten können: Immer mehr unserer Leute, die von dort aus ihren materiellen Wirtskörpern, den Menschen, zurückkehren, haben jegliche Erinnerung an ihr zuletzt gelebtes Leben verloren. Das kann nur eines bedeuten: Sie, die Reficul, unsere abtrünnigen Brüder, haben sich zurückgemeldet!“
Es war vor undenklichen Zeiten, als die ewigen nichtstofflichen Energiewesen der Legna noch eine einzige große Gemeinschaft in den unendlichen Weiten des Alls bildeten. Irgendwann jedoch spalteten sich große Teile von ihr ab, um wieder ihrer eigenen Wege zu gehen.
Der Legna an sich war in all seinen Wesenszügen ein selbstbestimmter Einzelgänger. Zwar war er durchaus bereit, sich einer gewissen allgemeinen Ordnung zu unterwerfen, aber nur so lange, als diese für ihn auch Vorteile bot.
Doch je unübersichtlicher die Organisation ihrer mächtigen Gemeinschaft geworden war, desto deutlicher hatte sich auch ihr korruptes Zwei-Klassen-System offenbart: Wer nicht selbst zu den Organisatoren gehörte, weil es ihm an Talent oder Lust gebrach, nach oben zu buckeln und nach unten zu treten, für den wurde die Luft in ihrer Gemeinschaft allmählich dünn.
Irgendwann hatte die Regulierungswut der Organisatoren ein Ausmaß erreicht, das für viele nicht mehr länger tragbar gewesen war. Das ursprünglich nur zehn klare Punkte umfassende gesellschaftliche Regelwerk der Legna-Gemeinschaft war von ihnen zu einem so hochkomplexen Labyrinth von Verordnungen verschachtelt worden, dass sich nur noch wenige Spezialisten darin zurechtfanden. Das System war für den gemeinen Legna nicht nur unbrauchbar geworden, sondern begann ihm ganz persönlich zu schaden.
Viele waren es leid, in ein Spiel gezwungen zu werden, das sie von vornherein als Verlierer deklarierte. Es war nur allzu offensichtlich, dass die wenigen Gewinner des Spiels die Zahl der Verlierer mit allen Mitteln groß zu halten versuchten, damit ihre Gewinne nicht einbrachen.
Und so kam es, wie es kommen musste – die Gesellschaft der Legna zerbrach.
Tatkraft, Fähigkeiten, Talente und enorme Mengen an geistiger Energie gingen der Gesellschaft verloren, weil die Organisation, die die Masse der Legna in gewissen Schranken lenken sollte, selbst schrankenlos geworden war.
Hilflos mussten die einstigen Gewinnler des Systems zusehen, wie ihre kostbarste Ressource, die Masse der Verlierer, sich in den Weiten des Alls zerstreute, um wieder auf eigenen Füßen stehen zu lernen. Es half auch nicht mehr, dass sie die scheinheilige Parole ausgaben, dass das Wohl der Allgemeinheit über das des Einzelnen gehe. Denn allzu viele konnten diesen hehren Leitsatz nur noch als blanken Hohn empfinden, seit sie erkannt hatten, dass es einer relativ kleinen, aber elitären Kaste von ihnen gelungen war, auf Kosten der Masse „Allgemeinheit“ zu spielen.
Eine riesige Schar von Legna löste sich damals aus dem gesellschaftlichen Gefüge und verschwand, in lockere Verbände zersplittert, in den Tiefen des Alls, um auf eigene Faust ihr weiteres Dasein zu fristen. Nur ein Rest von ihnen blieb zurück, dessen Kern hauptsächlich aus den ehemaligen Organisatoren bestand, die auf den Ruinen der zerfallenen Gesellschaft besten Nährboden für ihre entartete Organisationswut vorfanden.
Über Äonen bildete sich wieder eine neue Legna-Gemeinschaft heran, deren organisatorische Ziele jetzt noch höher gesteckt waren als vorher. Ihre Macher träumten den schwülen Traum von einer „Kosmischen Allianz“. Diese sollte nicht nur alle verstreuten Splittergruppen unter einer großen Dachorganisation wiedervereinen, sondern diesmal auch das gesamte All als Gemeinschaftsterritorium verwalten.
In bewährter Weise begann man diesen Traum auszuschmücken und zu bewerben. Die Organisatoren wurden nicht müde, die Vorteile einer solchen Super-Allianz in den schillerndsten Farben auszumalen.
Es dauerte denn auch nicht lange, bis sich einige Stämme, trunken von den angepriesenen Möglichkeiten einer solchen Union, bereiterklärten, mitzumachen.
Die „Kosmische Allianz“ wurde aus der Taufe gehoben und ihre Organisation begann zu wachsen. Wieder machte man dieselben entscheidenden Fehler wie früher, doch durch den gigantisch erweiterten Spielraum schienen sie zunächst nicht weiter ins Gewicht zu fallen. Die Hemmschwelle der Organisatoren sank, und sie erlaubten sich immer noch größere Fehltritte.
Das riesige Spielfeld, das die neue Organisation jetzt darstellte, bot eine verhängnisvolle Verlockung: Verantwortung konnte darauf wie eine heiße Kartoffel endlos von einem zum anderen bugsiert werden, ohne je von einem getragen werden zu müssen. Statt ein effizientes Netzwerk eigenverantwortlicher Zellen zu schaffen, züchtete man den monströsen Wasserkopf einer zentralen Verwaltung, die um den Überblick zu bewahren, vereinheitlichte, was zu vereinheitlichen war. Schleichend verflüchtigte sich jede kulturelle Eigenart der Allianzmitglieder. Gefragt war in dieser Gesellschaft bald nur noch der berechenbare anpassungsfähige Einheitstypus.
Je mehr zersplitterte Stämme die Kosmische Allianz in sich aufsog, desto größer wurde ihre Macht und desto höher der Druck auf diejenigen, die sich noch immer nicht unter ihre Ägide begeben wollten.
Zunächst versuchte man mit aller Raffinesse Zwietracht unter den Führern und Meinungsbildnern der widerspenstigen Clans zu säen, um sie gegeneinander auszuspielen. Hatte man damit nicht den gewünschten Erfolg, so erging man sich ihnen gegenüber in Schmeicheleien, machte großzügige Geschenke und Sonderzugeständnisse. Half auch dies nichts, so drohte man ihnen schließlich unverblümt mit Isolation. Das hieß jedoch nicht, dass man sie jetzt ihrem Wunsch gemäß in Ruhe gelassen hätte. Nein, man unterzog sie scheinheilig einer Prozedur, die einem inoffiziellen Embargo gleichkam. Eine Taktik, die auch die hartgesottensten Eigenbrötler über kurz oder lang in die Knie und damit in den gierigen Ammenschoß der Allianz zwang.
Diejenigen, die sich der Allianz auf Dauer entziehen konnten, stilisierte man schlussendlich zum Feindbild für die Masse, indem man es ihr täglich aufs Neue in den schwärzesten Farben ausmalte.
Die Abtrünnigen nannte man fortan nur noch „Reficul“.
König Ludwig II. fuhr in seiner Rede fort.
„Wie bekannt sein dürfte, haben die Reficul den Planeten Erde lange vor unserer eigenen Ankunft schon einmal bewohnt. Ihre bevorzugten Wirtstiere waren damals die Saurier, mit denen sie sich energetisch paarten. Als diese ausstarben, zogen sie weiter und überließen die Erde und ihre Wesen wieder sich selbst. Sie rechneten nicht damit, dass sich auf absehbare Zeit eine interessantere Gattung als ihre geliebten Riesenechsen dort entwickeln könnte. Doch dann haben unsere Scouts vor etwa zwei Millionen Jahren diesen lange vergessenen Planeten als möglichen Erfahrungsraum für uns wiederentdeckt. Seitdem ist er der Territorialgewalt der Kosmischen Allianz unterstellt.“
Ludwig II. blickte mit ernster Miene auf seine versammelten Räte. Er wusste, dass er die Stimmung im Saal in eine Richtung lenken musste, die zu einem mehrheitlichen Beschluss führte.
„Die rasante Entwicklung des von uns erwählten Wirtstieres ‚Mensch’ allerdings, scheint nun auch das Interesse der Reficul für die Erde wieder neu entfacht zu haben. Es liegen untrügliche Anzeichen dafür vor, dass sie damit begonnen haben, auf irgendeine Weise unsere geliebten Wirtstiere zu sabotieren. Ihre Absicht dabei ist es, uns den Aufenthalt auf der Erde zu vergällen. Es scheint, als infizierten sie die Menschen mit irgendetwas, das bei den Legna, die sie als Wirtskörper benutzen, einen totalen Erinnerungsverlust auslöst – der Erfahrungsschatz eines ganzen menschlichen Lebens ausgelöscht!“
In der Runde der Räte herrschte bedrücktes Schweigen.
„Welcher Methode sich die Reficul dabei bedienen“, fuhr der König fort, „entzieht sich bislang noch unserer genauen Kenntnis. Wir nehmen jedoch an, dass es ihnen irgendwie gelungen ist, eine niedere außerirdische Lebensformen auf die Erde zu schmuggeln... möglicherweise Viren oder Bakterien, mit denen der Mensch bislang noch nicht konfrontiert gewesen ist.“
Das Gesicht des Königs hatte sich gerötet. Mit dem Gestenreichtum des vortrefflichen Rhetorikers ausgestattet, kreuzte er jetzt seine geballten Fäuste vor der Brust und brüllte in den Saal: „Legna! Dieser gemeinen Sabotage muss jetzt und für alle Zeit ein Ende bereitet werden!“
Die Versammelten warfen sich finstere Blicke zu, während die donnernde Stimme des Königs unter der goldgestirnten türkisfarbenen Kuppel des Saales verhallte. Da und dort wurden heftige Verwünschungen ausgestoßen.
„Zweifellos rechnen die Reficul damit, dass wir träge geworden sind und ihr heimtückisches Spiel nicht durchschauen“, fuhr Ludwig II. zufrieden mit der Reaktion auf seine Rede fort. „Vielleicht bilden sie sich ein, dass wir einfach irgendwann resigniert das Weite suchen...“
„Nein, niemals!“, vernahm man jetzt vereinzelte Zornesrufe aus der Schar der Räte.
„Legna! Brüder! Hört mich an! Ich versichere euch, dass wir ihnen die Menschen nicht ohne weiteres überlassen werden. Ich, als von euch gewählter Oberster Rat, habe diese Versammlung einberufen, um euch zu fragen, wie wir auf diese unglaubliche Provokation der Reficul antworten sollen. Es gibt zwei Möglichkeiten: Entweder wir legen unsere Hände in den Schoß und überlassen die ganze Angelegenheit den trägen Exekutivorganen der Kosmischen Allianz oder wir regeln die Sache auf unsere eigene Art.“
In die Schar der Räte kam jetzt Bewegung. Gemurmel wurde laut, und es bildeten sich verschieden große Zirkel, in denen heftig miteinander diskutiert wurde.
Jeder von ihnen, der in diesen Hohen Rat berufen worden war, hatte mindestens schon 1000 Leben in einem menschlichen Wirtskörper hinter sich gebracht. Der Gedanke an den möglichen Verlust dieses beliebtesten aller Wirtstiere erfüllte sie nicht nur mit flammendem Zorn, sondern auch mit unsäglichem Grauen vor der Langenweile, die sie befiele, wenn die energetische Paarung mit dem Menschen nicht mehr möglich war.
Der Blaue Planet mit seinen Menschen stand bei den Legna auf der Beliebtheitsskala für aktives Leben in der Materie ganz oben. Nirgends gab es etwas Vergleichbares. Für sie, die nichtstofflichen Energiewesen, war die Erde der Waikiki Beach des Kosmos, die Côte d’ Azur des Alls und das Haight-Ashbury des Universums, ein Ort, an dem es sich mehr als irgendwo sonst lohnte, materielle Erfahrungen zu sammeln. Das Leben im menschlichen Wirtskörper war für sie zu einer Art Kultdroge geworden: Dieses schauerliche Gefühlserlebnis eines gnadenlosen Verschlissenwerdens in einem sterblichen Körper und immer den Totalverlust des eigenen selbstverliebten Ich vor Augen… das war der Nektar, nach dem ein Legna dürstete, das war der Kick, der ihn anturnte und ihm sein ewiges Selbst erst erträglich machte.
Der Begriff „Erde“ war für ihn gleichbedeutend mit einer Megadisco ohne Sperrstunde, ein Trip dorthin garantierte Party bis die Lichter ausgingen.
Keiner von ihnen hatte mit diesem Boom gerechnet, als man sich vor zwei Millionen Jahren für die energetische Paarung mit einem skurrilen Materiekonglomerat entschied, das gerade begonnen hatte, aufrecht zu gehen und einer affenartigen Spezies angehörte. Doch das Gehirnvolumen dieses sonderbaren Wesens sowie die beträchtliche Anzahl vorhandener Synapsen schienen differenzierteste Erfahrungen zuzulassen und grenzenlosen Spaß zu verheißen.
Allerdings unterschied sich das Spaßempfinden eines Legna grundsätzlich von dem seines Wirtskörpers.
Einem Legna, der sich mit einem Materiewesen paarte, ging es ausschließlich um die Vielfalt von Erfahrungen, die er in dessen Körper machen konnte; welcher Art diese waren, war für ihn nur zweitrangig. Insofern war es ihm auch schlichtweg egal, ob sich die Menschen gegenseitig bekriegten oder in Frieden miteinander lebten. Es kümmerte ihn nicht im Geringsten, ob sie in Saus und Braus prassten, auf Pump lebten oder Ressourcen verschwendeten, deren Mangel sie irgendwann in Elend und Not stürzte. Gesetz und Ordnung etwa, oder das, was die Menschen selbst als soziales Verhalten bezeichneten, waren ihm auf der Erde nicht willkommener als Anarchie und Chaos. Ein Legna profitierte in jedem Fall. Weder frohlockte er über Ethos und Moralstreben seines Wirtskörpers, noch verdammte er dessen kriminelle Energie. Dem gewöhnlichen Legna war dies alles von Herzen einerlei. Er war im Kosmos unterwegs, um Erfahrungen zu sammeln – je mehr, desto besser, je schriller, umso lieber! Denn nur sie bescherten der Habenseite seines Erinnerungskontos den erstrebten Zuwachs.
Ein Legna war das ewige Gefäß, in dem sich die Erinnerung an gelebtes Leben kumulierte. Gut und Böse waren für ihn nur unterschiedliche Energiepole, durch deren unberechenbare Ladung die Situationsmotorik der materiellen Welt stimuliert und in Gang gehalten wurde.
Bewohnte ein Legna gerade keinen materiellen Wirtskörper, so hielt er sich zumeist in seinem Privat-Esidarap auf oder weilte unter seinesgleichen in einem der vielen Kommunal-Esidaraps, die an allen interessanten Orten des Alls von der Kosmischen Allianz errichtet worden waren.
Das private Esidarap eines Legna war ein virtuelles Gefilde, das er aus den zahllosen Erinnerungen seiner in der Materie gelebten Leben um sich herum erzeugen konnte, wann und wo immer er wollte. In seinem Esidarap stellte sich dem Legna jede noch so kleine, in einem stofflichen Wesen gemachte Erfahrung, in einer Klarheit und einem Facettenreichtum dar, wie sie in keinem materiellen Wirtskörper für ihn erlebbar gewesen wäre. Im Esidarap kristallisierte selbst der verschwommenste Eindruck, den ein Legna aus einem Leben in der Materie mitbrachte, zu einem strahlenden Solitär der Erinnerung aus.
Das Privat-Esidarap eines Legna war in etwa mit einem Filmstudio zu vergleichen, in dem er in Personalunion die Rolle des Regisseurs, des Hauptdarstellers, des Script Girls, des Cutters, des Maskenbildners und des Kulissenbauers einnahm.
Welche virtuelle Gestalt er dort für sich wählte, bestimmte einzig und allein seine Vorliebe für ein ganz bestimmtes Leben, an das er sich gerne erinnerte. Ob Frau oder Mann, ob alt oder jung – ganz nach Belieben! Es war ihm beispielsweise möglich, eine bestimmte Phase seiner Kindheit zu repetieren oder besonders interessante Episoden eines Lebens in Zeitlupe oder gar Frame für Frame nochmals auszukosten.
Auch war es einem Legna möglich, durch Konzentration andere Legna, mit denen er zu verkehren wünschte, in sein Esidarap einzuladen, um sie an seinen Erfahrungen teilhaben zu lassen. Diese gegenseitigen Besuche stellten nicht nur einen beliebten Zeitvertreib dar, sondern gleichzeitig eine Form des Bildungswesens. Es gewährte einem Legna, je nach Entgegenkommen seines Gastgebers, mehr oder weniger umfangreichen Einblick in ein Leben, das er selbst nicht gelebt hatte. Doch diese Einblicke hatten für den Besucher nur Secondhand–Charakter und waren nicht dazu geeignet, sie für die virtuelle Ausgestaltung seines eigenen Esidarap zu verwenden.
Deshalb waren auch die selbst in der Materie gemachten Erfahrungen für einen Legna das Kostbarste, was er besaß. Er bezeichnete diesen Schatz als sein persönliches „Erinnerungskonzentrat“.
Ob es schließlich zu einer Begegnung unter den Legna kam, hing einerseits von der Bereitschaft ab, einer gewissen Einladung Folge zu leisten, andererseits von der eigenen Verfügbarkeit. Denn für die Zeit, in der sich ein Legna gerade in einem materiellen Wirtskörper aufhielt, hatte er sein Legna-Bewusstsein verloren und war für seine Legna-Freunde nicht erreichbar.
Aber gerade dieses Vergessen der eigenen ewigen Existenz und der Totalverlust des bewussten Selbst im Moment der Inkorporation in den menschlichen Wirtskörper waren der Stoff, an dem sich ein Legna berauschte. Es war dieser kleine kalkulierbare Tod, dem er sich von Zeit zu Zeit lüstern in die Arme warf.
Die goldene Formel der Legna lautete denn auch: „Ohne Vergessen in der Zeit, kein Erinnern in der Ewigkeit!“
Im kontemplativen Rückblick auf ein gelebtes Erdenleben empfand ein Legna den Eintritt in das materielle Sein wie den Sprung an einem Bungee-Seil, von dessen sichernder Existenz er jedoch Zeit seines Lebens in der Materie nichts ahnte. Der Aufenthalt in einem menschlichen Wirtskörper war für ihn eine sich im Fallen abspulende Offenbarung, bis der Tod nahte, das Seil sich straffte, und ihn kurz vor seiner ganz unvermeidlich scheinenden totalen Vernichtung wieder zurückkatapultierte in die vertraute Welt seines nichtstofflichen Seins.
Ja, der Aufenthalt im menschlichen Körper hatte etwas Einzigartiges. Denn nur dieses bedingungslose Ausgeliefertsein an ein stoffliches Gehirn, das sich in den losen Fäden eines selbstgestrickten Raum-Zeit-Kontinuums verheddert hatte, vermittelte den prickelnden Schauder und den makaberen Reiz, dem sich kein Legna lange zu entziehen vermochte.
Das Erlebnis des Todes bescherte einem Legna, der sich in seinem Privat-Esidarap wieder daran erinnerte, das unbeschreibliche Lustgefühl eines postmortalen Orgasmus – und er erinnerte sich oft und gerne daran.
Ohne mentale Einladung konnte kein Legna das Esidarap eines anderen aufsuchen. Außer den Besuchern, die ein Legna in sein persönliches Esidarap geladen hatte, waren alle anderen Wesen dort ausschließlich von der Klarheit und Güte seiner Erinnerung belebt; „LODI“ wurden diese Erinnerungswesen genannt – und ihre Präsenz wirkte im Esidarap oft um ein Vielfaches realer und intensiver, als sie der Legna in seinem irdischen Leben empfunden hatte.
Die meisten Legna pflegten eine rege Besuchskultur. Manch einer hatte in seinem persönlichen Esidarap beständig eine Entourage von mehreren Hundert Dauergästen um sich versammelt. Oft handelte es sich dabei um gute alte Bekannte und noch öfter um die sogenannten Greenhorns, die erst wenige oder noch gar kein Leben auf der Erde gelebt hatten. Diese waren höchst begierig darauf, sich von den „Alten“ ein paar nützliche Informationen zu beschaffen, bevor sie die Reise in einen menschlichen Wirtskörper antraten.
Alle Bewerber für eine Inkorporation in ein menschliches Wirtstier hatten sich im terrestrischen Kommunal-Esidarap einzufinden und anzumelden. Dort, in der aus dem Erinnerungskonzentrat von Milliarden von Erdenleben konstruierten virtuellen Gigantenstadt der Legna, namens DEFCON 1, stand der riesige Terminal, von dem aus die Legna in ihre irdischen Wirtskörper verschickt wurden.
Die Neuankömmlinge, die aus allen Regionen des Alls dort eintrafen und noch nie in ein menschliches Wesen inkorporiert gewesen waren, nannte man „KAERF“. Da sie über noch keinerlei Erinnerung an ein Erdenleben verfügten, erschienen sie in DEFCON 1 notgedrungen in der Gestalt, die ihre Erinnerung aus anderswo in der Materie gelebten Leben zu imaginieren in der Lage war.
Die Gästeschar eines Legna setzte sich daher nicht selten aus sehr verschiedenen, teils äußerst bizarren Wesen zusammen, die entsprechend ihrer Seltenheit mit wärmsten Empfehlungen von einem Gastgeber zum nächsten weitergereicht wurden.
Obwohl es den Legna Spaß bereitete, die Verständigungsgeräusche der von ihnen benutzten Wirtstiere auch im Esidarap zu imitieren, waren sie bei ihrer Kommunikation untereinander doch keineswegs auf diese angewiesen; denn allein schon die gegenseitige Bereitschaft sich mitzuteilen, vermittelte ihnen das Mitzuteilende als Wissen.
Dennoch galt es in ganz DEFCON 1 als verpönt, sich ohne menschliche Sprachgeräusche zu unterhalten. Ja, die nonverbale Kommunikation trug mittlerweile das Stigma einer Subkultur. Auch dieses Phänomen zeigte unter vielen anderen, wie weit sich die terrestrische Legna-Gemeinde bereits an das Verhalten ihrer Wirtstiere angeglichen hatte.
So interessant der Aufenthalt im Esidarap aber auch sein mochte, die meisten Legna überkam nach einer Weile doch immer wieder das Verlangen nach einem geeigneten stofflichen Wirtskörper, in dem sie neue Erfahrungen sammeln und den Schatz ihrer Erinnerung vergrößern konnten. Denn Erinnerung an ein in der Materie gelebtes Leben war der einzige Stoff, mit dem sich der Ausbau ihrer virtuellen Welt vorantreiben ließ. Nur der permanente Nachschub an Erinnerung gewährleistete, dass sich das Zeitvolumen in ihrem persönlichen Esidarap weiter ausdehnen konnte. Denn auch die Zeit war für den Legna etwas anderes als für seinen irdischen Wirtskörper, den Menschen. Dieser nämlich, konnte in seiner stofflichen Existenz die Zeit nur als zweidimensionales Phänomen erfassen, das aus dunkler Vergangenheit auftauchend, die Gegenwart seines Seins streifte und in den undurchdringlichen Nebeln der Zukunft wieder verschwand. Auch hatte der Mensch auf die wesentliche Geschehnisfolge nur einen verschwindend geringen Einfluss, da sich sein Wirken zumeist auf plumpe bis brutale, rein motorische Eingriffe beschränkte, die ihm das Gefühl eines gewissen Fortschreitens vermittelten und sich ihm in Ihrer Summe als Zivilisation und Kultur darstellten.
Ganz im Gegensatz dazu, war die Zeit für den Legna ein Gebilde, das sich räumlich ausdehnte. Ein wabernder Cluster aus sich durchdringenden und überlappenden Ebenen, von denen jede einzelne ein in der Materie gelebtes Leben darstellte. Je mehr Leben ein Legna daher gesammelte hatte, desto größer war auch das Zeitvolumen, in dem sich seine Imagination tummeln konnte.
Indem sich ein Legna in seinem Privat-Esidarap in jedes seiner einmal gelebten Leben zurückversetzen konnte und innerhalb desselben in jede gewünschte Phase, reiste er quasi in seinem erworbenen Zeit-Cluster durch Vergangenheit und Zukunft. Die Zeit in seinem Privat-Esidarap war vergleichbar mit einem Kuchenteig, und Erinnerung war die Hefe, die ihn aufgehen ließ. Auch die Gegenwart war nichts, was ein Legna dort schicksalsergeben zu ertragen hatte, sondern glich eher einer einladenden Festtafel, die er selbst für sich gedeckt hatte.
Was die virtuelle Konzeption ihres persönlichen Erscheinungsbildes oder das ihres Privat-Esidarap betraf, waren die meisten Legna eher Puristen. Doch gab es da auch die sogenannten „DIK“, die sich wenig um die allgemeinen Konventionen scherten. In ihrer kreativen Unersättlichkeit mischten sie das Zeit- und Lokalkolorit verschiedenster Leben so kunterbunt durcheinander, dass sich einem konservativen Legna, der von ihnen in ihr Privat-Esidarap eingeladen wurde, nicht selten die virtuelle Haarpracht sträubte.
Die menschlichen Wirtstiere ahnten nicht, dass das Überleben ihres Ichs, das im Grunde nichts anderes war als ein aus unzähligen Erinnerungen geknüpfter Flickenteppich, einzig und allein von der Tatsache abhing, dass nichtstoffliche Energiewesen in heimlicher Symbiose mit ihnen lebten. Nur so blieb die Erfahrung ihres ganz einzigartigen Lebens erhalten, nur so bewahrheitete sich das von ihnen ersehnte Leben nach dem Tod. Ihre Erinnerungen waren der kostbare Blütenstaub, der das unermessliche All befruchtete und neue unvorstellbare Formen des Lebens hervorbrachte.
Es gab nur einen einzigen Grund, der die Legna hätte veranlassen können, sich aus der von ihnen favorisierten Lebensform Mensch zurückzuziehen – Langeweile durch Harmonie!
Doch dieser Anlass zur Emigration schien bis auf weiteres nicht gegeben, denn das menschliche 1,4-Liter-Gehirn arbeitete geflissentlich daran, die Waagschale des Geschehens mit erfrischenden Gegensätzen zu füllen. Es sorgte dafür, dass Hunger, Völkermord und Seuchen weiterhin ihre Chance erhielten, und dass auch die gute reine Seele nicht daran gehindert wurde, ihrem leidenschaftlichen Traum von der fortschreitenden Veredelung des menschlichen Wesens zu frönen.
König Ludwig II. räusperte sich jetzt und sah auf seine diamantenbesetzte goldene Rolex-Uhr. Sie hatte die Funktion eines bewusst inszenierten Makels, welcher der Perfektion seiner virtuellen Erscheinung die Spitze nehmen sollte; hatte sich doch erst unlängst ein DIK in geselliger Runde über sein detailversessenes Authentizitätsstreben mokiert.
Diese kostbare Uhr stammte aus einem ganzen Sortiment, das ihm in einem späteren Leben als exaltierter Modezar mit Geschäftsadresse auf der Münchner Maximilianstraße zur Verfügung gestanden hatte.
Mit leichter Wehmut und dem Anflug eines wohligen Prickelns im Schritt gedachte er des hochinteressanten Erfahrungsschatzes, den er aus diesem so jäh durch Gewalt erloschenen Leben mitgebracht hatte.
Seine Haltung straffte sich, als er sich nun erneut an die Versammlung wandte.
„Hört mich an, ihr Legna!“
Langsam verebbte das durch den Raum wogende Gemurmel der vielen Stimmen.
„Bedenkt, wie lange es dauern kann, wenn wir den regulären Verwaltungsweg einschlagen und den verabscheuungswürdigen Anschlag der Reficul auf unsere Wirtskörper bei der Kosmischen Allianz zur Anzeige bringen! Bis ein endgültiger Beschluss der Hohen Kammer vorläge, hätten wir Erinnerungskonzentrat in unvorstellbaren Mengen eingebüßt. Bedenkt auch, dass es jeden von euch bei seiner nächsten Inkorporation treffen kann! Jeder ist von nun an der Gefahr ausgesetzt, in einem infizierten Wirtskörper zu landen und ohne Erinnerung an sein gelebtes Leben hierher zurückzukehren!“
Noch einmal wanderte der Blick des Königs über die ernsten Gesichter seiner versammelten Räte, dann forderte er sie mit donnernder Stimme auf: „Lasst uns also zur Abstimmung schreiten! Wer dafür ist, den Gerichtshof der Kosmischen Allianz anzurufen, der möge jetzt seine rechte Hand erheben!“
Schweigen im Saal. Keiner rührte sich.
In den Mienen der Anwesenden spiegelte sich einhellige Entschlossenheit wider: Es war Zeit zu handeln! Selbst zu handeln! Und zwar sofort!
„Nun gut“, fuhr Ludwig II. mit einem zufriedenen Lächeln fort, „wie es scheint, sind wir uns alle einig, diese Angelegenheit selbst in die Hand zu nehmen! Wir haben zwar schon vor langem beschlossen, so wenig direkten Einfluss wie möglich auf das irdische Leben zu nehmen, doch in diesem Fall können wir nicht anders, und ihr alle wisst, was das heißt…“
Stimmen wurden laut im Saal, und immer mehr begeisterte Rufe schollen aus der Menge zu ihm empor. Der Lärm schwoll an und mündete allmählich in einen stakkatoartigen Rhythmus, als mehr und mehr der Versammelten einen einzigen Namen zu skandieren begannen: „Reganam! Reganam! Reganam!...“
Aus den ersten Reihen der Versammelten zwängte sich jetzt plötzlich eine dralle Frau hervor. Sie besaß ein rosiges, leicht pockennarbiges Gesicht und trug die Tracht einer Pariser Dienstmagd der Revolutionszeit. Mit wenigen Schritten und rauschenden Rockschößen erklomm sie die untersten Stufen der Apsis und begann mit wildem Armgefuchtel den Chor der Legna anzufeuern. Ihr linnenes Obergewand war aufgesprungen und gab ihre alabasternen Brüste preis. So unbedacht ihrer Barbusigkeit hatte sie etwas Furioses an sich, beinahe wie die Trikolore schwingende Liberté im Gemälde von Delacroix.
Obwohl ihr Verhalten jeglicher Versammlungsetikette entbehrte, unterließ es der König, sie zur Ordnung zu rufen. Hatte er doch erreicht, was er zu erreichen gehofft hatte – die absolute Mehrheit der versammelten Ratsmitglieder. Das war alles, was im Augenblick zählte. Denn ohne die Einmütigkeit aller Ratsmitglieder wäre es aussichtslos gewesen, den aus seinem Privat-Esidarap herbeizurufen, dessen Namen da aus aller Munde scholl – Reganam, den Einsamen, der die meisten Leben auf Erden gelebt hatte.
Sein Beiname war ihm verliehen worden, weil er in seinem Esidarap am liebsten allein blieb. Nur wenigen Auserwählten hatte er bisher gestattet, ihn dort aufzusuchen, und diese bewahrten eisernes Stillschweigen darüber.
Reganam hatte bereits mehrere Berufungen in den Hohen Rat unkommentiert verhallen lassen. Keinesfalls war er das, was man landläufig als umgänglich bezeichnete. Nichts lag ihm ferner als das Naheliegende und nichts näher als das Unerwartete.
Obwohl ihm durch seine erfolgreichen Missionen auf der Erde große Ehren und seltene Privilegien zuteil geworden waren und er bei den meisten Legna in hoher Achtung stand, fanden doch einige seine Zurückgezogenheit nicht besonders schicklich. Andere monierten hinter vorgehaltener Hand, dass die große Anzahl seiner Erdenleben ihn etwas seltsam habe werden lassen, um nicht zu sagen menschlich.
Diesmal aber war die Notwendigkeit, sich seiner Dienste zu vergewissern, so hoch, dass sich auch die ewigen Nörgler ihrer Unkenrufe enthielten und zu einem absoluten Mehrheitsbeschluss beitrugen.
König Ludwig II. hatte sich bereits vor dem Versammlungstermin von der Inkorporationsbehörde bestätigen lassen, dass Reganam zurzeit verfügbar war und sich in seinem Privat-Esidarap aufhielt. Jetzt galt es, sich mit aller Energie in einer konzertierten Aktion an ihn zu wenden. Denn vom Ruf eines Einzelnen, und wäre es auch der Oberste Rat höchstpersönlich gewesen, hätte er sich wie üblich nicht aus der Abgeschiedenheit seines Esidarap hervorlocken lassen. Nur auf den Ruf weniger alter Freunde reagierte er noch, aber zu diesem erlauchten Freundeskreis zählte der Oberste Rat nicht.
„Nun denn, lasst ihn uns rufen!“, sagte Ludwig II. mehr zu sich selbst als zu der lärmenden Menge. Um seine Lippen spielte ein dünnes listiges Lächeln. Sein Plan schien aufzugehen.
Dann schloss er die Augen, konzentrierte sich auf die Kraftfeldkoordinaten des Einsamen und fiel in den begeisterten Chor der Rufer ein: „Reganam! Reganam! Reganam!
2
Es war ein sehr trockener Sommer gewesen droben in den Wäldern Ontarios. Rings um den kleinen Jackfish-Lake herrschte eine Dürre wie schon seit Jahren nicht mehr. Die Früchte des Waldes waren noch vor der Reife vertrocknet, was die Bären, die sich sonst um diese Zeit an Pilzen und Beeren satt zu fressen pflegten, auf ihrer Suche nach Nahrung immer häufiger in die Nähe der menschlichen Behausungen trieb. Auch das Wasser des Sees verzeichnete einen nie gesehenen Tiefstand. Der etwa 50 Meter lange künstliche Tunnel am südlichen Ende, der unter einer Eisenbahntrasse hindurchführte und dem Wasseraustausch mit dem großen Lake Superior diente, hatte seit Monaten nur ein spärliches Rinnsal geführt. Übermütige Biber hatten in den letzten Tagen sogar damit begonnen, in der trügerischen Sicherheit der übermannshohen Röhre einen Damm aus armdickem Knüppelholz zu errichten. Nur ein einziger heftiger Wolkenbruch, und ihr hölzernes Bauwerk würde in Einzelteile zerlegt in den See gespült werden.
Dan Robinson saß auf der verwitterten Veranda seiner Jagdhütte, die auf einer kleinen Rodung dicht am Seeufer stand und flickte den Kescher, den ihm ein Prachtexemplar von Hecht am Vortag zerrissen hatte. Er hegte keinen Groll gegen das Tier, denn es hing bereits ausgenommen oben an einem Dachsparren des wuchtigen Blockhauses in der frischen Brise des beginnenden Indian Summers zum Trocknen.
Die Saison war gut gewesen und hatte ihm bereits einen reichen Wintervorrat an Fisch beschert. Allerdings hatte er selten etwas anderes als Hechte aus dem Jackfish-Lake gezogen, und so hatte er sich für diesen Tag vorgenommen, seinen Vorrat noch durch ein paar wohlschmeckende Seeforellen aus dem benachbarten Lake Superior aufzustocken. Er blickte auf den See hinaus, über dem sich die Morgennebel allmählich zu lichten begannen und überlegte: Auch wenn der Verbindungstunnel wegen des Niedrigwassers zurzeit nicht befahrbar war und er das Kanu, den zwei PS starken Außenborder und die Ausrüstung in mehreren Gängen hindurchtragen musste, so konnte er doch gegen Mittag drüben auf dem großen See sein.
Eigentlich hasste er den Lärm und Gestank des Motors und benutzte ihn so gut wie nie. Für den erfolgreichen Fang von Seeforellen jedoch war er unabdingbar, denn die schwere Stahlleine der Angel musste durch die tieferliegenden Kaltwasserschichten geschleppt werden, in die sich die Fische um diese Jahreszeit zurückgezogen hatten.
Dan stand auf und streckte sich. Er trug ein rotkariertes Baumwollhemd, darüber eine lederne Outdoor-Weste mit vielen zweckmäßigen Taschen in verschiedener Größe, lederne Cowboystiefel sowie eine khakifarbene Hose aus Armeebeständen. In einer ledernen Scheide an seinem Gürtel steckte ein respekteinflößendes Bowiemesser. Sein Körper war durch die Arbeit im Busch gestählt, sein Teint wettergebräunt. Er war in seinen frühen Vierzigern, trug einen wuscheligen blonden Haarschopf und besaß ein Paar ausdrucksvoll strahlende Augen von wasserblauer Farbe.
Seit die Papierfabrik im 20 Kilometer entfernten Terrace Bay vor drei Jahren ihre Tore geschlossen hatte und er mit dem Großteil der übrigen Einwohner der Kleinstadt arbeitslos geworden war, hatte er sich in seine Jagdhütte am nordwestlichen Ufer des Jackfish-Lake zurückgezogen und versucht, im Busch zu überleben.
Lilly, seine Lebensgefährtin, die im Personalbüro der Fabrik gearbeitet hatte, hatte damals die Wahl zwischen dem lukrativen Jobangebot einer Minengesellschaft im 2000 Kilometer entfernten Nova Scotia und einem Leben in der Wildnis gehabt. Managerin, die sie war, hatte sie sich für den Job entschieden.
Die anfängliche Sehnsucht nach ihr, die Dan in manch einsamer Nacht am See wie eine jähe Springflut überfallen hatte, war nach und nach verebbt und ihr Bild zu einem Schemen verblasst. Im ersten Jahr waren noch ein paar Briefe von ihr auf dem Postamt in Tarrace Bay eingetroffen, die er bei seinen gelegentlichen Einkaufstouren von dort abgeholt hatte. Aber Dan war kein Mann der Feder. Ja, es überkam ihn sogar etwas wie Scham bei dem Gedanken, die Gefühle, die er für Lilly hegte, einem Blatt Papier anzuvertrauen und dieses aus der Hand zu geben. Und da ihre Briefe von ihm nicht erwidert wurden, waren sie schließlich ganz ausgeblieben.
Er selbst hatte es nie bereut, ein Leben im Busch gewählt zu haben. Mit Schaudern dachte er an die zwölfstündigen Wechselschichten in der ungesunden Atmosphäre der Fabrik, aus deren Schloten Tag und Nacht dicke Schwaden emporgestiegen waren, die die ganze Region unter eine Glocke modrigen Gestanks gehüllt hatten.
Wenn er damals nach Hause gekommen war, hatte sich ein immer gleiches Ritual vollzogen: Ein schneller Snack aus der Mikrowelle, eine idiotische Soap im TV und ein Sixpack Molson Canadian. Dieses Rezept sollte seinen Motor drosseln und den fremdgesteuerten Roboters, der aus ihm geworden war, auf das große Vergessen im Schlaf einstimmen.
Lilly und er arbeiteten damals in verschiedenen Schichten. Zu Hause gaben sie sich sozusagen die Klinke in die Hand: Kam er, so ging sie und umgekehrt. Der gleichzeitige Wunsch zum Beischlaf war eine Seltenheit geworden. Die raren Aktionen körperlicher Liebe waren bald nur noch ein von komplizierter Terminplanung diktiertes Pflichtstück, das bald den Charakter einer unfreiwilligen Überstunde annahm. Ein paar im Affekt der Verzweiflung getätigte Quickies zwischen Tür und Angel waren zum Schluss der einzige Kitt, der ihre schal gewordene Beziehung noch zusammengehalten hatte. Wahrscheinlich wären sie früher oder später sowieso auseinandergegangen, wie es eben so war in einer fortschrittlichen Gesellschaft, wo der gnadenlose Kampf ums tägliche Brot mittlerweile mehr Partnerschaften kostete als alle anderen Gründe zusammengenommen.
Dans Leben im Busch war arbeitsreich und hart. Aber wenn er jetzt abends im Schaukelstuhl auf seiner Veranda saß und genüsslich auf seiner alten Maiskolbenpfeife kaute – die er übrigens nie in Brand steckte – wenn er auf die gekräuselte Oberfläche des Sees hinausblickte und den eigentümlichen Geruch von harzigem Holz und feuchten Algen in seine Lungen sog, dann war ihm, als hätte er den Großteil seines Lebens in dumpfem Dämmer zugebracht und wäre erst hier draußen, in der rauen Wildnis, erwacht und zu sich selbst gekommen.
Langsam und bedächtig, wie es in der freien Natur seine Art geworden war, begann er jetzt sein Angelgerät zu überprüfen und es dann mit der übrigen Ausrüstung zum hölzernen Bootssteg hinunterzuschaffen. Eine halbe Stunde später befand er sich mit seinem schmalbäuchigen Kanu auf dem See und steuerte an den langgestreckten Schilfgürteln vorbei auf die kleine, südlich gelegene Bucht zu, wo der stählerne Verbindungstunnel zum Lake Superior lag.
Dan Robinson hatte den Tunnel schon oft passiert. Manchmal war der Wasserstand darin so hoch, dass man im Boot den Kopf einziehen musste; dann wiederum gab es Zeiten, in denen die starke Strömung eine Durchfahrt völlig unmöglich machte.
Als er jedoch an diesem Tag in die felsige Bucht einfuhr und sich dem dunkel gähnenden Maul des Tunnels näherte, sah er, dass dessen unterer Rand sich jetzt bereits zwei Handbreit über der Wasseroberfläche befand. Der Tunnel war trocken.
Er stellte den Motor ab und verharrte einen Augenblick in absoluter Bewegungslosigkeit. Sein wacher Instinkt und seine im Busch geschärften Sinne registrierten sofort, dass etwas anders war als sonst.
Die ungewöhnliche Stille, die ihn mit einem Mal umgab, hatte etwas Bedrohliches an sich... etwas Lauerndes. Kein Blatt an den Bäumen regte sich. Die Stimmen der Vögel, die sonst permanent für eine bunte Geräuschkulisse sorgten, waren verstummt.
Dan sah zum Himmel hinauf, aber der Ausschnitt davon, der sich ihm aus dem engen Felsenkessel darbot, verriet nichts von einem etwa bevorstehenden Wetterwechsel. Da war nur strahlender Azur.
Trotzdem beschlich ihn ein seltsames Unbehagen, als er jetzt ins seichte Wasser stieg, um das Boot ans steinige Ufer neben dem Tunneleingang zu ziehen und dort festzuzurren.
Das stehende Wasser war brackig geworden und hatte eine tief rostbraune Farbe angenommen, die unangenehm an altes geronnenes Blut erinnerte.
Gewandt balancierte Dan auf dem glitschigen Gestein hinüber zur Öffnung der Tunnelröhre und blickte hinein.
Der Lichtschein, der normalerweise vom anderen Ende des Tunnels herüberdrang war verschwunden. In der Röhre herrschte auf den ersten Blick absolute Dunkelheit.
Vorsichtig machte Dan ein paar Schritte hinein und wartete bis sich seine Augen auf das Dunkel eingestellt hatten. Dann sah er es: Etwa in der Mitte des Tunnels begannen sich im schwachen Gegenlicht allmählich die Konturen eines wüsten Verhaus aus Ast- und Wurzelwerk abzuzeichnen.
„Diese Mistviecher!“, stieß er hervor, konnte sich allerdings eines Grinsens nicht erwehren. „Das ist mein Tunnel, hört ihr!“, hallte seine Stimme donnernd durch die Röhre.
Es war kein Laut zu hören. Anscheinend hatten die Biber seinen Bootsmotor schon von weitem gehört und sich umgehend aus dem Staub gemacht.
Dan wusste, dass sein Angelausflug für diesen Tag gelaufen war. Schritt für Schritt tastete er sich gegen die hölzerne Barriere vor. Er wollte sich einen Überblick verschaffen, wie lange es in dauern würde, sie in mühseliger Arbeit nach draußen zu schaffen, um den Tunnel wieder passierbar zu machen.
Als er sich dem hölzernen Tohuwabohu näherte, das tierischer Eifer hier angerichtet hatte, trat sein Fuß plötzlich auf etwas Weiches.
Unwillkürlich zuckte er zurück.
Vor seinen Füßen konnte er jetzt eine dunkle Masse ausmachen, und gleichzeitig nahm er einen wohlvertrauten Geruch wahr – den Geruch von frischem Blut.
Langsam bückte er sich, um das, was da vor ihm lag, genauer in Augenschein zu nehmen. Es handelte sich dabei um den zerfetzten vorderen Teil eines Biberkadavers. Das Blut war noch warm.
Wie ein Blitz durchzuckte es ihn, als ihm die Situation, in der er sich befand, klar wurde. Für einen Augenblick war er wie gelähmt, dann aber kam Bewegung in seinen Körper. Jäh fuhr seine Rechte hinab an den Gürtel und zog das schwere Bowiemesser aus der Scheide. Dann wirbelte er herum, um in einem halsbrecherischen Spurt den Tunnelausgang zu erreichen – zu spät! Schon nach wenigen Sätzen blieb er wie angewurzelt stehen. Das Licht, auf das er zugelaufen war, hatte sich unversehens verdunkelt. In der Tunnelöffnung erschien die Silhouette eines riesigen Bären.
Das Tier schien verärgert zu sein. Den mächtigen Schädel missmutig hin- und herwiegend, witterte es mit geifernden Lefzen in das Dunkel. Langsam schob es seinen massigen Körper vorwärts… und dann erscholl die Stimme des größten Landraubtieres der Erde, die auch noch dem erfahrensten Jäger das Mark in den Knochen gefrieren lässt, wenn er ihm auf diese Distanz gegenübersteht. Ein ohrenbetäubendes röhrendes Brüllen, voller bestialischer Aggressivität, brachte jetzt die stählernen Wände des Tunnels zum Vibrieren.
Dans Nackenhaar sträubte sich. Sein Herz raste mit seinen Gedanken um die Wette. Der jähe Adrenalinausstoß seines Körpers begann bereits seine Knie weich werden zu lassen. Wenn er jetzt nicht handelte, hatte er jede Chance verspielt.
Die Flucht nach hinten war unmöglich. Ein Rückzug war ihm durch die Barriere des Biberbaus verwehrt.
Es gab nur einen Weg: Vorwärts!
Es gab nur eine Lösung: Kampf!