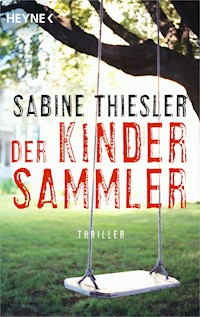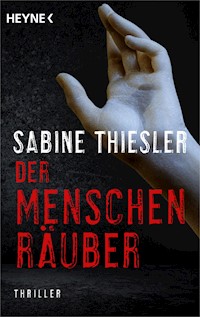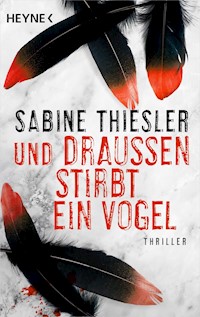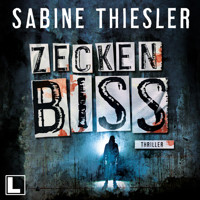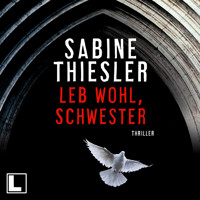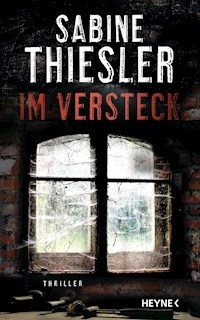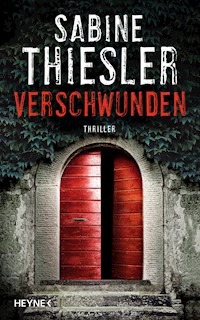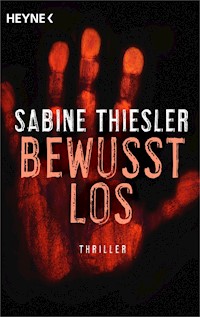
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Er kam im Sommer. Völlig überraschend. Aber er war kein Mensch, er war ein Ungeheuer.
Als Raffael erwacht, sind sein Bett und seine Sachen voller Blut. Er gerät in Panik, denn ihm fehlt jegliche Erinnerung an die vergangene Nacht. Es gelingt ihm nicht herauszufinden, was passiert ist, aber wenn er getrunken hat, weiß er nicht mehr, was er tut. Mordet vielleicht, ohne es zu wissen.
Von seinen Eltern, die in der Toskana leben, fühlt er sich verraten und verlassen. Die beiden führen ein glückliches Leben und ahnen nicht, dass er in ihrer Nähe ist und sie längst im Visier hat ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 603
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
SABINE THIESLER
BEWUSSTLOS
Thriller
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2013 by Sabine Thiesler und Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Covergestaltung: Eisele Grafik∙Design, München,
unter Verwendung eines Bildes von © Paul Taylor / Corbis
Satz: C. Schaber Datentechnik, Wels
ISBN: 978-3-641-08813-2 V004
www.heyne.de
Der Hass ist die Liebe,an der man gescheitert ist.
SØREN KIERKEGAARD
CHRISTINE
1
Florenz, 15. Dezember 2011
»Er kam im Sommer. Völlig überraschend. Aber er war kein Mensch, er war ein Ungeheuer.«
»Inwiefern?«
Christine atmet tief durch und überlegt. »Das ist eine lange Geschichte.«
»Das macht nichts. Ich habe Zeit. Und nur deswegen bin ich nach Florenz gekommen. Um Ihre Geschichte zu hören.«
»Also gut.«
Dr. Manfred Corsini ist ein vom Gericht bestellter psychiatrischer Gutachter. Er lebt und arbeitet normalerweise in Bozen, hat einen italienischen Vater und eine deutsche Mutter und ist zweisprachig aufgewachsen. Christine kann sich zwar auf Italienisch ganz gut verständigen, aber für die anstehenden schwierigen Gespräche und für die Gerichtsverhandlung reichen ihre Sprachkenntnisse nicht aus.
»Erzählen Sie mir von Ihren Kindern, Ihrem Mann, Ihrem Leben in Deutschland und in Italien.«
Christine braucht lange, bis sie anfängt zu reden. Dann sagt sie leise: »Ich hatte die schönsten Kinder der Welt. Raffael und Svenja. Glauben Sie mir, sie waren einfach perfekt. Wir wohnten damals oben im Norden, in Nordfriesland, gleich hinterm Deich.« Sie lächelt. »Das war toll für die Kinder. Sie konnten endlos draußen toben und Fahrrad fahren. Wir hatten ein Haus in einem kleinen Ort, in Tetenbüll, das war wie Bullerbü. Bis zu diesem schrecklichen Tag hab ich da verdammt gern gewohnt. Kindergarten und Grundschule waren direkt im Ort, meine Mutter wohnte auch in der Nähe und passte oft auf die Zwillinge auf. Ich arbeitete als Lehrerin ungefähr fünfzehn Kilometer entfernt in Tönning, und Karl war Dozent an der Hamburger Uni. Da musste er zwar ziemlich viel hin- und herfahren, aber das hat ihn nicht gestört. Es war alles prima. Wirklich. Heute ist mir das klar, damals nicht so. Wie glücklich man war, merkt man immer erst hinterher.
Und Zwillinge sind ja ein Geschenk. Die beiden waren den ganzen Tag zusammen, haben miteinander gespielt und sogar eng umschlungen geschlafen. Einer konnte ohne den andern nicht sein. Es war unglaublich. Ich kann mich nicht erinnern, dass sie mal rumquengelten oder sich langweilten … nein, nie. Es war ja nie einer allein. Das war eine so starke Symbiose, das kann man sich gar nicht vorstellen.
Aber ich fand es großartig. Es tat einfach irrsinnig gut zu sehen, dass meine beiden Kleinen rund um die Uhr richtig vergnügt und zufrieden waren.«
Sie schluckt und braucht eine Pause von einigen Sekunden, dann redet sie weiter.
»Passiert ist es am 24. April 1992.«
»Wie alt waren die Zwillinge da?«
»Sieben. Sie gingen in die erste Klasse.«
»Erzählen Sie mir möglichst genau von diesem Tag. Versuchen Sie sich zu erinnern. So detailliert wie möglich.«
»Es ist jetzt fast zwanzig Jahre her, aber der Tag ist mir für immer ins Gedächtnis eingebrannt. Was glauben Sie, wie oft ich ihn Minute für Minute durchgegangen bin, ob ich irgendetwas hätte anders machen können! Aber mir ist nichts eingefallen.«
»So müssen Sie sich wenigstens keine Vorwürfe machen.«
Christine funkelt Dr. Corsini wütend an. »Vielleicht. Aber diese Machtlosigkeit halt ich nicht aus. Manchmal denke ich, es wäre einfacher, wenn irgendjemand Schuld hätte. Dann könnte ich wenigstens hassen und müsste nicht das Schicksal verfluchen, dem es wahrscheinlich scheißegal ist, ob es verflucht wird oder nicht.«
»Wahrscheinlich.« Dr. Corsini bleibt ganz ruhig. »Was passierte denn nun an diesem Tag im April?«
»Es war ein Freitag. Und es war schon ziemlich warm. Das weiß ich noch. Für norddeutsche Verhältnisse eigentlich ungewöhnlich warm. Und wie immer waren die Zwillinge bereits in aller Herrgottsfrühe wach.
Seit sechs Uhr morgens hockten sie vor unserem Bett und hypnotisierten aus zehn Zentimetern Entfernung unsere Gesichter. Dabei atmeten sie wie hechelnde Hunde und warteten auf die kleinste Regung, ein Wimpernzucken, um dann in unser Bett zu springen.
An diesem Morgen hatte ich wohl irgendwie ein Viertelauge geöffnet – jedenfalls stürzten sie sich sofort auf uns. Karl spielte den Ohnmächtigen. Und es ist schwer, sich nicht zu rühren, wenn die Kleinen an deiner Unterlippe herumzuppeln, am Ohr ziehen und die Füße kitzeln. Aber er war da stoisch und hat erst kapituliert, als sie ihm ihre kleinen Finger in die Nase steckten.
Wir haben eine Viertelstunde getobt, dann sprang Karl auf und ging ins Bad. Ich bin noch eine Weile liegen geblieben und hab den beiden die Rücken gekrault. Sie schnurrten wie kleine Katzen. Und ich schnupperte an ihren Nacken. Der Babygeruch war fast weg, aber noch nicht ganz.
Als sie Säuglinge waren, hab ich oft gedacht: Sie riechen wie Gummiente mit Honig.
Für mich war es der schönste Geruch der Welt.
Nach dem Frühstück hab ich sie dann in die Schule gebracht. Wie jeden Morgen. Das lag für mich auf dem Weg. Ich ließ sie aussteigen, sie rannten auf den Schulhof, und ich fuhr weiter.
Auch an diesem Morgen war alles ganz normal. Im Wegfahren hab ich noch Irmgard gesehen, aber hab ihr nur kurz zugenickt. Sie wusste, dass ich es immer eilig hatte, weil ich um Viertel vor acht in Tönning sein musste. Irmgard wohnte auch in unserer Siedlung und hatte einen Sohn, Fiete, der war acht. Mit ihm haben die Zwillinge oft gespielt.
Ich kann mich nicht daran erinnern, dass an diesem Tag irgendetwas anders war als sonst. Es war alles okay. Total in Ordnung. Warum konnte es nicht einfach so bleiben, verdammte Scheiße?«
Christines Stimme ist hoch und schrill, und ihr Gesicht ist unnatürlich rot.
»Möchten Sie etwas trinken?«, fragt der Psychiater beruhigend.
»Ja. Ein Wasser.«
Dr. Corsini steht auf, holt eine Flasche Wasser aus dem Kühlschrank des Besuchsraumes und schenkt ihr ein.
»Danke.« Sie trinkt hastig, dann redet sie weiter.
»Ich hatte an diesem Mittwoch sechs Stunden Unterricht und bin mittags gleich nach der Schule nach Hamburg gefahren. Karl und ich waren zum Abendessen eingeladen, ich wollte bei der Gelegenheit in der Stadt noch ein paar Einkäufe erledigen und zum Frisör gehen.
Meine Mutter hatte versprochen, die Zwillinge von der Schule abzuholen und ihnen Mittagessen zu kochen. Es war alles geregelt, auf meine Mutter konnte ich mich hundertprozentig verlassen.
Aber trotzdem. Es hört sich merkwürdig an, und vielleicht glauben Sie mir das jetzt nicht, aber als ich so gegen fünf Uhr beim Frisör saß, hatte ich plötzlich ein ganz blödes Gefühl. So eine diffuse Ahnung, dass irgendetwas nicht stimmte.
Kennen Sie das? Da kommt einem ein Gedanke in den Kopf, und dann durchzuckt es den ganzen Körper. Es ist kein schlimmer, aber ein unangenehmer Schmerz. Ein Angststich.
Und diese Stiche hatte ich. Mehrmals hintereinander, aber ich wusste nicht, warum.
Ich ließ meine Haare färben und hatte das Mittel noch auf dem Kopf, darum konnte ich nicht sofort telefonieren. Erst als ich fertig war, hab ich zu Hause angerufen. Meine Mutter ging auch sofort ran und sagte, dass alles okay sei. Die Zwillinge seien drüben bei Irmgard und spielten mit Fiete.
Gott sei Dank sind sie zu zweit, dachte ich, einer passt auf den anderen auf. Niemals passiert zwei Kindern gleichzeitig etwas.
Ich hab mich daraufhin ein bisschen entspannt. Schließlich war nichts ungewöhnlich oder beunruhigend. Die Zwillinge waren gesund und spielten mit Fiete. Was sollte schon sein?
Nach dem Frisör zog ich los, um für die beiden noch eine Winzigkeit zu kaufen. ›Hast du uns was mitgebracht?‹ war nämlich immer die erste Frage, wenn Karl und ich mal einen Tag nicht zu Hause gewesen waren.
Und wenn es irgendwie möglich war, hatte ich auch wirklich immer eine Kleinigkeit dabei.
Ich hab ihnen zwei Überraschungseier gekauft. Die liebten sie über alles. Sie hatten schon eine ganze Sammlung von kleinen Schlumpffiguren und tauschten untereinander. Das war das Einzige, bei dem jeder seinen eigenen Besitz heftig verteidigte. Alles andere teilten sie ja miteinander, es gehörte immer beiden zugleich.
Aber diese beiden Überraschungseier haben sie nie bekommen.«
Christine weint. Dr. Corsini wartet geduldig. Erst nach ein paar Minuten kann sie weitersprechen.
»Der Dekan von Karls Fachbereich hatte uns an dem Abend eingeladen. Aber ich habe vergessen, wie er hieß. Der Name fing irgendwie mit ›K‹ an und hörte mit ›i‹ auf. Ich komm einfach nicht mehr drauf. Ist ja auch unwichtig, glaub ich.
Jedenfalls waren wir um sieben Uhr da, die Frau des Dekans begrüßte uns richtig herzlich, dann gab es einen Aperitif, und wir redeten über dies und das. Worüber, weiß ich nicht mehr.
Der Dekan war ein freundlicher Mann kurz vor der Pensionierung, der einfach nur beklatscht werden wollte. Darum lud er sich Gäste ein, und seine arme Frau musste stundenlang kochen. Jedenfalls belohnte er die, die bei dieser simplen Inszenierung mitspielten, manchmal mit Pöstchen und Einfluss. Er war der Garant für eine Karriere an der Uni, und Karl spielte mit, weil er der Meinung war, dass es ein Leichtes war, solch einen Abend durchzustehen, und der Aufwand in keinem Verhältnis zum Nutzen stand, und da hatte er recht. Ich sah es völlig ein, auch wenn der Gedanke an eine Gegeneinladung von der ersten Minute an wie ein Schreckgespenst über mir schwebte.
Aber es kam ganz anders.
Die Frau des Dekans hatte gerade die Vorspeise serviert, als das Telefon klingelte. Sie entschuldigte sich und nahm das Gespräch im Flur an.
Sekunden später kam sie zurück und sagte zu mir:
›Für Sie.‹
Ich brach innerlich zusammen. Das konnte nichts Gutes bedeuten.
Meine Mutter war am Apparat. Sie konnte kaum sprechen, so hat sie geweint.
›Reiß dich zusammen und sag mir endlich, was passiert ist!‹, hab ich sie angeschrien, und es war mir egal, ob es alle hören konnten.
Meine Mutter schniefte, putzte sich die Nase, und dann hat sie stockend gesagt, dass die Kinder zu Fiete gegangen waren, zum Spielen. Um sieben sollten sie zu Hause sein. Wie immer. Wie abgemacht. Aber sie sind nicht gekommen. Um halb acht hatte sie dann bei Irmgard angerufen und gefragt, wo die Kinder bleiben, und Irmgard sagte, sie wären nur ganz kurz da gewesen. Fiete durfte nämlich nicht spielen, der hatte Stubenarrest, weil er Spülmittel in den Graben gespritzt hatte, und dabei waren drei Enten ertrunken.
Meine Mutter war dann durchs ganze Dorf gerannt, hatte die Kinder gesucht und jeden gefragt. Aber niemand hatte sie gesehen.
Jedenfalls stand Raffael dann endlich, um zehn vor acht, vor der Tür. Aber allein. Ohne Svenja. Und er sagte nicht, wo sie ist. Er sagte überhaupt nichts. Keinen Ton.
›Bleib, wo du bist, Mama!‹, hab ich ins Telefon gebrüllt. ›Pass auf Raffael auf, wir kommen. In anderthalb Stunden sind wir zu Hause.‹
Die Vorspeise hatte noch niemand angerührt, weil alle höflichkeitshalber auf mich gewartet hatten. Wir haben uns sofort hastig verabschiedet, sind in mein Auto gesprungen und rasten über die Autobahn.
Während der Fahrt haben wir kaum etwas gesagt. Weil wir dasselbe gedacht haben: Es musste etwas passiert sein, denn ein Zwilling allein – das gab es einfach nicht. Raffael und Svenja existierten nur im Doppelpack. Sie waren eins.
Es war bereits dunkel und die Autobahn Richtung Norden fast leer.
Beim Fahren hat Karl unentwegt seine Nasenwurzel gerieben, und ich wusste, dass er sich dadurch zu beruhigen versuchte und sich zwang, konzentriert nachzudenken. Er suchte nach Erklärungen, nach Ideen, wo sie sein könnte.
Er hatte offenbar vor, pragmatisch und auf keinen Fall emotional an das Problem heranzugehen.
Das hab ich ihm angesehen und sagte nichts, um ihn nicht aus dem Konzept zu bringen. Und ich liebte ihn in diesem Moment. Er gab mir Halt. Wenn ich diese Angst durchstehen konnte, dann nur mit ihm.
Als wir endlich zu Hause ankamen, stand meine Mutter verheult im Wohnzimmer am Fenster und starrte in die Nacht, als würde Svenja jeden Moment wie ein Gespenst aus der Dunkelheit auftauchen.
Sie hatte nichts Neues zu berichten. Hatte nichts gehört und nichts gesehen und vergeblich im Dorf herumtelefoniert. Noch nie hatte ich meine Mutter so hilflos und verzweifelt erlebt.
Karl goss ihr einen Cognac ein, und dann gingen wir beide hoch ins Kinderzimmer.
Raffael saß auf dem Bett. Ganz bleich und stumm. Er hat gar nicht reagiert, als wir reinkamen, hat uns nicht angesehen, war wie versteinert.
›Wo ist Svenja, Raffael?‹, hab ich ihn leise gefragt.
Raffael hat noch nicht einmal mit den Achseln gezuckt, sondern nur gegen die Wand gestarrt, und sein Blick war so tot, als hätte er die Frage nicht gehört oder nicht verstanden.
Ich hab mich neben ihn gesetzt, ihn fest an mich gedrückt und gestreichelt und ihn noch mal nach seiner Schwester gefragt.
Karl hat sich vor ihn hingekniet und seine Hände gehalten.
Aber Raffael hat sich nicht gerührt.
Dieser kleine Junge, der da mit hängenden Armen verzweifelt vor uns saß, brauchte Hilfe. So viel war uns klar. Er stand unter Schock.
Aber wir mussten wissen, wo Svenja war, um sie zu retten, falls ihr etwas zugestoßen war.
Nach ein paar Minuten haben wir Raffael in Ruhe gelassen und sind nach unten gegangen.
Karl griff nach seiner Jacke und zog seine Schuhe an. Wollte los, sie suchen. Zu mir sagte er, ich solle alles versuchen, dass Raffael redet, und die Polizei rufen. Im Hinausgehen steckte er noch die kleine Taschenlampe ein, die immer an der Garderobe baumelte.
Ich hab angefangen wie verrückt zu zittern.
Und da kam Raffael die Treppe herunter. Vielleicht, weil er seine Oma laut schluchzen hörte. Denn meine Mutter war gar nicht mehr zu beruhigen.
Ich hab mich hingesetzt und ihn auf meinen Schoß gezogen. Er war so steif wie ein Stück Holz.
›Du weißt doch ganz bestimmt, wo deine Schwester ist‹, hab ich geflüstert. ›Sie ist doch immer bei dir. Raffael, bitte! Es muss doch einen Grund dafür geben, dass du allein gekommen bist. Erzähl es mir!‹
Seine Augen blickten in die Ferne, waren ganz starr und so erschreckend trocken.
›Kann es sein, dass Svenja in Not ist? Wenn du mir nicht sagst, wo sie ist, können wir ihr doch nicht helfen!‹
Ich hab gebettelt und gefleht, aber er hat nichts gesagt. Gar nichts.
Schließlich hab ich es aufgegeben und bin mit ihm zur Couch gegangen. Er hat alles mit sich geschehen lassen, sich brav hingelegt und die Augen zugemacht.«
»Hat Ihr Mann sie gefunden?«
»Nein. Aber er ist dann zu Hauke gegangen. Der war der Hauptmann der Freiwilligen Feuerwehr. Die beiden waren seit Jahren dicke Freunde.
›Ich brauch deine Hilfe, Hauke, sofort, noch heute Nacht‹, hat Karl gesagt, und mehr musste man bei Hauke auch nicht sagen. Wenn ein Freund um Hilfe bat, dann startete Hauke durch.
Karl hat ihm das Problem geschildert, und Hauke gab Feueralarm.
Es hat keine Viertelstunde gedauert, da waren zehn Mann da. Ein Teil machte sich auf den Weg, die Gräben abzulaufen und abzuleuchten. Ein anderer untersuchte den Tetenbüll-Spieker, das ist ein seeähnliches Staubecken vor dem Hafen. Soweit das alles in der Dunkelheit überhaupt möglich war.
Aber sie suchten wenigstens. Sie taten etwas! Sie kämpften um mein kleines, zartes Kind, das immer noch irgendwo war. Irgendwo da draußen.«
Christine schweigt und schließt die Augen.
»Und dann? Was passierte dann?«
Christine blickt auf und sieht Dr. Corsini an.
»Um kurz vor oder nach elf – so genau weiß ich das nicht mehr – sind dann zwei Polizisten gekommen. Ein Mann und eine Frau. Kommissar Jens Kogler und seine Assistentin Britta Wencke. Wir haben uns zusammen mit meiner Mutter in die Küche gesetzt. Raffael war auf der Couch im Wohnzimmer eingeschlafen.
Die Polizisten holten ihre Klemmmappen heraus und begannen eine endlose Befragung. Erst nach persönlichen Daten, dann nach all den Dingen, die fast nur meine Mutter beantworten konnte. Wann hatte sie die Kinder abgeholt, was hatte sie dann gemacht, was hatten die Kinder gegessen, war ihr irgendein merkwürdiges Verhalten an ihnen aufgefallen, wann gingen sie zum Spielen und wohin, wann wollten sie zurück sein, was hatten sie an und und und …
Es war mir klar, dass das wichtig war, aber ich konnte es kaum aushalten. Diese beiden Hanseln malten da unendlich langsam in ihrer Klemmmappe Buchstaben, während meine Svenja vielleicht irgendwo weinte und auf ihre Eltern wartete. Ich hätte sie schütteln können.
Aber meine Mutter beantwortete alle Fragen, soweit sie konnte, und ich hab mich gewundert, dass sie nicht mehr hysterisch war.
Ich selbst war völlig am Ende, hab die beiden Bürokraten einfach nicht mehr ertragen.
Dann kam Karl zurück. Unverrichteter Dinge, aber mit einem enorm energischen und entschlossenen Zug um den Mund.
Die beiden packten gerade ihre Papiere zusammen und baten uns, unbedingt anzurufen, wenn irgendwas passiert. Wenn Raffael was sagt, falls sich ein möglicher Entführer meldet oder wenn Svenja wieder auftaucht. Sie wollten dann bei Tagesanbruch mit der Suche beginnen.
Eine halbe Stunde lang ist Karl im Wohnzimmer auf und ab gegangen. Immer hin und her, ohne etwas zu sagen. Ich wusste, dass er nachdachte. Sein Kopf hatte ihn noch nie im Stich gelassen.
Und je mehr er marschierte, desto wütender wurde er. Das sah ich ihm an. Seine Hilflosigkeit machte ihn rasend.
Dann ging er nach oben ins Schlafzimmer, und ich hörte, wie er immer wieder mit der Faust oder der flachen Hand gegen die Wand schlug.
Meine Mutter war vollkommen erschöpft in einem Sessel eingeschlafen, und ich hab mich wieder zu Raffael gesetzt, der wie tot auf der Couch lag, und sagte zu ihm: ›Bitte, Schatz, rede mit mir. Du bist doch mein großer, kluger Sohn und der Einzige, der mir helfen kann. Allein komm ich nicht mehr weiter.‹
Raffael war offensichtlich wach und öffnete ein klein wenig die Augen.
Ich hab einfach nur bei ihm gesessen und geweint.
Und dann hat er mir ganz zart seine kleine Hand aufs Knie gelegt.
›Weißt du, Raffael, es gibt Geheimnisse auf der Welt, die sollte man keinem Menschen verraten. Wirklich keinem‹, hab ich geflüstert. ›Aber dann gibt es Dinge, die sollte man jemandem anvertrauen, damit einem selbst oder einem anderen geholfen werden kann. Solche Dinge darf man nicht verschweigen. Verstehst du das?‹
Raffael nickte.
›Du warst doch heute mit Svenja draußen, um zu spielen. Wie schon oft, stimmt’s?‹, fragte ich vorsichtig.
Raffael nickte erneut, aber ziemlich ängstlich.
›Aber heute war irgendetwas anders. Irgendetwas ist geschehen. Und das ist auch der Grund, warum sie nicht zusammen mit dir nach Hause gekommen ist. Stimmt’s?‹
Raffael nickte wieder.
›Okay‹, sagte ich ruhig und nahm seine kleine Hand in meine. ›Ich werde dich jetzt nicht fragen, was geschehen ist. Ich lasse dich damit vollkommen in Ruhe – aber im Gegenzug sagst du mir, wo Svenja ist. Ich muss es unbedingt wissen, verstehst du? Ich muss sehen, ob ich Svenja helfen kann. Und das ist ein Geheimnis, das du lüften musst. Bitte, sag mir, wo sie ist.‹
Aber Raffael schwieg nach wie vor, und ich war kurz davor zu verzweifeln.
Ich hab ihn dann gefragt, ob sie in der Kirche gespielt haben. Oben, auf der Empore. Das war zwar verboten, aber sie machten es trotzdem ab und zu, weil sie es toll fanden und weil es dort so schön hallte.
Aber Raffael schüttelte den Kopf.
Er hatte wenigstens reagiert! Das war ja schon mal ein Anfang, dachte ich.
Und dann fragte ich ihn ab. Alles, was mir einfiel.
›Wart ihr im kleinen Wäldchen hinterm Pastorat? Oder auf dem Deich? Oder sogar am Wasser? Seid ihr über die große Straße gelaufen?‹
Raffael schüttelte jedes Mal den Kopf.
Ich weiß heute nicht mehr genau, was ich noch alles fragte, mir fiel eine ganze Menge ein, und irgendwann fragte ich ihn auch nach Bauer Harmsens Scheune, weil sie da schon öfter gespielt hatten.
Und in dem Moment wurde Raffael kalkweiß, er riss den Mund weit auf, und das blanke Entsetzen stand in seinem Gesicht.
Ich hab ihm dann beruhigend übers Haar gestrichen und gesagt, dass alles gut sei und dass ich gleich wiederkommen würde, bin aus dem Zimmer gestürzt und wie verrückt die Treppe hochgerannt ins Schlafzimmer.
›Karl, sie ist in Harmsens Scheune!‹, hab ich geschrien. Vielleicht hab ich auch nicht geschrien, sondern geheult, ich weiß es nicht mehr, jedenfalls war Karl sofort alarmiert. Er sprang auf und sagte: ›Ich fahr hin, bleib hier bei Raffael!‹, und dann hat er nur noch seine Jacke und die Taschenlampe gepackt und ist aus dem Haus gerannt.
Ich hab überlegt, ob Raffael Svenja allein zurückgelassen hätte, wenn sie noch lebte. Wahrscheinlich nicht. Aber selbst wenn er es getan hätte, wäre er so schnell wie möglich nach Hause gerannt, um Hilfe zu holen. Und hätte sicher nicht geschwiegen.
Wenn ich ehrlich bin, hatte ich nicht mehr viel Hoffnung. Eigentlich gar keine.
Es war Viertel nach zwölf, als Karl endlich anrief. Handys gab es damals noch nicht. Er hatte Bauer Harmsen aus dem Bett geklingelt und telefonierte von dort.
Er sagte mir, dass er sie gefunden hätte.
An seinem Tonfall hab ich sofort gehört, dass alles verloren war, aber ich hab dennoch ›Ich komme!‹ ins Telefon gebrüllt.
Und dann sagte er leise: ›Du kannst ihr nicht mehr helfen, Christine. Niemand kann ihr mehr helfen. Ich rufe jetzt die Polizei.‹
In diesem Moment hörte die Welt auf, sich zu drehen. Alles, was ich einmal geliebt hatte, war belanglos geworden, war wie verschüttet unter einem grau-schwarzen Brei. Ich hatte nur noch einen Wunsch: sie zu sehen.
›Ich komme!‹, hab ich noch einmal geschrien.
›Bitte, lass es‹, flehte er mich geradezu an. ›Es ist nicht gut, wenn du sie so siehst.‹
Ich hab ja gewusst, dass alles vorbei und alles zu spät war. Sie war nicht mehr zu retten. Er brauchte das nicht noch mal zu wiederholen. Und es lag an meiner Verzweiflung, dass ich anfing, Karl anzubrüllen:
›Was weißt du, was gut für mich ist! Ich muss sie sehen, unbedingt! Sie ist mein kleines Mädchen …‹
Die aufsteigenden Tränen schnürten mir die Kehle zu. Ich legte auf und sagte zu meiner Mutter, die im Sessel aufgewacht war: ›Sie ist tot, Mama!‹
Bevor meine Mutter reagieren konnte, bin ich aus dem Haus gerannt, in meinen Wagen gesprungen und Richtung Scheune gerast. Um diese Zeit war im Ort niemand mehr unterwegs.
Ich bin mit achtzig über das Kopfsteinpflaster der alten Dorfstraße gedonnert und dann um die Kurve in einen Wirtschaftsweg geschliddert, der am Ende des Dorfes begann.
Auf dem schmalen Weg fuhr ich hundertzwanzig und nur Minuten später erreichte ich die Scheune.
Karl stand vor der Tür.
Natürlich kannte ich die Scheune, hatte sie aber immer nur am Rande wahrgenommen, weil sie nicht wichtig war. Bauer Harmsen stellte darin manchmal seine Schafe unter. Er hatte nur eine kleine Herde und war im Gegensatz zu vielen anderen Schäfern der Ansicht, dass es nicht gut für die Tiere sei, wenn sie nass wurden. Bauer Harmsen war auch einer, der nachts bei seinen Schafen blieb, wenn die Geburt der Lämmer unmittelbar bevorstand. Viele im Dorf belächelten ihn wegen seiner übertriebenen Tierliebe, aber ich mochte ihn gerade deswegen.
Karl sagte kein Wort und drückte die hölzerne Tür auf, die nur angelehnt war. Der Kegel seiner Taschenlampe tanzte durch den riesigen Scheunenraum, so zitterte seine Hand.
Ich war nicht annähernd darauf vorbereitet, was ich dann sah.
Es war das Schlimmste, was ein Mensch überhaupt ertragen kann.
Sie hing am offenen Heuboden. Mit einem langen Seil um den Hals.
Meine Schöne hatte gespenstisch weit aufgerissene Augen, die das Entsetzen über den eigenen Tod nicht fassen konnten, und eine heraushängende, aufgequollene Zunge.
Ich wollte sie unbedingt in den Arm nehmen. Sie würde aufwachen, wieder anfangen zu atmen, sich erholen, wieder normal aussehen, wieder zu uns zurückkehren. Wir würden sie nach Hause tragen, ins Bett legen, den Arzt rufen, und in ein paar Tagen wäre alles wieder gut.
Aber ich konnte mich nicht rühren und starrte auf meine Tochter, deren Körper der leise Zugwind in der Scheune leicht hin und her baumeln ließ.
Und in dem Moment hab ich mich gefragt, warum ich nicht einfach sterben konnte. Hier, jetzt, in dieser Sekunde. Nur ein wenig später als sie.
Schließlich sagte Karl, dass wir nichts anfassen dürften und sie da nicht runterholen könnten, weil wir mögliche Spuren verwischen würden. Die Polizei würde gleich kommen.
›Svenja ist jetzt im Himmel‹, flüsterte ich, ›aber sie kommt zu mir zurück, und dann bleibt sie für immer.‹
Wie lange wir gewartet haben, weiß ich nicht mehr. Vielleicht eine halbe Stunde oder auch nur ein paar Minuten. In der Zeit sagte ich ihr ganz still und ganz für mich Adieu. Bis heute habe ich nicht damit aufgehört.
An keinem einzigen Tag.
Und niemals werde ich im Kopf das Bild meiner kleinen tapferen Svenja löschen können, die der Welt die Zunge herausstreckte, die sie im Stich gelassen und am Leben gehindert hatte.«
Dr. Corsini schenkt Christine Wasser nach, aber sie registriert es gar nicht und redet weiter.
»Als die Polizei eintraf, bin ich nach Hause gefahren, hab eine halbe Flasche Wein in einem Zug ausgetrunken und mich dann zusammen mit Raffael ins Bett gelegt.
Dass ich den Arm um ihn legte und ihn streichelte, hat er wahrscheinlich gar nicht gemerkt.
Ich hab mir Svenjas Schlafanzug vors Gesicht gedrückt, ihren sanften, süßlichen Geruch eingeatmet und mir das Hirn zermartert, was in der Scheune wohl geschehen war. Wie es bloß dazu kommen konnte.
Und irgendwie hab ich gespürt, dass sie noch da, noch in meiner Nähe war.
Um drei Uhr früh ist dann Karl mit den Polizisten nach Hause gekommen. Er sah aus, als wäre er in dieser Nacht zwanzig Jahre gealtert.
Ich bin aufgestanden und hab Kaffee gekocht.
›Wie ist es passiert?‹, fragte ich schwach.
Kommissar Kogler zuckte die Achseln und meinte, es wäre wohl ein Unfall gewesen. Jedenfalls glaubte dies der Gerichtsmediziner nach der ersten Untersuchung. Die Zwillinge haben auf dem Heuboden gespielt, und Svenja ist durch die morsche Bodenklappe gestürzt.
Aber ich konnte nicht begreifen, warum sie ein Seil um den Hals hatte.
›Was spielt man mit einem Seil um den Hals?‹, überlegte Kogler. ›Ich bin da nicht mehr so auf dem Laufenden, meine Kinder sind schon lange groß. Spielt man da Hund? Oder Tarzan? Oder sogar Hinrichtung? Ohne daran zu denken, dass auch in einem Spiel wirklich etwas passieren kann? Ich weiß es nicht.‹
Hund, dachte ich. Ja, wahrscheinlich haben sie Hund gespielt. Sie hatten sich sehnlichst einen gewünscht, aber wir wollten keinen, weil wir uns nicht die Möglichkeit verbauen wollten, mit den Kindern auch mal lange Fernreisen zu unternehmen.
So blieb ihnen nichts anderes übrig. Sie mussten Hund spielen.
Unser eigenes Vergnügen war uns wichtiger gewesen als die Sehnsucht unserer Kinder nach einem Hund.
Ich wusste, dass ich nie mehr Ruhe finden würde.«
»Und ist das so?«
»Ja, das ist so.«
»Sie haben nie mehr Ruhe gefunden?«
»Nein. Ich bin ruhiger geworden. Das vielleicht. Aber mein innerer Friede ist für immer fort.«
Dr. Corsini nickt. »Bitte, erzählen Sie weiter.«
Christine rauft sich die Haare. »Als die Leiche freigegeben war, haben wir hin und her überlegt, ob wir Raffael mit zur Beerdigung nehmen oder ihn lieber zu Hause lassen sollten. Und schließlich hab ich ihn ganz direkt gefragt, ob er weiß, dass seine Schwester morgen begraben wird.
Raffael hat nicht geantwortet, sondern mich nur mit großen, entsetzten Augen angesehen.
Ich hab ihn dann gefragt, ob er weiß, was da auf dem Friedhof passiert, und Raffael hat den Kopf geschüttelt.
Also hab ich ihn auf den Schoß genommen und versucht, ihm die Sache zu erklären, obwohl ich ja selbst noch nichts, wirklich gar nichts begriffen hatte.
Ich hab ihm gesagt, dass Svenja jetzt in einem Sarg liegt. In einer großen, schönen Kiste aus Holz. Aber das ist nicht die Svenja, die er kennt, die darin liegt, das ist nur ihr Körper, ihre Hülle. Ihre Seele ist längst davongeflogen, und wahrscheinlich wird sie ewig weiterleben. So genau wissen wir das ja alle nicht. Aber ich bin sicher, dass sie immer bei ihm ist. Vielleicht sogar gerade jetzt, hier in diesem Zimmer.
Raffael sah sich augenblicklich um.
›Du kannst sie nicht sehen, Raffael, nur spüren‹, sagte ich. ›Du kannst vielleicht fühlen, dass sie bei dir ist und dich beschützt. Und wenn du mit ihr sprichst, wird sie dir eine Antwort geben. Aber die hörst du nicht, du bekommst sie nur durch deine Gedanken. Verstehst du das?‹
Raffael nickte.
Es war furchtbar schwer, weil ich auf keinen Fall etwas Falsches sagen wollte.
Und dann erklärte ich ihm, dass alle Menschen sterben müssen, aber niemand weiß, wann. Die meisten sterben erst, wenn sie sehr alt sind. Und dann geht es allen Menschen so wie jetzt Svenja. Sie sind unsterblich.
Raffael war ganz ernst. Ich war mir sicher, dass er alles verstanden hatte, und hoffte, dass er dadurch ein klein wenig getröstet war.
›Möchtest du morgen mitkommen auf den Friedhof, wenn Svenjas Hülle in einem Sarg in der Erde vergraben wird?‹, hab ich ihn schließlich gefragt, und Raffael nickte.
Er wollte auf keinen Fall bei Oma oder bei Fiete bleiben.
Als ich aufstand, wollte ich wissen, ob er noch irgendeinen Wunsch hatte.
›Ich möchte tot sein‹, antwortete Raffael.
Das war der einzige Satz, den er nach Svenjas Tod sagte.
Als es so weit war, stand er zwischen uns am Grab. Unbeweglich und stumm.
Und vergoss keine Träne.
Aber als der Sarg in die Erde gelassen wurde, stieß er einen fürchterlichen Schrei aus. Es war ein Ton, der Gläser und Scheiben platzen lässt. Wie der Schrei eines Tieres, dem das Fell bei lebendigem Leib über den Kopf gezogen wird.
Noch heute wache ich nachts auf.
Von diesem einen grauenhaften, gellenden Schrei.«
»Und was war später? Ich meine, wie hat Raffael das alles verarbeitet?«
»Gar nicht. Er zog sich in sich zurück, kam nicht mehr zum Vorschein, und wir kamen nie mehr an ihn heran.
Wir hatten beide Kinder verloren.«
LILO
2
Berlin, Mai 2011
Ganz allmählich kam er zu sich, und erst nach einer Weile wurde ihm klar, dass er zu Hause in seinem Bett lag, dass der Erker dort war, wo er immer war, dass der Spiegel dort hing, wo er immer hing, und das fahle Licht des Vormittags ins Zimmer schien.
Er schloss die Augen, um sich noch einmal kurz seinen Träumen hinzugeben. Doch er schaffte es nicht, sich zu entspannen.
Irgendetwas war anders als sonst.
Irritiert fuhr er mit der Hand über seinen Körper. Und fasste in etwas Feuchtes, Klebriges.
Du lieber Himmel! Er hatte seine Sachen noch an. Das war völlig ungewohnt, denn normalerweise schlief er nackt.
Jetzt öffnete er erneut die Augen und hob den Oberkörper ein wenig an. Was er sah, brachte ihn fast um den Verstand: Vollständig angekleidet lag er in seinem Bett, und T-Shirt, Jacke und Jeans waren voller Blut. Tief durchtränkt und an manchen Stellen bereits getrocknet, hart und steif.
Fassungslos fuhr er sich mit den Händen durch die Haare und merkte zu spät, dass auch seine Hände blutverkrustet waren.
Der Ekel machte ihn fast bewegungsunfähig.
Er rührte sich nicht. Das Entsetzen saß ihm direkt in der Kehle und schnürte ihm den Atem ab. Er konnte es nicht glauben.
Schließlich riss er das T-Shirt hoch. Sein Bauch war unversehrt.
Er tastete sich hektisch ab. Hals, Brust, Bauch, Arme, fuhr mit der Hand in die Hose, bis zum Schritt – nirgends eine Wunde oder ein Schmerz.
Verdammt noch mal, woher kam das Blut?
Er blinzelte zur Uhr. Die digitalen Ziffern des Radioweckers zeigten zehn Uhr dreiundzwanzig.
Mühsam stand er auf. In seinem Kopf explodierten Stiche wie ein Feuerwerk, aber er ignorierte sie und taperte langsam und vorsichtig zum Spiegel.
Jetzt erst wurde ihm das Ausmaß des Desasters richtig klar: Er sah aus, als ob er ein Schwein geschlachtet hätte.
Ihm brach der kalte Schweiß aus.
Bleib ruhig, dachte er, ganz ruhig. Es gibt für alles eine Erklärung, du kommst bloß nicht drauf. Und mit diesem schmerzenden Kopf und der Übelkeit, die sich in ihm auszubreiten begann, schon gar nicht.
Er starrte auf sein Spiegelbild, verstand überhaupt nichts mehr und bekam das nackte Grausen. Auf dem Tisch lagen Zigaretten. Mit zitternden Fingern nestelte er eine aus der Packung, zündete sie an und rauchte mit schnell aufeinanderfolgenden, tiefen Zügen.
Mein Blut ist es nicht, mein Blut ist es nicht, hämmerte sein Gehirn in einer Endlosschleife. Ich blute nicht, ich bin nicht verletzt, ich bin okay. Ich bin okay. Ich bin okay.
Aber von wem ist das Blut dann? Was war passiert?
Stumm stellte er sich wieder vor den Spiegel und stierte auf seine besudelten Sachen, als könnte er ihnen die Wahrheit entlocken oder die Spur einer Ahnung auslösen.
Doch er hatte keinerlei Erinnerung an den gestrigen Abend.
Nicht die geringste.
Er ließ die Zigarette in eine halb volle Bierflasche fallen. Es zischte leise.
War heute Donnerstag oder Freitag? Verflucht, noch nicht einmal das wusste er. Er torkelte, zog den Reißverschluss seiner Jeans auf und stieg so vorsichtig aus der Hose, als täte jede Berührung mit dem Stoff fürchterlich weh.
Das Blut war durch die Jeans bis auf seine Haut durchgedrungen, und seine Oberschenkel hatten rötlich braune Flecken. Er glaubte, sich übergeben zu müssen, so widerlich fand er das.
Er warf die Jacke auf den Boden und versuchte das T-Shirt auszuziehen. Dabei weitete er den Halsausschnitt, bis das Hemd zerriss und er es über den Kopf ziehen konnte, ohne mit dem Blut in Berührung zu kommen.
Er sah sich um. Über sein Bettlaken zogen sich einige bräunliche Streifen von getrocknetem Blut. Er riss das Laken von der Matratze und warf es auf den blutigen Haufen.
Er konnte es einfach nicht begreifen.
Woher kam das Blut?
Und was war denn heute für ein Tag?
Auf dem Schreibtisch lag sein Kalender. Hektisch blätterte er darin herum, aber das half ihm nicht weiter, weil er nichts eingetragen hatte.
Sein Handy. Es müsste in der Jacke sein, und da stand auf dem Display das Datum.
Also musste er wieder die Jacke berühren. Er würgte, als er vorsichtig die innere Brusttasche befühlte. Das Handy war nicht da. Dann vielleicht vorn rechts außen. Oh Gott, das Blut war sogar in die Jackentasche gesickert. Er schluckte mehrmals, fuhr vorsichtig mit der Hand hinein.
Die Tasche war leer.
Er überlegte. Merkwürdig, rechts in der Jackentasche hatte er doch immer das Messer. Sein Messer! Verdammte Scheiße, wo war sein Messer?
Es war nicht irgendein Messer. Nicht er hatte sich das Messer ausgesucht, sondern das Messer ihn. Darum war es ihm so wichtig, und darum hatte er sich auch immer sicher gefühlt, wenn es in der Jackentasche schwer in seiner Hand lag.
Die Szene stand ihm vor Augen, als wäre es gestern gewesen. Berlin, U-Bahnhof Kaiserdamm, nachts um kurz nach eins. Vor fast zwei Jahren.
Er hatte auf einer Bank gesessen, auf die U-Bahn gewartet, und war dabei eingeschlafen. Eine Viertelstunde oder eine halbe war vergangen, als er durch laute Stimmen geweckt wurde. Zwei Typen attackierten einen Mann, der wesentlich älter war als sie. Ungefähr Mitte dreißig, schmächtig und unauffällig gekleidet. Völlig unvorstellbar, dass diese graue Maus die beiden, die sicher nicht älter als achtzehn oder zwanzig waren, provoziert hatte.
Sie schubsten ihn immer näher an die Gleise heran. Der Mann schrie und flehte, ihn in Ruhe zu lassen.
Wie gelähmt saß er da, und ihm wurde heiß, denn er wagte nicht einzugreifen. Aber genauso wenig konnte er in dieser Situation davonrennen. Ein Handy, um die Polizei zu rufen, hatte er – wie so oft – nicht dabei und schämte sich unsagbar, weil er nichts tun konnte.
Dann hörte er Schritte auf der Treppe. Das Geräusch klackernder, hastiger Absätze auf den Stufen. Irgendjemand rannte, aber er wusste nicht, ob dieser jemand floh oder auf den Bahnsteig kam.
Vielleicht hatten ja auch schon andere die Szene beobachtet.
Er fühlte sich wie auf dem Präsentierteller, aber die Typen beachteten ihn gar nicht. Wenn er sich jetzt entfernte, würden sie ihn bemerken, da war er sich sicher, also versuchte er weiterhin, still und unsichtbar zu bleiben.
Die Typen boxten dem Mann ins Gesicht, in den Magen und in die Nieren und hielten ihn gleichzeitig am Mantel fest, sodass er nicht zusammenbrechen konnte. Das Blut lief ihm aus der Nase, und man sah, dass er sich aus eigener Kraft nicht mehr auf den Beinen halten konnte.
Der Mann war fertig, aber das interessierte die beiden Typen nicht.
Einer zog ein Messer aus der Tasche und ließ es aus der Scheide schnellen. Für den Bruchteil einer Sekunde blitzte die Klinge im kalten Licht der Neonbeleuchtung auf, dann stach der Typ dem Mann das Messer in den Bauch.
Dies alles war blitzschnell und völlig geräuschlos passiert.
Der Mann fiel einem der beiden Typen in die Arme und hing dort wie ein schlaffer Sack, als ein Martinshorn zu hören war und immer näher kam. Offensichtlich hatte doch jemand die Polizei alarmiert.
Der Angreifer zog das Messer aus dem Bauch des Mannes, ließ ihn fallen und kickte das Messer über den Bahnsteig. Es schlidderte weit.
Dann flüchteten die beiden Typen.
Das Messer lag nur einen halben Meter von ihm entfernt.
Ohne zu überlegen, was er tat, stellte er seine Tasche darauf und sah sich um. Niemand war in der Nähe, und der Mann regte sich nicht.
Er ging zu dem Verletzten, fühlte ihm den Puls, redete ihm Mut zu und kam sich dabei ungeheuer schäbig vor, weil er glaubte zu lügen. Immerhin war es möglich, dass der Mann jetzt, in diesem Moment, oder in wenigen Minuten starb.
Sekunden später stürmten Polizisten den Bahnsteig, und augenblicklich brach Chaos aus. Schaulustige standen herum, der Notarzt kam und transportierte den lebensgefährlich Verletzten ab.
Er wurde als Zeuge befragt, und als er seine Aussage gemacht hatte, ließ er unbemerkt das Messer in seiner Tasche verschwinden und ging nach Hause.
Vom Kaiserdamm musste er eine Dreiviertelstunde bis zu seiner Wohnung laufen, aber das war egal. Er besaß ein Messer. Ein Springmesser, das vor einer Stunde noch in einem menschlichen Körper gesteckt hatte.
Und dieses Messer war nun weg.
Ihm wurde immer übler, und das Zittern wurde stärker.
In der linken Jackentasche fand er das Handy. Er klappte es auf. Der Akku war fast leer, aber er konnte sehen, dass heute Samstag war, kurz nach halb elf.
Ach ja. Gestern war Premiere gewesen. Romeo und Julia, richtig, und danach Premierenfeier in der Kantine. Zumindest das fiel ihm wieder ein.
Erinnern konnte er sich noch an die ersten beiden großen Bier, die er hastig hinuntergeschüttet hatte. Während der Vorstellung hatte er auch schon Bier getrunken, aber dennoch ständig das Gefühl gehabt zu verdursten.
Und dann? Wie lange hatten sie in der Kantine gesessen? Und war er mit den Kollegen noch weiter um die Häuser gezogen?
Nichts. Da kam kein Bild mehr, keine Idee, keine Ahnung, was passiert sein könnte. Er hatte einen totalen Filmriss.
Und wieder sah er vor sich seine Sachen und dieses verdammte Blut.
Duschen, dachte er, ich muss duschen. Sonst fange ich noch an zu kotzen.
Vorsichtig machte er einen Spaltbreit die Tür auf. Der Flur war leer. Es war auch vollkommen still in der Wohnung. Vielleicht war Lilo gar nicht zu Hause?
Sie darf mich nicht sehen, dachte er, auf gar keinen Fall darf ich ihr begegnen.
Noch einmal sah er sich um, dann schloss er seine Zimmertür ab, nahm den Schlüssel in die Hand und huschte ins Bad.
Die heiße Dusche war wie eine Erlösung.
Das warme Wasser lief an seinem Körper hinab und verschwand als blutig-blassrosa Rinnsal im Abfluss.
3
Raffael hatte schon immer unter der Dusche besonders gut nachdenken können. Manchmal dachte er an überhaupt nichts, während er den warmen Duschstrahl genoss, aber heute überschlugen sich seine Gedanken.
Er musste seine Klamotten loswerden. Sofort. Noch heute Vormittag. Innerhalb der nächsten Stunde. Bevor er in die Küche oder ins Theater ging. Die Gefahr, dass Lilo in sein Zimmer kam, weil sie irgendetwas von ihm wollte, war einfach zu groß.
Das Beste war, die Sachen schleunigst wegzuwerfen. Sie in irgendeinem Neuköllner Hinterhof in eine Mülltonne zu stopfen. Dort, wo Messerstechereien an der Tagesordnung waren und sich niemand über eine blutige Jeans wunderte.
Aber davor fürchtete er sich. So ein Hinterhof hatte tausend Augen, und es gab immer ein paar alte Frauen, die den ganzen Tag auf den Betonhof starrten und darauf warteten, dass irgendjemand kam oder ging, weil dies ein klein wenig Abwechslung in ihre alltägliche Tristesse brachte. Die mit Argusaugen beobachteten, wer was in die Tonne warf, und darüber wachten, dass um Gottes willen kein Joghurtbecher in den Normalmüll wanderte. Und die vor allem ihre Mitbewohner kannten. Sofort würde auffallen, dass er gar nicht im Haus wohnte.
Und wenn er nachts hinging, machte er sich erst recht verdächtig. Er sah es förmlich vor sich, wie in fünf Fenstern das Licht anging, weil nachts der Mülltonnendeckel klappte. Am nächsten Morgen um sechs würde die erste alte Tante die Mülltonne inspizieren, um zu sehen, was der Fremde da mitten in der Nacht entsorgt hatte. Und es wäre ein besonderes Highlight in ihrem Leben, die Polizei rufen zu können.
So ging das alles gar nicht.
Vielleicht war es besser, die Sachen vorher in die Waschmaschine zu stecken. Dann waren die Blutspuren nicht mehr auf den ersten Blick erkennbar und das ganze Paket weniger verdächtig.
Allerdings – wie sollte er denn seine Lederjacke, die vollkommen eingesaut war, in der Waschmaschine waschen? Das funktionierte überhaupt nicht. Aber auch wenn es ihm völlig egal war, ob die Lederjacke nach dem Waschgang einem Fünfjährigen passte – über die Waschmaschine hier in der Wohnung führte Lilo das Regiment.
Im Badezimmer stand ein großer Korb für die Schmutzwäsche. Lilo sortierte die Wäsche – ihre und Raffaels – und ließ fast jeden Tag ein Programm durchlaufen. Die saubere Wäsche bügelte sie, und Raffael bekam seine Sachen ordentlich zusammengelegt nur wenig später zurück. Lilo behauptete immer, leidenschaftlich gern und am liebsten beim Fernsehen zu bügeln, und dann sagte sie lächelnd: »Es macht mir wirklich nichts aus, Raffael. Ich hab doch sonst nichts zu tun.«
Raffael hatte dies immer als äußerst angenehm empfunden. Lilos Wäscheengagement machte sein Junggesellendasein wesentlich einfacher und erträglicher, zumal er auch nicht genau wusste, wie die Waschmaschine funktionierte, und die Systematik der Wäschesortiererei nie begriffen hatte. Helle Sachen sechzig Grad. T-Shirts und bunte Sachen vierzig. Okay. Aber was machte man mit hellen T-Shirts? Er besaß vielleicht fünf oder sechs davon. Sollte er sich vielleicht noch zwanzig kaufen und dann Wochen warten, um irgendwann eine Waschmaschine füllen zu können?
Die Entscheidung, was wie gewaschen wurde, fand er zum Verzweifeln, und er war glücklich, dass sich Lilo darum kümmerte.
Dafür schleppte er ihr die schweren Einkaufstaschen nach Hause.
Also konnte er die Kleidungsstücke auf keinen Fall hier in seiner Wohnung waschen, und in den Waschsalon traute er sich auch nicht. Da war immer jemand, der einen beim Füllen der Maschine beobachtete.
Er musste eine andere Lösung finden.
Die Müllkippe war vielleicht eine Möglichkeit. Aber er hatte kein eigenes Auto, und wen sollte er bitten, ihn dahin zu fahren? Und welches Märchen sollte er erzählen, warum er gerade dort etwas entsorgen wollte?
Das war alles Blödsinn. Er drehte die Dusche aus und trocknete sich ab. Danach putzte er sich die Zähne und säuberte akribisch seine Fingernägel. Sein Kopf schmerzte immer noch.
Er öffnete das Schränkchen neben der Tür, ließ zwei Aspirin in ein Glas fallen, löste sie in Wasser auf und trank hastig. Er brauchte dringend einen klaren Kopf.
Was habe ich getan?, hämmerten seine Gedanken. Welchen Weg bin ich nach Hause gegangen? Hab ich ein Taxi genommen? Hab ich vielleicht sogar den Taxifahrer umgebracht?
Oh, mein Gott!
Er war sich selbst unheimlich.
Genauso vorsichtig, wie er ins Bad geschlichen war, schlich er auch wieder hinaus. Lilo war nirgends zu sehen.
Gott sei Dank.
In seinem Zimmer ließ er sich in seinen Sessel fallen und starrte an die gegenüberliegende Wand.
Das Tapetenmuster – rosafarbene, ineinander verschlungene Buschwindröschen vor hellbeigem Hintergrund – verschwamm vor seinen Augen. Seine mühsam erkämpfte Sicherheit war ins Wanken geraten, er war dabei, den Halt unter den Füßen zu verlieren, und ahnte dunkel, dass er selbst daran schuld war.
Er schaltete das Radio an. Die leise Plätschermusik im Hintergrund beruhigte ihn.
Sein Handy klingelte. Auf dem Display sah er, dass es Frank war.
»Leck mich am Arsch«, murmelte er und drückte das Gespräch weg. Insgesamt dreimal.
Dann ging er ran.
»Ja?«, knurrte er.
»Na, schon wach? Geht’s dir einigermaßen?« Frank war der Bühnenmeister und hatte um diese Uhrzeit eine erschreckend laute und wache Stimme, was Raffael sofort auf die Nerven ging.
»Bestens«, knurrte er. »Wieso?«
»Weil ich nicht dachte, dass du heute Vormittag aus dem Bett kommst, und weil du offensichtlich auch zwei Stunden brauchst, um ans Telefon zu gehen.«
»Ach ja?«
»Ja. Gestern bist du im Bier regelrecht ertrunken. Joachim und Bruno übrigens auch.«
»Und deswegen rufst du an?«
»Nee, ich wollte dich daran erinnern, dass du heute um fünfzehn Uhr im Theater sein musst. Umbau auf Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung. Nur, dass du das nicht verpennst mit deiner Matschbirne.«
»Ja, ja.«
»Meinst du, du bist fit heute Nachmittag?«
»Mann, lass mich in Ruhe.« Raffael knipste das Gespräch weg.
Was für ein Schwachsinn! Fast jeden Tag Umbau zu einem anderen Stück, nur damit die Abonnements grün, gelb, lila und kariert bedient werden konnten. Ein einziger Stress und eine Idiotenarbeit.
Er versuchte sich zu entspannen und schloss die Augen.
Es war nichts passiert. Alles war in Ordnung. Um zwei würde er ins Theater gehen, um acht ging der Lappen hoch, und gegen Mitternacht stand er wieder auf der Straße. Wie jeden Abend. Heute und in alle Ewigkeit, amen. Die Welt drehte sich weiter, alles war gut.
Aber woher, zum Teufel, kam das Blut?
Die Klamotten. Diese verdammten Klamotten.
Er ließ seinen Blick auf der Suche nach einem geeigneten Versteck im Zimmer umherwandern. Direkt vor dem Erkerfenster stand das dunkelgrüne, plüschige, mit gedrehten Kordeln besetzte Sofa mit den beiden passenden Sesseln, gleich neben der Tür der Biedermeiertisch mit vier Stühlen, vor dem Fenster zum Hof ein Schreibtisch, obwohl er eigentlich nur sehr selten oder gar keinen Schreibtisch brauchte; in der Ecke links neben der Tür war der wuchtige Schrank aus dunklem, fast schwarzem Holz, dessen Türen zum Gotterbarmen knarrten und die er schon deswegen nicht gern öffnete, und als Höhepunkt prangte an der Wand dem Schreibtisch gegenüber das gewaltige hohe Bett mit einem geschnitzten Rückenteil aus Eichenholz. Raffael hatte keine Ahnung, ob das Bett hundert oder zweihundert Jahre alt war, Heerscharen von Kindern waren sicher darin gezeugt worden – aber er fand es großartig. Ein Bett aus einer anderen Welt und einer anderen Zeit, das es so heute sicher nicht mehr gab.
Vor den Fenstern hingen im Laufe der Jahre gelb gewordene Fenstergardinen und davor schwere, goldgrüne Übergardinen. Inderteppiche in dunkelroten Tönen bedeckten das abgewetzte Parkett.
Dieses Zimmer konnte einen umarmen oder erdrücken – je nachdem, wie man es sah.
Er lauschte angestrengt. In der Wohnung war es still. Keine Schritte im Flur, kein Klappen einer Tür waren zu hören. Merkwürdig. War Lilo gar nicht zu Hause?
4
Raffaels Vermieterin Lilo Berthold war neunundsiebzig, und sie wohnte seit über fünfzig Jahren in dieser weitläufigen Altbauwohnung mit zehn Zimmern. Das ehemals prachtvolle Mietshaus war mittlerweile heruntergekommen, verwohnt und mehr als baufällig. Seit Jahrzehnten waren Fenster, Dach und Heizungsanlage nicht mehr saniert worden, durch die zerbrochenen Fenster im Treppenhaus pfiff der Wind, das Treppengeländer war im dritten Stock über mehrere Meter völlig weggebrochen.
Im Lauf der letzten Jahre hatte sich das Haus in ein Geisterhaus verwandelt. Die Mieter waren nach und nach ausgezogen, es gab nur noch zwei Parteien, die den Anwaltsattacken, bösen Briefen und Mobbingversuchen des Hausbesitzers, der das Haus sanieren und die lästigen Mieter endlich loswerden wollte, trotzten. Lilo im vierten Stock und eine indische Familie im Parterre.
Lilo lebte einfach schon zu lange in diesem Haus, als dass man sie so einfach auf die Straße setzen konnte, sie hatte »Bestandsschutz«, und alle Entschädigungs- und Umzugsangebote lehnte sie stur ab.
Im Hinterhof hatte sie einen kleinen Garten, den sie über alles liebte und mit dem sie sich verglich. Kam der Herbst und verloren Bäume und Blumen ihre Blätter und Blüten, dann war auch sie davon überzeugt, den Winter nicht zu überleben. Aber im Frühling, wenn alles wuchs und sie an jedem schon längst totgesagten Zweig frische Knospen entdeckte, erwachte ein unbändiger Lebenswille in ihr, der ihr monatelang Kraft gab.
Dieses Haus war ihr Leben, ihre Heimat. Die einzige, die sie hatte. Hier waren die vielen Zimmer vollgestellt mit Möbeln, die ihr etwas bedeuteten, die Bilder an den Wänden erzählten Geschichten von früher, und die Schränke waren vollgestopft mit Fotos und Erinnerungsstücken. Da gab es noch die sorgsam gehütete Aussteuer ihrer Mutter, das Geschirr und das Silberbesteck, das sie zu ihrer Hochzeit mit Wilhelm geschenkt bekommen hatte.
In dieser Wohnung existierte Wilhelm noch in ihren Gedanken und Erinnerungen. Wilhelm, mit dem sie zweiundfünfzig Jahre verheiratet gewesen und der vor sechs Jahren gestorben war. In einer anderen Wohnung würde er für immer verschwinden, das war ihr klar.
Ganz abgesehen davon, dass sie sich nicht vorstellen konnte, einen Umzug dieses Ausmaßes bewältigen zu können, wollte sie hier auch nicht weg. Niemals. Nur mit den Füßen voran würde man sie hier heraustragen, eine Zwangsräumung käme für sie einem Todesurteil gleich.
Natürlich war sie einsam, und sie war immer einsamer geworden, seit sie nach und nach keine Nachbarn mehr hatte, aber sie liebte diese Wohnung, hatte nichts anderes.
Als sich die Situation zuzuspitzen begann, weil der Vermieter die Miete erhöhte, soweit es im gesetzlichen Rahmen überhaupt möglich war, als die kleinen Reparaturen überhandnahmen und sie den ewigen Streit mit dem Hausbesitzer kaum noch verkraftete, entschloss sie sich, ein Zimmer unterzuvermieten. Möbliert. Vielleicht traf sie auf einen Menschen, der ihr eine Hilfe war.
Sie annoncierte in der Morgenpost, aber als sich auf die Annonce drei Wochen lang niemand meldete, vergaß sie es wieder.
Es geschah an einem trüben Novembertag.
Auch wenn Lilo nichts Besonderes vorhatte, stand sie normalerweise jeden Morgen um sieben Uhr auf. Weil sie davon überzeugt war, dass ein geregelter Tagesablauf lebensverlängernd wirkte.
Wer morgens pünktlich aufstand, sich wusch und Kaffee kochte, war noch am Leben. Wer im Bett blieb, war krank und wenig später tot.
Aber an diesem Morgen fragte sie sich, warum sie eigentlich aufstehen sollte. Draußen war es stockdunkel, der feuchte Nebel hing in den Straßen, im Zimmer war es kalt, nur unter der Bettdecke konnte sie eine gewisse Wärme halten.
Eine halbe Stunde döste sie noch vor sich hin, konnte es aber nicht genießen, erhob sich schließlich und ging ins Bad. Und schwor sich, morgen wieder den gewohnten Rhythmus aufzunehmen, denn die fehlende halbe Stunde brachte ihren gesamten Tagesplan durcheinander.
Daher war sie den ganzen Tag ein wenig verunsichert, und dann klingelte es um halb zwölf auch noch an der Tür.
Lilo erschrak. Sie bekam nie Besuch. Sie hatte keine Familie und keine Freunde mehr in der Stadt, alle waren weggezogen oder tot. Der Briefträger meldete sich schon lange nicht mehr. Wenn er ein Paket abzugeben hatte, steckte er – wie überall – einfach nur noch die Benachrichtigung in den Briefkasten, dass etwas auf der Post abzuholen wäre.
Es konnten also nur der Hausmeister oder der Vermieter sein, und sie kamen sicher nicht, um ein paar Kekse abzugeben.
Ängstlich schlich Lilo zur Tür und sah durch den Spion.
Im Hausflur stand ein junger Mann im schwarzen Anzug, den sie noch nie gesehen hatte.
Sie legte die Sicherheitskette vor, öffnete die Tür nur einen Spaltbreit und sagte mit zittriger, hoher Stimme:
»Ja?«
»Entschuldigen Sie bitte, dass ich störe«, sagte der junge Mann sehr höflich, sehr nett und sogar mit einem Lächeln, »ich komme wegen des Zimmers, das Sie vermieten wollen. Wenn es noch frei ist, würde ich es mir gern einmal ansehen.«
»Ja«, sagte sie schon wieder und bebte am ganzen Körper. »Ja, ja, natürlich.«
»Ist das Zimmer noch frei?«
»Ja, ja.«
Sie hatte Angst, den Mann einzulassen. Sie fürchtete sich vor ihm. Er sah aus, als käme er von einer Beerdigung. Oder als arbeite er auf dem Friedhof.
Er brachte den Tod. Er war gekommen, sie zu holen. Aber es war doch noch viel zu früh! Sie war noch nicht bereit.
Diese Gedanken schossen ihr durch den Kopf, und im selben Augenblick wusste sie, dass sie spinös war, dass sie überfantasierte und einfach zu lange allein gewesen war. Mit der Realität hatte dies alles nichts zu tun.
Und obwohl sie die Angst noch nicht besiegt hatte, nahm sie die Sicherheitskette ab, öffnete die Tür und flüsterte:
»Bitte, kommen Sie herein.«
Der Mann betrat den Flur langsam und sah sich aufmerksam um.
»Ach, ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Herbrecht. Raffael Herbrecht.«
Sie nickte. Raffael. Ein Engel, einer der drei Erzengel. Dunkel erinnerte sie sich, dass der Name »Gott heilt« oder »der Heiler« bedeutete. Der Name gefiel ihr.
»Hier, mein Ausweis.« Er zog die Plastikkarte aus seiner Hosentasche und gab sie ihr.
Lilo sah hin, konnte aber ohne Brille nichts entziffern, und gab sie ihm wieder zurück.
»Danke. Kommen Sie bitte, ich zeige Ihnen das Zimmer.«
Es war die letzte Tür am Ende des langen Flurs.
Lilo öffnete und ließ ihn eintreten.
Raffael ging nur drei Schritte in den Raum hinein und sah sich um. Nach wenigen Sekunden sagte er:
»Es gefällt mir. Ich würde es gern mieten. Wie viel kostet es?«
»Aber Sie haben es sich ja noch gar nicht richtig angesehen! Heute scheint zwar nicht die Sonne, aber Sie merken ja, dass es dennoch sehr hell ist. Und es ist eigentlich auch ganz ruhig. Finden Sie nicht? Ich meine ja nur … Die Schränke habe ich ausgeräumt, da haben Sie genug Platz für Ihre Sachen.«
»Ich hab kaum was, das passt schon«, murmelte Raffael.
Lilo hatte seinen Einwurf gar nicht registriert.
»Es sind sehr alte Möbel. Teilweise noch von meinen Eltern. Das ist sicher nicht Ihr Geschmack. Also, wenn Sie wollen, können wir auch ein paar rausräumen, und Sie stellen sich etwas Moderneres rein.«
Raffael ging zu Lilo und baute sich vor ihr auf, was sie noch mehr verunsicherte.
»Hören Sie, Frau …? Wie heißen Sie noch mal?«
»Berthold. Lilo Berthold.«
»Okay, Frau Berthold. Also: Das Zimmer gefällt mir. So wie es ist. Ich finde es klasse, und ich habe nicht die geringste Lust, irgendein lustiges Möbelrücken zu veranstalten. Außerdem besitze ich gar keine Möbel. Nein, ich finde die Sachen toll! Sie haben was. Das Zimmer ist ein Traum! Sie brauchen es mir nicht noch anzupreisen. Ich glaube, ich werde hier meine Ruhe haben. Und mehr will ich gar nicht. Also noch mal: Was kostet es?«
»Dreihundertfünfzig.«
»Gut. Wann kann ich einziehen?«
»Sofort, wenn Sie möchten.«
Ein Lächeln zog über Raffaels Gesicht. »Das ist fantastisch. Zeigen Sie mir noch das Bad?«
Lilo zeigte ihm Bad und Küche.
»Wir sind ja nur zwei Personen. Ich denke, wir werden uns einigen.«
»Das denke ich auch.«
Während er ein paar Schränke in der Küche öffnete und Schubladen aufzog, beobachtete Lilo ihn. Was ist das für ein Mensch?, überlegte sie. Einer, der einen schlecht sitzenden, schwarzen Anzug anzieht, nur um bei mir Eindruck zu schinden? Wahrscheinlich braucht er das Zimmer dringend.
»Frau Berthold, bekomme ich das Zimmer?«, fragte er schließlich. »Ich würde mich riesig freuen.«
»Ja, natürlich.«
Raffael schüttelte ihr die Hand.
»Wenn Sie wüssten, wie glücklich ich bin. Und wenn es Ihnen nichts ausmacht, dann ziehe ich am Samstag ein.«
Er atmete tief durch, strahlte sie noch einmal an und verließ dann mit zügigen Schritten die Wohnung.
In zwei Tagen hatte sie einen Untermieter, aus dem sie noch nicht ganz schlau wurde. Aber sie war neugierig auf ihn und freute sich darauf, in ihrer riesigen Wohnung nicht mehr allein zu sein.
Sie hatte den halben Samstag am Fenster gesessen und darauf gewartet, dass ein Möbelwagen, wenn auch ein kleiner, vor ihrer Haustür hielt.
Als den ganzen Vormittag nichts passierte, ging sie allmählich davon aus, dass er es sich anders überlegt hatte. Alles war nur so dahingesagt worden, es ging ja auch so schnell, wahrscheinlich hatte er sie und ihre Wohnung schon längst wieder vergessen. Man durfte eben nicht alles glauben.
Aber am Nachmittag um halb vier fuhr ein Taxi vor, und Raffael stieg aus. Mit zwei Koffern und einer Umhängetasche aus Stoff. Eine, die man in manchen Geschäften als Werbegeschenk bekommt.
Das war alles.
Lilo wäre in der Lage gewesen, mit diesem Gepäck drei Wochen Urlaub zu machen, aber nicht in eine neue Wohnung zu ziehen.
Sie öffnete ihm die Tür und wartete ab.
Er stellte die beiden Koffer in sein Zimmer, kam wieder heraus und rieb sich die Hände.
»’tschuldigung, Frau Berthold«, sagte er, »aber ich hab das jetzt alles nicht mehr so genau im Kopf. Wie war das? Wir benutzen die Küche gemeinsam?«
»Aber sicher. Die oberen drei Fächer des Kühlschranks sind für Sie, die unteren drei für mich. Wer gekocht hat, wäscht das Geschirr, das er benutzt hat, ab und stellt es weg. So einfach ist das. Im Grunde dürfte es keine Probleme geben. Wenn ich Sie zum Essen einlade, mache ich die Küche sauber. Ist doch klar.«
»Und umgekehrt genauso«, meinte Raffael und lächelte. »Haben Sie denn für heute Abend schon was geplant? Sonst schlage ich vor, ich laufe schnell los, kaufe was ein und koche uns eine Kleinigkeit. Was halten Sie davon?«
Damit hatte Lilo nicht gerechnet. Später vielleicht. Wenn überhaupt. Aber nicht am ersten Abend des Einzugs.
Aber natürlich, der junge Mann hatte nach dem Umzug Hunger, wollte essen und sie mit einbeziehen. Das war ja nicht zu glauben.
»Nein, das kann ich nicht annehmen«, stotterte sie, und ihre blassen Wangen bekamen einen rosa Schimmer.
»Das brauchen Sie auch nicht. Sie brauchen nur zu essen.«
Er lief im Laufschritt los, zum kleinen Edeka-Markt an der Ecke.
Eine halbe Stunde später deckte er den Tisch mit Nudelsalat, Fleischsalat und Krabbensalat, heißen Würstchen und knusprigem Baguette.
Gerade als sie anfangen wollten zu essen, stand Lilo auf. »Moment!«, sagte sie. »Da hab ich ja noch was!«
Sie verschwand in ihrem Schlafzimmer und kam eine Minute später mit einer Flasche Weißwein aus dem Jahr 1999 zurück.
»Die ist noch aus Wilhelms Zeiten. Wilhelm war mein Mann. Er ist seit sechs Jahren tot. Wir sind nicht mehr dazu gekommen, sie zu trinken, und allein macht es keinen Spaß. Aber jetzt wäre der richtige Anlass!«
Raffael nahm ihr die Flasche aus der Hand, öffnete sie und schenkte in zwei Weingläser ein, die ganz hinten im Schrank standen und schon ewig nicht mehr benutzt worden waren.
»Cin Cin!« Er prostete ihr zu.
Auch sie hob ihr Glas. »Auf dass Sie hier glücklich werden und wir uns vertragen!«
»Ich hoffe es.«
Er zündete sich eine Zigarette an, und Lilo hob zaghaft die Hand.
»Entschuldigen Sie«, sagte sie vorsichtig, und es war ihr unangenehm, »aber wäre es möglich, dass Sie hier in der Küche nicht rauchen? Ich bekomme bei Rauch immer so schlecht Luft.«
Raffael wirkte verärgert. »Und in meinem Zimmer?«
»Nun, da kann ich nichts dagegen haben. Schließlich bezahlen Sie dafür. Nur nicht hier in der Küche, bitte, und nicht im Bad.«
»Obwohl ich dafür ja auch bezahle.«
»Ja, schon, aber …« Sie wusste nicht, was sie sagen sollte. Es hatte alles so gut angefangen mit dem neuen Untermieter, jetzt wollte sie ihn nicht gleich wieder verlieren.
»Schon gut!«, zischte Raffael. »Ist ja schon gut. Schon um die Ecke. Hab ich kapiert.«
Er ging zur Spüle, ließ Wasser über die Zigarette laufen und warf sie in den Mülleimer.
»Schon gut.« Er setzte sich wieder. Aber lächelte nicht.
Lilo überlegte, wie sie es wiedergutmachen konnte.
Sie schenkte Raffael immer wieder nach und holte wenig später noch eine zweite Flasche.
Der Wein war bereits gekippt und schmeckte blechern, aber Raffael schien es nicht zu stören. Lilo trank insgesamt vielleicht ein Glas, den Rest der beiden Flaschen trank er.
»Wieso haben Sie so wenig Gepäck?«, fragte sie irgendwann.
Raffael hatte bereits Schwierigkeiten zu formulieren.
»Es ist meine Philosophie«, meinte er. »Besitz belastet. Ich möchte frei sein.«
»Das verstehe ich.«