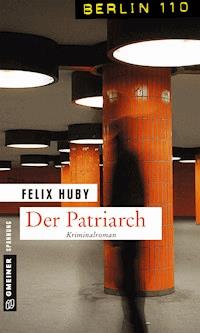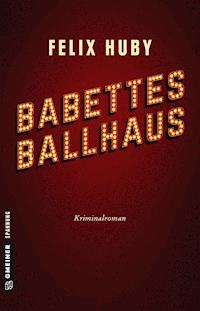7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar Bienzle ermittelt
- Sprache: Deutsch
Am Tag vor Bienzles Ankunft stürzt der wichtigste Mann des Dorfes in einen alten Steinbruch. Vielleicht hätte man ihn ohne viele Umstände begraben. Aber der Kommissar stellt schnell fest: Der Tod war als Strafe gedacht – genau wie bei sechs anderen Mordopfern in den letzten sechs Jahren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 226
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Felix Huby
Bienzle und die letzte Beichte
Krimi
Über dieses Buch
Am Tag vor Bienzles Ankunft stürzt der wichtigste Mann des Dorfes in einen alten Steinbruch. Vielleicht hätte man ihn ohne viele Umstände begraben. Aber der Kommissar stellt schnell fest: Der Tod war als Strafe gedacht – genau wie bei sechs anderen Mordopfern in den letzten sechs Jahren.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2018 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Nicole Lange, Darmstadt
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-490947-9
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Prolog
Erster Tag – Samstag
Zweiter Tag – Sonntag
Dritter Tag – Montag
Vierter Tag – Dienstag
Fünfter Tag – Mittwoch
Sechster Tag – Donnerstag
Siebter Tag – Freitag
Epilog
Prolog
Der Weg war schmal und tief ausgetreten. Schlehenbüsche drängten von links und rechts herein. Man musste ihnen behutsam ausweichen. Ihre spitzen Stacheln verhakten sich nur allzu leicht in den Kleidern.
Paul Autenrieth ging mit schnellen, festen Schritten und hatte seinen Blick auf das hellbraune Band des Trampelpfades gerichtet. Tief unter ihm gurgelte die junge Donau zwischen den schroff aufragenden Felsen. Es hatte viel geregnet in den letzten Tagen und Wochen. Der Fluss führte mehr Wasser als gewöhnlich.
Der Hund lief, die Nase dicht am Boden, weit voraus. Autenrieth stieß einen schrillen Pfiff aus. Der Rüde machte sofort kehrt und rannte zu seinem Herrn zurück. Paul Autenrieth hatte seit seinem vierzehnten Lebensjahr immer einen Hund gehabt. Und alle hatte er zum absoluten Gehorsam erzogen.
Etwa dreißig Meter vor dem Spaziergänger wurde nun der Weg etwas breiter und öffnete sich zu einem schmalen Aussichtsplatz. Dort stand eine Bank, die Autenrieth vor Jahren dem örtlichen Verschönerungsverein gestiftet hatte. Sein Name war auf einem kleinen Metallplättchen am oberen Rand der Lehne festgehalten. Autenrieth blieb überrascht stehen. Auf der Bank saß eine schmale Gestalt. »Voraus!«, kommandierte er seinen Hund. Der rannte los und blieb bei der Gestalt stehen, verbellte sie aber nicht, wie es Autenrieth eigentlich erwartet hatte.
Autenrieth erreichte den Aussichtspunkt. »Du?«, sagte er überrascht. »Um diese Zeit hier draußen?«
»Ich hab auf dich gewartet«, kam die Antwort. »Komm, setz dich her!«
»Ich denk ja nicht dran!« Autenrieths Augen funkelten böse. Sein Blick ging über die hellen Felsen, deren Kanten und Verwerfungen, schattenlos und klar, senkrecht abfielen, hinab zum Fluss.
»Ja, da geht’s steil und tief hinunter«, hörte er die Stimme in seinem Rücken sagen.
»Des ischt ja nix Neus«, gab er unfreundlich zurück. »Und jetzt lass mir mei Ruh!«
»Hast du alles erledigt?«
»Du hast mir ja keine andere Wahl gelassen.«
»Natürlich nicht. Gute Nacht, Paul.«
Autenrieth antwortete nicht. Er sah der leicht gebeugten Gestalt nach, wie sie auf dem schmalen Weg davonging. Dem Dorf zu. Einen Augenblick durchzuckte ihn der Gedanke, wie leicht es wäre, dieses teuflische Wesen jetzt, in diesem Augenblick, loszuwerden. Dann wäre Schluss mit den Peinigungen. Er hätte das schwache Bündel Mensch ohne viel Kraftaufwand über den Felsrand hinabstoßen können. Jeder hätte geglaubt, es sei gestürzt, weil ihm schwindlig geworden oder weil es über einen Stein oder einen Ast gestolpert sei.
Aber wahrscheinlich war ja auch für diesen Fall vorgesorgt. Und dann würde alles auffliegen. Er zog die Luft durch die Zähne und setzte sich auf die Bank. Hier würde er – wie so oft – sitzen bleiben, bis die Sonne vollends untergegangen war. Sein Hund würde noch ein wenig herumstrolchen und sich dann auf seine Füße legen. Paul Autenrieth genoss dabei die animalische Wärme, die von dem Körper des Tieres ausging. Aber an diesem Abend wollte die Ruhe nicht einkehren, die er sonst fand, wenn er hier, an seinem Lieblingsplatz über dem Donaudurchbruch, den Tag ausklingen ließ.
Erster Tag – Samstag
Achtzig Jahre ist ein gesegnetes Alter«, sagte Bienzle und rechnete im Stillen aus, wie lange es bei ihm noch dauern würde, bis er diese Zahl an Lebensjahren erreichen würde.
Hannelore, die am Steuer des Wagens saß, warf einen Blick zu ihm hinüber, als ob sie wüsste, was in seinem Kopf vorging. »Zum Glück ist das bei uns noch eine Weile hin.«
»Bei dir sowieso«, antwortete Bienzle. »Noch dreißig Jahre. Das ist ein halbes Leben.«
»Trotzdem«, sagte Hannelore, ohne näher zu erklären, was sie damit meinte.
Das Dorf lag in einer Senke, hingekuschelt zwischen Feldern, Wäldern und Wiesen, die sich an sanften Hügeln hinzogen. Im Hintergrund sah man einen kegelförmigen bewaldeten Berg. Bienzle erinnerte sich, dass man ihn hier in Felsenbronn »Backofen« nannte. Wenn dort im Frühjahr oder Herbst die Morgennebel aufstiegen oder wenn die Erde nach heftigem Regen im Sommer dampfte, erzählte seine Tante Gerlinde dem kleinen Ernst: »Jetzt backet d’ Hase Pfannekuche.« Und natürlich glaubte er ihr.
»Woran denkst du?«, fragte Hannelore, und Bienzle erzählte es ihr.
Hannelore lächelte: »Ich liebe solche Geschichten!«
»Leider gibt’s hier auch ganz andere«, sagte Bienzle ernst.
»Aber jetzt feiern wir erst amal der Tante Gerlinde ihren Geburtstag, machen eine schöne Wanderung und fahren dann gemütlich wieder heim.«
Hannelore und Bienzle waren im Gasthof Adler untergebracht. Dort sollte auch das Geburtstagsfest stattfinden. Als die beiden ankamen, war schon fast die ganze Gesellschaft versammelt. Hannelore, die sich nie besonders um Bienzles Verwandtschaft gekümmert hatte, was im Übrigen durchaus auf Gegenseitigkeit beruhte, wunderte sich über die Ähnlichkeit einiger Männer mit ihrem Bienzle. Sie hatten alle diese rundlichen Gesichter und diesen listigen Blick.
Bienzle hatte ihr schon öfter erklärt, dass dieser Ausdruck nicht listig, sondern knitz sei, und in knitz stecke eben nicht nur List, sondern auch Witz und Hintersinn. Jedenfalls hatte Ernst Bienzle mindestens vier Cousins oder Neffen, die runde Gesichter, knitze Augen, kurze Hälse und erstaunlich schmale Hände hatten wie er.
Und von allen ging etwas Kraftvolles und sehr Selbstbewusstes aus. Wahrscheinlich verwendeten auch alle diesen Spruch: »Egal wo i am Tisch sitz, da wo ich sitz, ischt auf jeden Fall oben!«, den sie von Bienzle kannte.
Die Wiedersehensfreude schien echt zu sein. Man umarmte sich zwar nicht, dazu waren sie wohl alle zu protestantisch erzogen. Aber sie hielten die Hand des anderen lang in ihren Händen, schauten sich in die Augen, schlugen sich auch schon mal herzhaft auf die Schulter oder den Rücken, und sie lachten viel.
Die Frauen bildeten sofort eine eigene kleine Gruppe. Da gab es keine langen Vorreden. »Wie geht’s dei’m Vadder, ischer emmer no so unleidlich?«, war zum Beispiel so ein Begrüßungssatz. Oder: »Was macht dei Rheuma, also i ben letztes Jahr in Abano Therme gwesa. Kann i dir nur empfehla.«
Die Angesprochene fasste sich ins Kreuz und sagte: »I han doch koi Zeit.«
»Ha, jetzt komm, deine Kinder sind doch ausem Haus!«
»Dafür hab i jetzt vier Enkel!«
»Dann wissen wir wenigstens, wer amal unsere Rente zahlt«, warf Bienzle ein.
»Ha komm«, rief einer seiner Vettern. »Du bischt doch Beamter und kriegscht Pension von unsere Steuergelder!«
»Hascht du was gege Beamte?«, fragte ein anderer Vetter. Er war Richter am Amtsgericht in Ulm.
»Was soll ich gege Beamte han, die tun doch nix!«
Das alles und noch viel mehr wurde hin und her geworfen, noch bevor sich überhaupt alle begrüßt hatten.
Hannelore sagte zu einer Frau, die neben ihr stand. »Also, wer immer behauptet hat, Schwaben seien maulfaul – der kann sie nicht gekannt haben.«
»So sind sie aber auch nur, wenn sie sich gut kennen und halbwegs vertrauen.«
»Sie sind keine Schwäbin?«, fragte Hannelore und musterte die Frau erst jetzt richtig. Sie war gut einen Kopf größer als sie selbst, trug ein rotes Kleid aus fließendem Stoff, das bis zu den Knöcheln hinabreichte und tief ausgeschnitten war.
»Nein, ich stamme aus Dresden, hört man das nicht?«
»Doch, jetzt schon.« Hannelore lächelte die Frau offen an. Sie hatte ein schönes gleichmäßiges Gesicht. Ihre roten Haare hatte sie hoch getürmt. Ihre schmalen Augen gaben ihr allerdings einen lauernden Ausdruck. Hannelore sagte: »Da sind wir ja schon zu zweit – als Nichtschwäbinnen, meine ich.«
Die Frau nickte. »Finden Sie’s nicht auch komisch, dass die alle immer noch im Dialekt sprechen?«
»Nein, eigentlich nicht. Mein Bienzle spricht oft Schwäbisch, und ich hör’s ganz gern.«
»Also meinem Bienzle hab ich das abgewöhnt«, sagte die Sächsin.
Es stellte sich heraus, dass sie die Frau des Ulmer Richters war, der freilich im Gespräch mit seinen Verwandten genauso schwäbelte wie alle anderen.
Bienzle kam herüber. »Sie sind dem Oskar sei Frau, gell?«
Er reichte ihr die Hand, und sein Blick blieb an ihrem Dekolleté hängen. Auf ihn wirkte es wie eine Demonstration der Tatsache, dass auch über fünfzigjährige Frauen noch einen schönen Busen haben können.
Hannelore erinnerte sich im selben Augenblick an ein paar Kleider, die im Schrank hingen und die sie schon lange nicht mehr angehabt hatte.
Gerlinde rief zu Tisch. Die zierliche Person bat um ein wenig Ruhe und begrüßte ihre Gäste mit einer kleinen Rede. Dabei erwähnte sie, dass ihre Neffen und Nichten – eigene Kinder hatte sie nicht – das Fest finanziert hatten, als gemeinsames Geburtstagsgeschenk.
Hannelore beugte sich zu Bienzle hinüber. »Schämt ihr euch eigentlich nicht? Ihr bezahlt, was ihr esst und trinkt, und gebt es dann als Geschenk aus?«
Bienzle grinste: »So semmer halt!«
Aber Hannelore musste dann doch feststellen, dass sie vorschnell geurteilt hatte. Denn jeder hatte auch noch ein persönliches Geschenk mitgebracht, und die meisten überreichten es mit einer kleinen Ansprache, oft in Gedichtform, und es war erstaunlich, wie kunstvoll manche dieser Verse waren. »Lauter kleine Mörikes, Uhlands und Schillers«, sagte Hannelore zu der Frau des Richters, die ihr gegenübersaß.
»Ja«, gab die zurück, »es gibt eben nur zwei Geniezonen in Deutschland: Sachsen und Schwaben.«
»Mei Hannelore ischt aus Königsberg«, sagte Bienzle, »und die ist ein Genie als Malerin, und der Immanuel Kant kommt ja – glaub ich – auch von dort. Ond wenn mich ned alles täuscht, war Goethe ein Frankfurter und der Beethoven stammt aus Bonn.«
»Aber Einstein war ein Ulmer«, warf der Richter ein.
»Des hat ihm bei den Nazis aber au nix g’holfe«, gab Bienzle bissig zurück. Da war die Markklößchensuppe schon verspeist, und der Sauerbraten mit Spätzle wurde aufgetragen.
Zwei Großneffen Gerlindes rappten zu ihren Gitarren: »Tante achtzig/das macht sich/Opa sechzig, das rächt sich/Tante Charlotte vierzig, ziert sich, Jeanette ischt zwanzig/ond jetzt scho ranzig …«, weiter kamen sie nicht, weil sich ihre ältere Schwester Jeanette wütend auf sie stürzte. Es dauerte etwas, bis wieder Ruhe eingekehrt war. Dann folgte die Weinschaumcreme, hierzulande auch Chaudauxsößle genannt, die es in schwäbischen Haushalten schon immer sonntags gab, wenn man den frühen Alkohol ein wenig kaschieren wollte.
Hannelore wollte wissen, wie es nun weiterginge.
»Jetzt geht man spazieren«, erläuterte Bienzle, »dann gibt’s Kaffee und Kuchen, und wahrscheinlich habet die Junge ein paar Spiele vorbereitet, und fast möcht ich wetten: im Stil von ›Wer wird Millionär?‹. Nach dem Kaffee vertritt man sich wieder ein wenig die Beine, und dann gibt’s ein wirklich kräftiges Abendessen. Vermutlich kalte Platten mit Hausmacherwurst und dazu einen wunderbaren Kartoffelsalat, wie man ihn nur hier, im Felsenbronner Adler, kriegt. Und danach kommt eine kleine Tanzkapelle, und wer will, kann dann noch a bissle tanzen.«
Aber das alles erlebte Hannelore ohne ihren Bienzle. Denn der Nachtisch war grade abgeräumt, und man wendete sich dem Verdauungsschnäpschen zu, da stand plötzlich ein kleiner dicker Mann in der Tür des Wirtshaussaales und sagte: »Herr Bienzle, da sind Sie ja!«
Bienzle kniff die Augen zusammen, schüttete den Schnaps hinunter. Dann erst sagte er: »Kurt Langlott! Was machet Sie denn hier?« Und zu seinen Verwandten am Tisch gewandt, fügte er leise hinzu: »Ich hab schon immer gesagt, wenn einer so aussieht, dürft er net Langlott heißen!«
Bienzles Vetter Oskar kannte den Mann ebenfalls: »Das kann nichts Gutes bedeuten«, sagte er und hielt der Bedienung sein Schnapsglas noch einmal hin.
»Kann ich Sie einen Moment unter vier Augen sprechen?« Kurt Langlott wirkte, als ob er auf dem Weg hierher alle seine Sätze auswendig gelernt hätte.
»Sehet Sie net, dass ich privat hier bin!«
»Der Herr Polizeipräsident sagt, er habe das sogar mit der zuständigen Abteilung im Stuttgarter Innenministerium abgesprochen.«
Um die große U-förmige Tafel herum war es plötzlich still geworden. Alle starrten auf Langlott und Bienzle.
»Was ist denn passiert?«, wollte Gerlinde wissen.
»Wir haben schon wieder einen unnatürlichen Todesfall!«, presste Langlott hervor. Er war höchstens einen Meter sechzig groß und hatte eine gedrungene Figur. Eigentlich war er nicht dick, zumindest nicht im landläufigen Sinne; denn alles an ihm war drall und fest. Die Beine glichen zwei kräftigen Säulen, auf denen ein runder praller Rumpf ruhte. Die Arme waren für den kurzen Körper viel zu lang und sehr muskulös. Seine Hände hatten etwas von Schaufeln. Der quadratische Schädel saß auf einem dicken kurzen Hals.
»Wer ist tot?«, fragte ein drahtiger Mann, der am unteren Tischende saß. Bienzle hatte mitbekommen, dass er der Bürgermeister von Felsenbronn war. Er hieß Thomas Vogler. In jeder Gesellschaft hätte man ihn übersehen, und Bienzle hatte sich bei der Überlegung ertappt, dass dies für so einen ein guter Grund sein könnte, Bürgermeister zu werden. Unangenehm war dem Kommissar aufgefallen, dass Vogler ständig gegen ein nervöses Zucken im rechten Augenwinkel ankämpfte.
»Paul Autenrieth!«, stieß Langlott hervor.
»Was?? Wie?« An der Reaktion der einheimischen Gäste war abzulesen, dass Paul Autenrieth nicht irgendjemand war, sondern ganz offenbar ein wichtiger Mann.
Bienzle wandte sich an seine Tante Gerlinde: »Kenn ich den?«
Gerlinde nickte. »Wie du in den schlechten Jahren immer hier g’wesen bist, damit man dich a bissle aufpäppelt, habt ihr manchmal miteinander gespielt …«
»In den schlechten Jahren …«, so nannte man hier die Jahre im Zweiten Weltkrieg und danach. Bienzle war kurz nach dem Kriegsende geboren. Und da seine Eltern kein Geld hatten, um Urlaub zu machen, wurde er in den Sommerferien immer nach Felsenbronn geschickt, damit ihn die Tante Gerlinde »herausfüttern« konnte, was sie auch mit großer Leidenschaft tat. Unvergesslich ihr Spruch: »Bei mir kriegscht du a Butterbrot, dass man die Zähne drin sieht, wenn du neibeißt!«
Paul Autenrieth, daran erinnerte sich Bienzle, war der Sohn des größten Bauern in Felsenbronn gewesen. Und als Tante Gerlinde Bienzle einmal in Stuttgart besucht hatte, erzählte sie, dass Autenrieth ein Drittel seiner Äcker als Bauland für ein Industriegebiet verkauft habe. »Für eine Unsumme!«
Kurt Langlott stand noch immer unbeweglich unter der Tür. »Kommet Sie?«, fragte er.
»Woher wissen die im Innenministerium …?«
»Ich hab das gewusst. Von Ihrer Tante. Ich meine, dass Sie heute hier sind. Und da hab ich … Entschuldigung, ich hab ja keine Erfahrung mit Mordfällen …«
Hannelore lachte in sich hinein. »Was für ein wunderbarer Zufall«, sagte sie leise und fing sich dafür einen bösen Blick Bienzles ein.
Kurt Langlott, Leiter des örtlichen Polizeipostens, hatte darauf geachtet, dass an der Fundstelle der Leiche nichts verändert wurde. Paul Autenrieth lag halb im Wasser am felsigen Ufer der Donau, die hier in Jahrmillionen einen tiefen Canyon in das Juragestein gegraben hatte. Sein Oberkörper schmiegte sich förmlich in eine Steinkuhle, die vom pulsierenden Wasser des Flusses rund geschliffen worden war. Bevor er hier liegen blieb, musste er mehrfach in der steilen Wand aufgeschlagen sein. Blutspuren markierten die letzten vier, fünf Meter seines Sturzes.
Der Weg hier herunter war mühsam gewesen, vor allem wenn man, wie Bienzle, nicht das richtige Schuhwerk an den Füßen hatte. Der steile Pfad führte im Zickzack durch die Wand. An manchen Stellen waren Eisenklammern in den Fels geschlagen worden, damit man Halt fand. Den ganzen Weg hinunter dachte Bienzle daran, dass er nachher auch wieder hinauf musste.
»Wer hat ihn gefunden?«, fragte Bienzle.
»Wir haben einen Telefonanruf gekriegt.«
»Und?«
»Jetzt hat er, was ihm g’hört!«
»Hä?«
»Ja, so hat die Stimme am Telefon g’sagt.«
»Mann oder Frau?«
»Schwer zu sagen.« Als Langlott in Bienzles Gesicht sah, setzte er hinzu: »Ja wirklich, es gibt doch so Stimmen, wo man des net genau weiß. Der Anrufer oder die Anruferin hat dann noch gesagt: ›Der Autenrieth ist tot. Er liegt an der Donau drunten. Direkt unter seiner Bank.‹«
Bienzle nickte. »Ist der Anruf aufgezeichnet?«
»Nein. Bei uns werden die Gespräche nicht mitgeschnitten. Solche Vorrichtungen wie Sie in Stuttgart haben wir hier oben nicht.«
Bienzle winkte begütigend ab. »Wie lang sind Sie jetzt schon der Chef hier?«
»Seit Januar 2002.«
»Sie haben gesagt, Sie hätten schon wieder einen unnatürlichen Todesfall?«
»Ja, letztes Jahr hatten wir schon mal einen, und überhaupt …«
»Was überhaupt?«
»Wissen Sie nicht, wie man Felsenbronn hier oben nennt?«
Bienzle sah Langlott nur fragend an.
»Mörderdorf!«
Die Mitarbeiter der Spurensicherung beendeten ihre Arbeit. Bienzle verfügte, dass die Leiche in die Gerichtsmedizin nach Tübingen gebracht werden solle. Er sah an der Felswand hinauf. »Es muss ja nicht unbedingt ein Mord gewesen sein«, sagte er – eigentlich gegen seine Überzeugung. »Wenn ’s einem da oben plötzlich schwindlig wird oder wenn man ungeschickt stolpert …!«
»Der Autenrieth ist hier jeden Abend mit seinem Hund gelaufen. Der kannte jeden Quadratzentimeter auf dem Weg.«
»Selbstmord?«
»Ich denke, Sie haben den gekannt?!«
»Als Kind!«
Die Leiche Autenrieths wurde in einen Blechsarg gehoben. Man brauchte vier Männer dafür. Der Großbauer wog weit über zwei Zentner, und nun hatte es für Bienzle den Anschein, als mache er sich noch einmal besonders schwer.
»Weiß seine Familie schon Bescheid?«, fragte Bienzle.
»Offiziell noch nicht«, antwortete Langlott.
»Soll ich das übernehmen?«
Langlott sah seinen Stuttgarter Kollegen mit großen Augen an. »Das würden Sie tun?«
»Manchmal erfährt man bei so einer Gelegenheit mehr als nachher in stundenlangen Befragungen.«
»Ja, da könnten Sie Recht haben, trotzdem …«
»Ich weiß«, Bienzle legte dem jüngeren Kollegen kurz die Hand auf die Schulter, »das ist oft das Schwerste an unserem Beruf. Aber was sein muss, muss sein!«
Der Autenrieth-Hof lag etwas außerhalb des Dorfes. Ein schmales Sträßchen bog von der Landesstraße ab, die weiter nach Sigmaringen führte. Auf einem Schild stand: »Privatweg. Befahren auf eigene Gefahr.« Nach etwa fünfzig Metern begannen auf beiden Seiten Pappeln die Zufahrt zu begleiten, die vor einem eisernen Tor endete. Nach rechts und links zog sich eine Backsteinmauer hin, vor der eine saubere Reihe Kirschlorbeerbüsche gepflanzt war. Über die Mauer hinweg war nur das steile rote Ziegeldach des Hauptgebäudes zu erkennen. Das Tor war verschlossen. Bienzle klingelte. Ein Hund kam bellend den Plattenweg heruntergerannt und führte dann jenseits des gusseisernen Torgitters einen wahren Veitstanz auf. Die Stimme aus der Gegensprechanlage war deshalb kaum zu hören.
»Ja, bitte?«
»Ich möchte Frau Autenrieth sprechen.«
»Die ist net da!« Jetzt war die Stimme besser zu hören, sie gehörte offenbar einem Mann und klang brüchig.
»Das wird der Gottlieb sein«, sagte Langlott.
»Und wer ist das?«
»Der alte Knecht!«
»Mein Name ist Bienzle. Ich bin von der Polizei und möchte trotzdem gerne reinkommen. Vielleicht kann ich ja auch mit Ihnen sprechen.«
»Ich mach auf!«
»Und der Hund?«
»Haben Sie Angst?«
»Nein, normalerweise kann ich mit Hunden umgehen, aber so ein Hofhund …?«
»Er heißt Astor!«
Ein Summer ertönte. Das Tor schwang auf. Kurt Langlott machte ein paar Schritte zurück und fasste nach seiner Dienstwaffe, während Bienzle zu dem Hund sagte: »Astor, brav. Bist doch ein guter Hund! Sitz!«
Der Rüde setzte sich und sah Bienzle aufmerksam an. Der Kommissar hielt dem Hund seinen Handrücken vor die Nase, damit der den Geruch aufnehmen konnte, und sagte gleichzeitig mit seiner ruhigen, tiefen Stimme: »Sehr gut! Von dir könnt no mancher Mensch was lerna!«
Vom Dorf her erklang das Kirchengeläut. Bienzle sah auf die Uhr. Es war sechs. Die Tradition des Abendläutens wurde hier also noch gepflegt. Früher diente es dazu, die Leute von den Feldern heimzurufen.
Langsam ging der Kommissar den Plattenweg hinauf. Der Hund hielt sich dicht an seiner Seite. Langlott war mit Bienzles Erlaubnis zu seinem Dienstwagen zurückgekehrt.
Unter der Tür des Wohngebäudes stand ein gebückter alter Mann, der sich auf einen Stock stützte. Er hatte schlohweißes Haar und wirkte ausgemergelt. Sein Gesicht war von zahllosen Falten durchzogen, aber es hatte die Bräune, die man nur bekommt, wenn man jahrein, jahraus an der frischen Luft ist, ganz egal bei welchem Wetter.
Bienzle stellte sich vor. Und der alte Mann sagte: »Ich bin der Gottlieb!«
Der Kommissar wählte den direkten Weg: »Der Herr Autenrieth ist ums Leben gekommen.«
»Ja«, sagte Gottlieb, »Gott sei seiner Seele gnädig.«
»Sie wissen es also schon?«
Gottlieb nickte nur.
»Darf ich reinkommen?«
»Warum?«
»Ich untersuche den Tod von Paul Autenrieth, und da gehört es dazu, dass ich sein Umfeld kennen lerne.«
»Sie schwätzet amal komisch«, sagte Gottlieb.
»Zeigen Sie mir trotzdem die Wohnung?«
»Die vom Herrn?«
»Ja, sicher!« Bienzle gab sich Mühe, geduldig zu bleiben.
»Des geht net. Da darf ich nicht ’nei.«
»Aber ich, und Sie dürfen mich begleiten!«
Von der zweiflügeligen schweren Holztür ging es eine breite Treppe in den ersten Stock hinauf, rechts und links von Handläufen in dunklem Holz begleitet. Bienzle wollte wissen, was im Erdgeschoss sei.
»Die Kammern«, sagte Gottlieb. »Früher hat da das Gesinde g’wohnt. Aber jetzt ben bloß noch ich das Gesinde! Man hat ja für alles Maschinen. Und der Herr hat auch fast sei ganzes Land verkauft.«
»Dabei ist er sicher reich geworden.«
»Das ist der scho immer g’wesen.«
Bienzle stapfte die Treppe hinauf. Im ersten Geschoss erreichten sie einen breiten Gang, der zum Treppenhaus hin mit einem schweren geschnitzten Geländer gesichert war. Genau gegenüber dem Treppenende befand sich eine breite Tür, die im oberen Teil mit einer bunten Glasscheibe geschmückt war. Das Fenster zeigte Erntemotive. Am rechten Türbalken hing ein Schlüssel. Zögernd griff Gottlieb danach, ließ dann aber die Hand wieder sinken. Bienzle nahm den Schlüssel vom Haken und öffnete die Tür.
Das Wohnzimmer war mindestens vierzig Quadratmeter groß. Durch die Fenster auf der gegenüberliegenden Seite strömte das milde Abendlicht herein. In der Mitte des Raumes stand ein massiver Holztisch, an dessen Längsseite je drei Stühle platziert waren. An einer Schmalseite befand sich ein schwerer hoher Holzsessel mit zwei Armlehnen und einem ledernen Sitzpolster. Da habe der Herr immer beim Essen gesessen, sagte Gottlieb.
Bienzle durchschritt den Raum und trat an eines der quadratischen Fenster. Der Blick ging weit über die Albhochfläche.
Der Kommissar wandte sich wieder dem Raum zu. Außer dem Tisch stand nur ein wuchtiges Büfett in dem Zimmer. Der Boden bestand aus hellen Holzdielen. »Essen Sie hier mit?«, fragte Bienzle.
Gottlieb lachte kurz und unfroh auf. Es war ein hohes Kichern, das er ausstieß. Er hatte überhaupt für einen Mann eine ziemlich hohe Stimme, die sich beim Lachen zudem überschlug. »Ich?«
»Also kein Familienanschluss?«
»Jetzt dann vielleicht, wer weiß?«
»Apropos Familie«, sagte Bienzle, »wie sieht es damit aus?«
»Seine Frau halt.«
»Keine Kinder?«
»Doch, schon. Aber die sind schon lang nimmer hier.«
Bienzle zog den hochlehnigen Holzsessel ein wenig vom Tisch weg und setzte sich. Gleichzeitig machte er eine einladende Geste und sagte: »Setzen Sie sich bitte.«
Gottlieb nahm auf der vordersten Kante eines Stuhles Platz, und es war ihm anzusehen, welche Überwindung ihn das kostete.
»Der Alex ist letztes Jahr vierzig geworden, und die Ariane ist vierunddreißig. Aber er hat nimmer mit ihnen gesprochen.«
»Warum?«
»Er hat sie bloß alleweil verspottet.« Gottlieb schüttelte den Kopf. »Und am Schluss hat er verboten, dass man überhaupt ihren Namen nennt.«
Bienzle musterte Gottlieb. »Aber Sie? Haben Sie nicht immer weiter Kontakt zu den Kindern gehalten?«
»Wie kommen Sie darauf?«
»Offenbar haben Sie doch auch unter Paul Autenrieth gelitten.«
Gottlieb nickte: »Ja, das stimmt.«
»Und?«
»Ja, manchmal hat man sich getroffen«, sagte Gottlieb unbestimmt.
»Und Frau Autenrieth?«
Gottlieb faltete die Hände und legte sie auf den Tisch. »Das reine Martyrium!«
»Wenn ich das richtig sehe, könnten jetzt alle erleichtert sein, dass er tot ist.«
»Ja«, sagte Gottlieb schlicht.
»Können Sie sich vorstellen, dass einer nachgeholfen hat?«
Gottlieb sah Bienzle aus seinen wasserblauen Augen an. Ein Lächeln umspielte seine faltigen Mundwinkel. »Den Mut hätt niemand gehabt. Außer dem Karl Meiler vielleicht.«
»Und wer ist das?«
»Der uneheliche Sohn vom Herrn.« Stockend berichtete der Knecht, Karls Mutter sei in Armut gestorben. Paul Autenrieth habe seine Vaterschaft nie anerkannt – auch dann nicht, als sie nach einem Gentest und einem Gerichtsurteil bestätigt worden sei. Jede Unterhaltszahlung habe der Gerichtsvollzieher eintreiben müssen.
»Und wo finde ich diesen Karl Meiler?«
»Es heißt, er sei ausgewandert.«
Bienzle stemmte sich aus dem Sessel heraus. »Wo geht ’s denn da hin?« Er zeigte auf eine Tür.
»Ins Herrenzimmer«, antwortete Gottlieb, »aber es ist streng verboten …« Er ließ den Satz in der Luft hängen.
»Ja, gell«, sagte Bienzle, »man muss sich erst dran gewöhnen.« Er öffnete die Tür zum Nebenraum. Der war etwa halb so groß wie das Wohnzimmer. Vor dem einzigen Fenster, das, genau wie die drüben im anderen Raum, nach Westen ging, stand ein Schreibtisch mit einer gepolsterten Lederauflage auf der Tischplatte. Auch der Stuhl davor war mit Leder gepolstert und hatte eine runde Rückenlehne.
Bienzle versuchte die Schreibtischschublade aufzuziehen. Sie war verschlossen. Gottlieb stand unter der Tür. Er traute sich offensichtlich nicht herein. »Ja dürfen Sie das?«, fragte er. Erst jetzt wurde Bienzle bewusst, dass sich der alte Knecht schon die ganze Zeit sehr bemüht hatte, hochdeutsch zu reden.
Bienzle ging nicht auf die Frage ein, sondern fragte: »Wissen Sie, wo der Schlüssel ist?«
»Warten Sie halt, bis die Frau Autenrieth wieder da ist.«
»Es wär schad um des schöne Möbelstück, wenn ich die Schublade aufbrechen müsste«, gab der Kommissar zurück.
Gottlieb stieß einen Seufzer aus. »Das wird mir der Herr nie verzeihen.«
»Dazu hat er jetzt auch gar keine Gelegenheit mehr«, sagte Bienzle.
Der Knecht kam herüber und ging um den Schreibtisch herum. Er kniete sich ächzend hin und fasste dicht über dem Dielenbretterboden von hinten unter die Umrandung des Tisches. »Er hat da einen Magneten eingelassen, da hängt der Schlüssel dran«, sagte er und zog ihn hervor.
Bienzle musste unwillkürlich lächeln. »Dafür, dass das hier für Sie alles streng verboten war, wissen Sie ganz schön Bescheid.«
»Ja«, sagte Gottlieb. »Aber er war ja au net besonders fein!«
»Wo waren Sie eigentlich gestern Abend?«
»Hier, hier im Haus.«
»Den ganzen Abend?«
»Wo soll ich auch hin?«
Die Schreibtischschublade enthielt Briefe, Notizen, alte Kalender, vergilbte Fotos und ein Kassenbuch.
Bienzle zog einen gültigen Kalender heraus. Offenbar hatte ihn Paul Autenrieth benutzt, um in kurzen Stichworten über sein Leben Buch zu führen. Aufgeschlagen war der 10. September 2004. Das war der gestrige Tag. Bienzle las: »Ich werde also zahlen. Ich habe keine andere Wahl!«
Er stand auf. »Wir werden den Raum versiegeln müssen«, sagte er ernst. Gottlieb, der wieder zur Türschwelle zurückgegangen war, nickte nur.
Es war zwanzig nach sechs, als Bienzle den Hof verließ. Gottlieb begleitete ihn bis zum Tor. Astor lief neben ihnen her. »Wie geht ’s denn jetzt für Sie weiter?«, fragte Bienzle den Knecht.