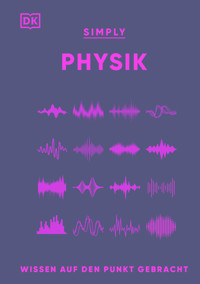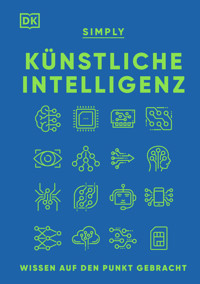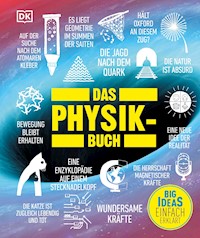
19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Dorling Kindersley Verlag
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Faszination Physik auf den Punkt gebracht Wie wirken die Gravitationsgesetze? Woraus besteht ein Atom? Was ist Bioelektrizität? Dieses innovative Nachschlagewerk führt mit informativen Diagrammen & ansprechenden Grafiken leicht verständlich in die Geschichte der Physik ein und beleuchtet über 80 physikalische Theorien und Gesetze sowie Biografien berühmter Physiker*innen – von der Bewegungslehre über Energie, Magnetismus bis hin zu Nuklearphysik und der Relativitätstheorie. Der neue Titel in der DK Bestseller-Reihe Big Ideas! Das große Physik-Buch zum Nachschlagen – Zusammenhänge, Theorien & Biografien kurzweilig und verständlich aufbereitet: • Über 80 der wichtigsten physikalischen Theorien und Gesetze: Dieses Buch erzählt die Geschichte der Physik der letzten 5.000 Jahre – von den Ägyptern bis heute. Dazu gibt es viele Anwendungsbeispiele – von den ersten Längenmessungen bis zu Gravitationswellen. • Wissen grafisch auf den Punkt gebracht: Spannende Diagramme sowie originelle Illustrationen und Fotografien in einem frischen Layout erleichtern auf kreative Weise den Zugang zur faszinierenden Welt der Physik. • Interessante Fragen rund um die Physik werden in diesem Buch verständlich und anschaulich beantwortet und regen zum Nachdenken an. • Die größten Physiker*innen im Porträt: Erfahren Sie mehr über das Leben und Wirken von Isaac Newton, Albert Einstein, Marie Curie und weiteren bedeutenden Physiker*innen. • Die Geschichte der Physik in sieben großen Kapiteln! Physik entdecken und verstehen! Der perfekte zugängliche Komplett-Überblick zu einer komplexen Wissenschaft – Basiswissen zum Studieren, Informieren oder Nachschlagen!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 552
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
INHALT
EINLEITUNG
MESSUNG UND BEWEGUNG
PHYSIK UND DIE ALLTAGSWELT
Der Mensch ist das Maß aller Dinge
Längen messen
Klug fragen können ist die halbe Weisheit
Die wissenschaftliche Methode
Alles ist Zahl
Die Sprache der Physik
Körper erfahren keinen Widerstand als durch die Luft
Der freie Fall
Eine neue Maschine zur Vervielfachung der Kraft
Druck
Bewegung bleibt erhalten
Der Impuls
Die wunderbarsten Erzeugnisse der mechanischen Künste
Zeit messen
Aktion und Reaktion
Die Bewegungsgesetze
Die Pfeiler des Weltensystems
Die Gravitationsgesetze
Überall hin und her
Harmonische Schwingungen
Die Kraft lässt sich nicht vernichten
Kinetische und potenzielle Energie
Energie kann weder erzeugt noch vernichtet werden
Die Energieerhaltung
Ein neuer Ansatz der Mechanik
Energie und Bewegung
Wir müssen in den Himmel schauen, um Maße für die Erde zu bekommen
SI-Einheiten und Naturkonstanten
ENERGIE UND MATERIE
STOFFE UND WÄRME
Die Grundprinzipien des Universums
Modelle der Materie
Wie die Dehnung, so die Kraft
Dehnen und Strecken
Die kleinen Bausteine der Stoffe bewegen sich schnell
Fluide
Das Geheimnis des Feuers wird gelüftet
Wärme und ihre Übertragung
Das Federn der Luft
Die Gasgesetze
Die Energie des Universums ist konstant
Innere Energie und der erste Hauptsatz der Thermodynamik
Wärme kann Bewegung auslösen
Wärmekraftmaschinen
Die Entropie des Universums strebt immer einem Maximum zu
Die Entropie und der zweite Hauptsatz der Thermodynamik
Die Flüssigkeit und ihr Dampf werden eins
Zustandsänderungen und Bindungen
Stoßende Billardkugeln in einer Box
Die Entwicklung der statistischen Mechanik
Heiße schwarze Körper
Wärmestrahlung
ELEKTRIZITÄT UND MAGNETISMUS
ZWEI KRÄFTE WERDEN VEREINIGT
Wundersame Kräfte
Magnetismus
Die Anziehung durch Elektrizität
Die elektrische Ladung
Potenzielle Energie wird zu fühlbarer Bewegung
Elektrisches Potenzial
Elektrischer Strom fließt nur durch leitfähiges Material
Elektrischer Strom und Widerstand
Jedes Metall hat eine bestimmte Kraft
Magnetherstellung
Elektrizität in Bewegung
Die motorische Wirkung
Die Herrschaft magnetischer Kräfte
Induktion und Generatoreffekt
Das Licht selbst ist eine elektromagnetische Störung
Kraftfelder und Maxwell’sche Gleichungen
Der Mensch wird die Kraft der Sonne einfangen
Stromerzeugung
Ein kleiner Schritt in der Kontrolle der Natur
Elektronik
Tierische Elektrizität
Bioelektrizität
Eine völlig unerwartete wissenschaftliche Entdeckung
Datenspeicherung
Eine Enzyklopädie auf einem Stecknadelkopf
Nanoelektronik
Ein einzelner Pol, entweder Nord oder Süd
Magnetische Monopole
SCHALL UND LICHT
DIE EIGENSCHAFTEN DER WELLEN
Es liegt Geometrie im Summen der Saiten
Musik
Licht nimmt den schnellsten Weg
Reflexion und Brechung
Eine neue sichtbare Welt
Fernrohr und Mikroskop
Licht ist eine Welle
Welle oder Teilchen?
Licht beugt sich nie in den Schatten
Beugung und Interferenz
Die Nord- und Südseite des Strahls
Polarisation
Die Trompeter und der Wellenzug
Doppler-Effekt und Rotverschiebung
Mysteriöse Wellen …, die wir … nicht sehen können
Elektromagnetische Wellen
Die Sprache der Spektren ist eine wirkliche Sphärenmusik
Licht aus dem Atom
Sehen mit Schall
Piezoelektrizität und Ultraschall
Ein großes fluktuierendes Echo
Über das Licht hinaus
DIE QUANTENWELT
UNSER UNSCHARFES UNIVERSUM
Die Lichtenergie ist diskontinuierlich im Raum verteilt
Energiequanten
Sie verhalten sich anders als alles, was man je gesehen hat
Teilchen und Wellen
Eine neue Idee der Realität
Quantenzahlen
Alles ist Welle
Matrizen und Wellen
Die Katze ist zugleich lebendig und tot
Die Heisenberg’sche Unschärferelation
Spukhafte Fernwirkung
Quantenverschränkung
Das Juwel der Physik
Quantenfeldtheorie
Parallele Zusammenarbeit
Quantenanwendungen
KERN- UND TEILCHENPHYSIK
IM INNERN DES ATOMS
Materie ist nicht unendlich teilbar
Atomtheorie
Eine echte Transformation der Materie
Kernstrahlen
Der Aufbau der Materie
Der Atomkern
Die Bausteine der Atome
Subatomare Teilchen
Kleine Wolkenfetzen
Teilchen in der Nebelkammer
Gegensätze können explodieren
Antimaterie
Auf der Suche nach dem atomaren Kleber
Die starke Kraft
Schreckliche Mengen an Energie
Atombomben und Kernenergie
Ein Fenster zur Schöpfung
Teilchenbeschleuniger
Die Jagd nach dem Quark
Der Teilchenzoo und die Quarks
Identische Kernteilchen verhalten sich nicht immer gleich
Trägerteilchen
Die Natur ist absurd
Quantenelektrodynamik
Das Rätsel der verschwundenen Neutrinos
Neutrinos mit Masse
Ich glaube, wir haben es
Das Higgs-Boson
Wo ist all die Antimaterie hin?
Materie-Antimaterie-Asymmetrie
Sterne werden geboren und sterben
Kernfusion in Sternen
RELATIVITÄTSTHEORIE UND DAS UNIVERSUM
UNSER PLATZ IM KOSMOS
Die Schleifen der Himmelskörper
Himmelsmechanik
Die Erde ist nicht der Mittelpunkt der Welt
Modelle des Universums
Keine wahre Zeit, keine wahre Länge
Von Galileis Relativitätsprinzip zur speziellen Relativitätstheorie
Die Sonne, wie sie vor acht Minuten war
Die Lichtgeschwindigkeit
Hält Oxford an diesem Zug?
Spezielle Relativitätstheorie
Eine Union von Raum und Zeit
Gekrümmte Raumzeit
Die Schwerkraft entspricht einer Beschleunigung
Das Äquivalenzprinzip
Warum ist der reisende Zwilling jünger?
Paradoxien der speziellen Relativitätstheorie
Die Entwicklung der Sterne
Masse und Energie
Wo die Raumzeit einfach endet
Schwarze Löcher und Wurmlöcher
Die Grenze des bekannten Universums
Entdeckung anderer Galaxien
Die Zukunft des Universums
Statisches oder expandierendes Universum?
Das kosmische Ei, das im Moment der Entstehung explodiert
Der Urknall
Es gibt nicht nur sichtbare Materie
Dunkle Materie
Ein unbekannter Bestandteil dominiert das Universum
Dunkle Energie
Fäden in einem Wandteppich
Die Stringtheorie
Kräuselungen der Raumzeit
Gravitationswellen
WEITERE PHYSIKER
GLOSSAR
ZITATNACHWEIS
DANK
VORWORT
Ich habe mich als kleiner Junge in die Physik verliebt, als ich entdeckte, dass sie die besten Antworten auf viele der Fragen gab, die ich über die Welt um mich herum hatte – wie ein Magnet funktioniert, ob der Weltraum ewig weitergeht, warum Regenbögen entstehen und woher wir wissen, wie das Innere eines Atoms oder das Innere eines Sterns aussieht. Mir wurde auch klar, dass ich mit Physik einige der tieferen Fragen, die mir im Kopf herumschwirrten, in den Griff bekommen konnte, etwa: Was ist eigentlich Zeit? Wie ist es, in ein Schwarzes Loch zu fallen? Wie hat das Universum begonnen, und wie könnte es enden?
Jetzt, Jahrzehnte später, habe ich Antworten auf einige meiner Fragen, aber ich suche immer noch Antworten auf neue Fragen. Wie Sie sehen, ist die Physik lebendig. Obwohl es vieles gibt, was wir heute zu den Naturgesetzen sicher wissen, und obwohl wir mit diesem Wissen weltverändernde Technologien entwickelt haben, gibt es noch etliches, was wir nicht wissen. Das macht für mich die Physik zum Spannendsten überhaupt. Tatsächlich frage ich mich manchmal, warum nicht jeder so verliebt in die Physik ist wie ich.
Aber ein Thema lebendig zu machen, dieses Gefühl des Staunens zu vermitteln, das erfordert viel mehr als nur einen Berg trockener Fakten. Um zu erklären, wie unsere Welt funktioniert, müssen wir Geschichten erzählen. Wir müssen uns klar werden, wie wir zu dem gekommen sind, was wir über das Universum wissen; wir müssen die Entdeckerfreude der vielen großen Wissenschaftler erleben, die als Erste die Geheimnisse der Natur entschlüsselt haben. Der Weg zu unserem heutigen Weltverständnis kann genauso wichtig und erfreulich sein wie das Wissen selbst.
Aus diesem Grund hat mich schon immer die Geschichte der Physik fasziniert. Es ist schade, dass wir in der Schule oft nicht erfahren, wie Konzepte und Ideen in der Wissenschaft entstanden sind. Es wird von uns erwartet, dass wir sie fraglos akzeptieren. Aber so ist die Physik nicht, so ist die gesamte Wissenschaft nicht. Wir fragen uns, wie die Welt funktioniert, und wir entwickeln Theorien und Hypothesen. Gleichzeitig machen wir Beobachtungen und führen Experimente durch, revidieren und verbessern das, was wir wissen. Oft liegen wir daneben oder entdecken erst nach Jahren, dass eine bestimmte Beschreibung oder Theorie falsch ist oder sich der Realität höchstens annähert. Und manchmal gibt es schockierende neue Entdeckungen, die uns zwingen, unsere Sicht völlig zu verändern.
Ein schönes Beispiel dafür, das ich selbst erlebt habe, war 1998 die Entdeckung, dass sich das Universum immer schneller ausdehnt, was zu der Idee der sogenannten Dunklen Energie führt. Noch vor Kurzem galt dies als ein völliges Rätsel. Was war das für ein unsichtbares Feld, das den Raum gegen die Anziehungskraft der Schwerkraft ausdehnte? Erst allmählich erfahren wir, dass es sich dabei wohl um etwas handelt, das man Vakuumenergie nennt. Sie fragen sich vielleicht, wie eine geänderte Bezeichnung (von »Dunkler Energie« zu »Vakuumenergie«) einen Fortschritt darstellen kann. Aber das Konzept der Vakuumenergie ist nicht neu. Einstein hatte es vor hundert Jahren aufgebracht, aber später änderte er seine Meinung, als er glaubte, einen Fehler gemacht zu haben, und nannte es seine »größte Eselei«. Es sind Geschichten wie diese, die für mich die Physik so spannend machen.
Und deswegen ist Das Physik-Buch auch so unterhaltsam. Jedes Thema wird mit der Einführung von Schlüsselfiguren, mit faszinierenden Anekdoten und einer Zeitleiste der Ideenentwicklung zugänglich und lesbar gemacht. Dies zeigt nicht nur ehrlicher, wie die Wissenschaft voranschreitet, es ist auch ein guter Weg, das Thema mit Leben zu füllen.
Ich hoffe, das Buch gefällt Ihnen ebenso gut wie mir.
Jim Al-Khalili
EINLEITUNG
Wir Menschen nehmen unsere Umgebung in besonderem Maße wahr. Um in der Evolution stärkeren und schnelleren Raubtieren zu entgehen, mussten wir das Verhalten unserer Umwelt vorhersehen. Mittels Sprache konnten wir unseren Erfahrungsschatz über Generationen weitergeben, und die kognitiven Fähigkeiten sowie der Werkzeuggebrauch brachten unsere Art an die Spitze der Nahrungskette.
Vor rund 60 000 Jahren haben wir uns von Afrika aus über die Welt verbreitet und konnten durch Einfallsreichtum auch in unwirtlichen Gegenden überleben. Unsere Vorfahren entwickelten Techniken, um genügend Nahrung für sich und ihre Nächsten anzubauen, und siedelten sich in Gemeinschaften an.
Experimentelle Verfahren
Die frühen Gesellschaften sahen in unzusammenhängenden Ereignissen eine tiefere Bedeutung, fanden Muster, die es nicht gab, und erklärten sie anhand von Mythen. Sie entwickelten aber auch neue Werkzeuge und Arbeitsmethoden, für die man das Wissen über innere Zusammenhänge der Welt benötigte, etwa die Jahreszeiten oder das jährliche Nilhochwasser, um Ressourcen zu erschließen. In manchen Regionen der Erde herrschte längere Zeit Frieden. Dort konnten einige Menschen es sich leisten, über unseren Platz im Universum nachzudenken. Erst die Griechen, dann die Römer versuchten die Welt anhand der Muster, die sie in der Natur erkannten, zu deuten. Thales von Milet, Sokrates, Platon, Aristoteles und andere verwarfen die übernatürlichen Erklärungen; sie suchten rationale Antworten – und begannen zu experimentieren.
Mit dem Untergang des Römischen Reiches gingen viele dieser Ideen für das Abendland verloren. Doch in der arabischen Welt und in Indien erblühten sie neu. Gelehrte dort fragten und experimentierten weiter. Man erfand die Sprache der Mathematik, um dieses neu gewonnene Wissen zu überliefern. Ibn al-Haitham und ibn Sahl waren nur zwei dieser arabischen Gelehrten im 10. und 11. Jahrhundert, ihre Entdeckungen zu Optik und Astronomie fanden jedoch außerhalb der islamischen Welt jahrhundertelang keine Beachtung.
Eine Ära der neuen Ideen
Auf globalen Handels- und Entdeckungsreisen wurden auch Ideen ausgetauscht. Händler und Seefahrer brachten Bücher, Geschichten und technische Wunderwerke von Ost nach West. Die Gedankenwelt aus diesem Kulturreichtum ließ Europa das Mittelalter überwinden und führte es in ein neues Zeitalter der Aufklärung, die Renaissance. Eine Revolution unserer Weltsicht begann, als die Vorstellungen der Alten überarbeitet wurden oder aus der Mode gerieten. Sie wurden ersetzt durch neue Ideen über unsere Stellung im Universum. Eine neue Generation von Experimentatoren wollte der Natur ihre Geheimnisse entlocken. In Italien und Polen stellten Kopernikus und Galileo Ideen infrage, die für zwei Jahrtausende als sakrosankt gegolten hatten – und wurden dafür verfolgt.
Im 17. Jahrhundert dann bildeten die Bewegungsgesetze von Isaac Newton die Grundlage der klassischen Physik, die für über zwei Jahrhunderte unangefochten blieb. Das Verständnis der Bewegungen erlaubte die Konstruktion von Maschinen, die Energie in vielerlei Form für die Arbeit nutzbar machten. Am bedeutendsten waren Wasserräder und Dampfmaschinen – sie leiteten die industrielle Revolution ein.
»Wer die Werke der Wissenschaft studiert, muss … die Prüfungen und Erklärungen genauestens untersuchen.«
Ibn al-Haitham
Die Entwicklung der Physik
Im 19. Jahrhundert wurden die Ergebnisse der Experimente von einem internationalen Forschernetz nachvollzogen und überprüft. Die Forscher teilten ihre Erkenntnisse in Aufsätzen und erklärten die beobachteten Muster in der Sprache der Mathematik. Andere entwarfen Modelle zur Erklärung der empirischen Zusammenhänge. Die Modelle machten Vorhersagen zum Verhalten der Natur, und diese wurden von neuen Experimentatoren überprüft. Stellten sich die Vorhersagen als korrekt heraus, dann hielt man das Modell für ein Gesetz, dem die Natur zu gehorchen schien. Der französische Physiker Sadi Carnot und andere untersuchten den Zusammenhang von Wärme und Energie – sie begründeten damit das neue Gebiet der Thermodynamik. Die Gleichungen des britischen Physikers James Clerk Maxwell beschrieben den engen Zusammenhang von Elektrizität und Magnetismus als Elektromagnetismus.
Um 1900 schien es, als sei alles in der Physik bekannt und es seien nur noch ein paar Lücken zu stopfen. Doch im ersten Jahrzehnt des neuen Jahrhunderts erschütterte eine Reihe von Entdeckungen die wissenschaftliche Welt, stellte frühere Gewissheiten infrage und gebar die moderne Physik. Max Planck enthüllte die Welt der Quantenphysik. Albert Einstein entwickelte die Relativitätstheorie. Andere entdeckten den Aufbau des Atoms und erkannten die Rolle noch kleinerer, subatomarer Teilchen. Damit legten sie die Grundlagen der Teilchenphysik. Die neuen Entdeckungen waren jedoch nicht auf den Mikrokosmos beschränkt – fortschrittliche Teleskope erschlossen die Erkundung des Alls.
Binnen weniger Generationen lebte die Menschheit nicht mehr im Zentrum des Universums, sondern auf einem Staubkorn am Rand einer von Milliarden Galaxien. Wir hatten nicht nur ins Innere der Materie geschaut und die innewohnende Energie freigesetzt, sondern auch die Weiten des Alls mit dem Licht von kurz nach dem Urknall erkundet.
»Man kann nur in Ehrfurcht nachdenken über die Geheimnisse der Ewigkeit, des Lebens und des großartigen Aufbaus der Realität.«
Albert Einstein
Die Physik hat sich mit der Zeit als Wissenschaft entwickelt. Mit jeder neuen Entdeckung verzweigt sie sich mehr und öffnet neue Horizonte. Die Hauptgebiete liegen heute an den Rändern unserer Welt, auf Skalen der Galaxien und unterhalb der Atome. Die moderne Physik hat Anwendungen in vielen anderen Gebieten, darunter neue Technologien, Chemie, Biologie und Astronomie. Dieses Buch stellt die wichtigsten Ideen der Physik vor; es beginnt mit dem Alltag und der Antike, geht dann über die klassische Physik bis zur Welt des Allerkleinsten und endet mit den unendlichen Weiten des Alls.
MESSUNG UND BEWEGUNG
PHYSIK UND DIE ALLTAGSWELT
3000 V. CHR.
Die Ägypter messen Strecken und Ackerflächen mit der Elle.
3. JH. V. CHR.
Der griechische Philosoph Euklid schreibt die Elemente, eines der wichtigsten Bücher über Geometrie und Mathematik.
1543
Der polnische Astronom Nikolaus Kopernikus schreibt De Revolutionibus orbium coelestium (Über die Drehungen der himmlischen Sphären). Damit beginnt die wissenschaftliche Revolution.
1656
Der niederländische Physiker Christiaan Huygens erfindet die Pendeluhr, die erstmals die genaue Messung von Bewegungen erlaubt.
4. JH. V. CHR.
Aristoteles entwirft die wissenschaftliche Methode: Man schließt aus Beobachtungen (»Induktion«) und verallgemeinert sie (»Deduktion«).
1361
Der französische Philosoph und Theologe Nikolaus von Oresme wendet erstmals mathematische Konzepte auf naturwissenschaftliche Erscheinungen an.
1603
Galileo Galilei zeigt, dass Kugeln auf einer schiefen Ebene ungeachtet ihrer Masse gleich beschleunigt werden.
1668
Der englische Pfarrer John Wallis weist darauf hin, dass der Impuls (Produkt von Masse und Geschwindigkeit) bei Stößen erhalten bleibt.
1687
Isaac Newton revolutioniert mit den Principia unser Verständnis, wie Körper sich im Himmel und auf der Erde bewegen.
1752
Die Kreiselgesetze des Schweizers Leonhard Euler definieren den linearen Impuls und die Änderung des Drehimpulses.
1845
Versuche des britischen Physikers James Joule zeigen, dass man bei der Umwandlung von Energie in eine andere Form keine Energie gewinnt oder verliert.
1663
Nach dem Gesetz des französischen Physikers Blaise Pascal verteilt sich der Druck in einer Flüssigkeit in einem Gefäß gleichmäßig.
1670
Der französische Astronom und Mathematiker Gabriel Mouton schlägt ein dezimal unterteiltes Einheitensystem vor.
1740
Die französische Mathematikerin Émilie du Châtelet berechnet die kinetische Energie von bewegten Körpern.
1788
Die Gleichungen des französischen Physikers Joseph-Louis Lagrange vereinfachen die Berechnung von Bewegungen.
2019
Die Einheiten des SI werden neu definiert und hängen nur noch von Naturkonstanten ab.
Unsere Überlebensinstinkte haben dazu geführt, dass wir uns ständig vergleichen. Die ursprünglichen Instinkte im uralten Kampf ums Überleben – den richtigen Partner für die Fortpflanzung zu finden und genug Nahrung für die Familie zu beschaffen – entwickelten sich mit der Zeit zu modernen Äquivalenten wie Reichtum und Macht. Immerfort müssen wir uns, andere und die Welt vergleichen und messen. Einige dieser Maße sind interpretativ wie Persönlichkeitsmerkmale und Gefühle. Andere sind absolut – etwa Körpergröße, Gewicht und Alter.
Seit der Antike ist Reichtum für viele Menschen ein Maß für den Erfolg. Um Geld anzuhäufen, wurde weltweit Handel betrieben. Händler kauften Waren billig an einem Ort, um sie woanders, wo diese knapp waren, teurer wieder zu verkaufen. Mit zunehmendem Handel begannen ihn die lokalen Herrscher zu besteuern und führten Standardpreise ein. Daher brauchte man nun Einheitsmaße, um ein Vergleichen zu ermöglichen.
Die Sprache für Messungen
Als ihnen klar wurde, dass die Erfahrungen jedes Einzelnen relativ sind, erdachten die alten Ägypter Methoden, um ohne inhaltliche Verzerrungen zu kommunizieren. Sie entwickelten so das erste Maßsystem. Mit der ägyptischen Elle war es den Baumeistern möglich, Bauten zu errichten, die für Jahrtausende unerreicht blieben, und den Bauern, ihre Felder so zu bestellen, dass die wachsende Bevölkerung versorgt wurde. Als die ganze damalige bekannte Welt mit dem antiken Ägypten handelte, entstand die Idee einer gemeinsamen Sprache für Messungen.
Die wissenschaftliche Revolution (1543–1700) zeigte erneut den Bedarf für solche Maßsysteme auf. Für die Forscher waren sie Hilfsmittel, um die Natur zu verstehen. Sie entwarfen kontrollierte Umgebungen, in denen sie prüfen konnten, wie verschiedenes Verhalten zusammenhing – sie führten Versuche durch. Die ersten Experimente befassten sich mit Bewegungen alltäglicher Gegenstände und hatten Bezug zum Alltagsleben. Die Forscher entdeckten bestimmte Muster in Bewegungen. Diese Muster wurden verewigt mithilfe der Sprache der Mathematik, einem Erbe der Antike und in der islamischen Welt für Jahrhunderte weiterentwickelt. Die Mathematik ermöglichte es, Versuchsergebnisse eindeutig zu beschreiben und weiterzugeben sowie Vorhersagen daraus mit neuen Versuchen zu überprüfen. Mit dieser gemeinsamen Sprache und den Maßen schritt die Wissenschaft voran. Die ersten Forscher entdeckten Verbindungen zwischen Entfernung, Zeit und Geschwindigkeit und legten ihre eigene, von anderen wiederhol- und überprüfbare Erklärung für Naturphänomene vor.
Bewegung messen
Die wissenschaftlichen Theorien entwickelten sich rasch weiter, und mit ihnen änderte sich die Sprache der Mathematik. Bei der Formulierung seiner Bewegungsgesetze erfand der englische Physiker Isaac Newton die Infinitesimalrechnung, mit der man auch zeitliche Entwicklungen eines Systems beschreiben konnte, nicht nur einzelne Schnappschüsse. Um die Beschleunigung fallender Körper und die Natur der Wärme zu erklären, tauchte auch die bis dahin unbekannte Größe Energie auf. Damit ließ sich unsere Welt nicht mehr nur durch Strecken, Zeit und Masse beschreiben, man brauchte neue Maße zur Bestimmung der Energie.
Forscher brauchen Maße zur Weitergabe ihrer Versuchsergebnisse. Maße sind die eindeutige Sprache, mit der Forscher Ergebnisse interpretieren und Versuche wiederholen können, um zu prüfen, ob ihre Schlüsse korrekt sind. Heute wird das Internationale Einheitensystem (SI, nach der französischen Bezeichnung Système International) verwendet. Der Wert eines jeden Maßes und seine Beziehung zur Welt um uns ist von einer internationalen Gruppe von Forschern, den Metrologen, genau definiert.
Dieses erste Kapitel schildert die ersten Jahre der Wissenschaft, die wir heute Physik nennen, die Art und Weise ihres Vorgehens mittels Experimenten und wie die Versuchsergebnisse weltweit diskutiert werden. Von den fallenden Körpern, mit denen der italienische Forscher Galileo Galilei die Beschleunigung untersuchte, bis zu den schwingenden Pendeln, die den Weg zur exakten Zeitmessung bereiteten, ist dies die Geschichte, wie Forscher Strecken, Zeit, Energie und Bewegung gemessen haben und damit unser Verständnis der Welt revolutionierten.
DER MENSCH IST DAS MASS ALLER DINGE
LÄNGEN MESSEN
IM KONTEXT
SCHLÜSSELKULTUR
Altes Ägypten
FRÜHER
um 3500 v. Chr. In Mesopotamien gibt es ein System zur Messung der Feldergröße.
um 3100 v. Chr. In Ägypten nutzt man Schnüre mit regelmäßig geknüpften Knoten zum Messen der Felder und zur Bauüberwachung.
SPÄTER
1585 Der Niederländer Simon Stevin schlägt ein dezimales Maßsystem vor.
1799 Die französische Regierung führt den Meter ein.
1875 Mit der Meterkonvention führen 17 Staaten ein konsistentes Einheitensystem ein.
1960 Auf der 11. Generalkonferenz zu Maßen und Gewicht wird das metrische System zum Internationalen Einheitensystem (SI, Französisch Système International).
Als der Mensch begann, komplexe Bauwerke aufzubauen, brauchte er die Möglichkeit, Längen und Höhen zu messen. Die ersten Messgeräte waren wohl einfache Holzstecken mit Kerben; allerdings gab es keine verbindliche Längeneinheit. Als erste Einheit verbreitete sich im 4. und 3. Jahrtausend v. Chr. unter den Völkern in Ägypten, Mesopotamien und dem Industal die Elle. Sie bezeichnet die Länge vom Ellbogen bis zur Spitze des ausgestreckten Mittelfingers. Natürlich ist diese Länge nicht bei jedem Menschen gleich lang, sie war also nur näherungsweise festgelegt.
Die ägyptische Königliche Elle war so lang wie der Unterarm zwischen Ellbogen und Spitze des Mittelfingers. Die Elle wurde in 28 Djeba (Finger) unterteilt, daneben gab es eine Reihe weiterer Zwischenmaße wie Schesep (Handbreit) und Amem (Faust).
Königliche Maße
Als Architekten und Baumeister von erstaunlichen Bauwerken brauchten die alten Ägypter eine verbindliche Längeneinheit. Die Königliche Elle (Meh) des Alten Reichs im antiken Ägypten ist die erste standardisierte Elle der Welt. Sie war seit 2700 v. Chr. in Gebrauch und maß 523–529 mm, unterteilt in 28 Djeba (Finger), die jeweils einen Finger breit (19 mm) waren.
Bei archäologischen Grabungen in den Pyramiden hat man Ellenstäbe aus Holz, Schiefer, Basalt und Bronze gefunden, die als Maßstäbe für Handwerker und Architekten genutzt wurden. Die Cheops-Pyramide bei Gizeh, in deren Grabkammer man einen Ellenstab gefunden hat, war 280 Ellen hoch und hatte eine Grundfläche von 440 Ellen im Quadrat. Die Ägypter unterteilten die Elle in Schesep (Handbreit, 4 Djeba), Amem (Faust, 6 Djeba), Pedj-scherer und Pedj-aa (Kleine und Große Spanne, 12 bzw. 14 Djeba) und Djeser (Vier Handbreit, 16 Djeba). Das Chet (100 Ellen, etwa 52,4 m) wurde zur Feldmessung, das Iteru (Königliche Meile, 20 000 Ellen bzw. 10,5 km) für Langstrecken verwendet.
Ellenstäbe wie dieses Exemplar aus der 18. Dynastie im alten Ägypten (14. Jh. v. Chr.) dienten dazu, im ganzen Reich einheitliche Messungen zu gewährleisten.
Im ganzen Nahen Osten waren Ellen verschiedener Länge gebräuchlich. Die Assyrer entwickelten sie um 700 v. Chr., die hebräische Bibel verweist an zahlreichen Stellen auf Ellen, besonders im Buch Exodus (2. Buch Mose) bei der Konstruktion der Stiftshütte, der »Wohnung« für die Zehn Gebote. Die alten Griechen hatten ihre eigene, 24-fach unterteilte Elle und als Streckenmaß das Stadion entsprechend 300 Ellen. Im 3. Jahrhundert v. Chr. schätzte der griechische Gelehrte Eratosthenes (um 276–194 v. Chr.) den Erdumfang mit 250 000 Stadien ab, später verbesserte er seinen Wert auf 252 000 Stadien. Auch die Römer übernahmen die Elle, zusammen mit Zoll (die Daumenbreite eines Mannes), Fuß und Meile. Die Römische Meile hatte 1000 Schritt (mille passus), jeder 5 Römische Fuß lang. Durch die Expansion des Römischen Reiches ab dem 3. Jahrhundert v. Chr. verbreiteten sich diese Einheiten in großen Teilen Westasiens und Europas, einschließlich England, wo Königin Elizabeth I. 1593 die Meile mit 5280 Fuß neu definierte.
»Du sollst auch Bretter machen zu der Wohnung von Akazienholz, die stehen sollen. Zehn Ellen lang soll ein Brett sein und anderthalb Ellen breit«
Exodus (2. Buch Mose) 26, 15–16Luther-Bibel 1912
Metrische Einheiten
1585 schlug der flämische Physiker Simon Stevin in seinem Traktat De Thiende (Das Zehntel) ein dezimales Maßsystem vor und sagte, dass es sich irgendwann weithin durchsetzen würde. Gut zwei Jahrhunderte später begann ein Komitee der französischen Akademie der Wissenschaften mit der Arbeit an dem metrischen System. Es definierte den Meter als zehnmillionstel Teil des Abstands vom Erdäquator zum Nordpol. 1799 übernahm Frankreich als erstes Land dieses System.
Weltweit verbindlich wurde das System erst 1960 mit dem Internationalen Einheitensystem (Système International, SI) mit dem Meter als Grundeinheit der Längen. 1 Meter (m) sind demnach 1000 Millimeter (mm) oder 100 Zentimeter (cm), und 1000 m sind 1 Kilometer (km).
»Eine Meile sind acht Furlong (»Furchen«), jeder Furlong sind vierzig Pole (»Ruten«), und jeder Pole sechzehneinhalb Foot (»Fuß«).«
Königin Elizabeth I.
Geänderte Definitionen
1668 folgte der englische Pfarrer John Wilkins dem Vorschlag Stevins einer dezimal geteilten Längeneinheit mit einer neuen Definition: Das Grundmaß sollte die Länge eines Pendels mit einer Schwingungsdauer von zwei Sekunden sein. Nach Berechnungen des niederländischen Physikers Christiaan Huygens beträgt diese Länge 997 mm.
1889 wurde ein Stab aus einer Legierung von 90 % Platin und 10% Iridium gegossen, der den Meter darstellen sollte, doch da seine Länge sich mit der Temperatur leicht änderte, war es nur am Gefrierpunkt genau. Dieser »Urmeter« wird noch heute im Internationalen Büro für Maß und Gewicht in Paris aufbewahrt. Als man 1960 die SI-Definitionen anpasste, wurde der Meter über die elektromagnetische Strahlung eines Kryptonatoms neu definiert. 1983 wurde diese Definition wieder geändert: Ein Meter war nun die Strecke, die das Licht im Vakuum in 1/299792458 Sekunden zurücklegt.
KLUG FRAGEN KÖNNEN IST DIE HALBE WEISHEIT
DIE WISSENSCHAFTLICHE METHODE
IM KONTEXT
SCHLÜSSELFIGUR
Aristoteles (um 384–322 v. Chr.)
FRÜHER
585 v. Chr. Der griechische Mathematiker und Philosoph Thales von Milet untersucht die Bewegungen von Sonne und Mond und sagt eine Sonnenfinsternis vorher.
SPÄTER
1543 Nikolaus Kopernikus’ De Revolutionibus orbium coelestium (Über die Drehungen der himmlischen Sphären) und Andreas Vesalius’ De humanis corporis fabrica (Über den Aufbau des menschlichen Körpers) beruhen auf genauen Beobachtungen und markieren den Beginn der wissenschaftlichen Revolution.
1620 Francis Bacon begründet den Induktivismus: Man verallgemeinert aufgrund genauer Beobachtungen.
Sorgfältiges Beobachten und das Hinterfragen der Ergebnisse sind zentral für die wissenschaftliche Methode, die der Physik und allen Naturwissenschaften zugrunde liegt. Da sich die Interpretation von Daten leicht durch Vorwissen und Annahmen verfälschen lässt, folgt die Methode festen Regeln: Aufgrund von Vorergebnissen stellt man eine Hypothese auf und überprüft sie im Versuch. Wenn die Hypothese versagt, kann man sie überarbeiten und neu prüfen; wenn sie sich bewährt, teilt man sie den Fachkollegen zur unabhängigen Überprüfung mit.
Seit jeher will der Mensch seine Umwelt begreifen. Nahrung zu finden und Wetteränderungen zu verstehen, war schon zu Urzeiten eine Sache von Leben und Tod. Oft erklärte man natürliche Phänomene mit Mythen oder glaubte, alles sei ein Geschenk der Götter.
Frühe Untersuchungen
Die ersten Hochkulturen – das antike Mesopotamien, Ägypten, Griechenland und China – waren so weit entwickelt, dass sie »Naturphilosophen« mittragen konnten: Denker, die die Welt interpretieren und ihre Überlegungen aufschreiben wollten. Als einer der Ersten lehnte der Grieche Thales von Milet übernatürliche Erklärungen von Naturphänomenen ab. Später führten die Philosophen Sokrates und Platon die Debatte und den Streit als Methode des Erkenntnisgewinns ein, doch erst Aristoteles – ein produktiver Erforscher der Physik, Biologie und Zoologie – begründete eine wissenschaftliche Untersuchungsmethode und wandte logische Schlüsse auf seine Beobachtungen an. Als Empiriker glaubte er, dass alles Wissen auf der Erfahrung durch die Sinne beruht und dass Überlegungen allein nicht reichen, um ein wissenschaftliches Problem zu lösen – man braucht Belege.
»Alle Wahrheiten sind leicht verständlich von dem Zeitpunkt an, wo sie aufgedeckt werden. Die Frage ist, ob sie aufgedeckt werden.«
Galileo Galilei
Auf seinen Reisen machte er detaillierte zoologische Beobachtungen und suchte Kriterien, um Lebewesen nach Verhalten und Anatomie einzuteilen. Er fuhr mit Fischern zur See, sammelte Fische und anderes Meeresgetier und sezierte sie. Nachdem er entdeckt hatte, dass Delfine Lungen haben, ordnete er sie bei den Walen ein, nicht bei den Fischen, und er unterschied vierbeinige Tiere, die lebende Junge gebären (Säugetiere) von denen, die Eier legen (Reptilien und Amphibien).
In anderen Gebieten jedoch hing Aristoteles den traditionellen Ansichten an, etwa der geozentrischen Vorstellung einer Erde, um die Sonne und Sterne kreisen. Im 3. Jahrhundert v. Chr. behauptete der Grieche Aristarch von Samos, dass die Erde und die bekannten Planeten die Sonne umkreisten, die Sterne sehr weit entfernte Gegenstücke zu »unserer« Sonne seien und dass die Erde sich um ihre Achse drehe. Obwohl diese Ideen richtig waren, wurden sie verworfen, da Aristoteles und sein Schüler Ptolemäus größere Autorität genossen. Die geozentrische Sicht des Universums galt lange als wahr – teils durch die katholische Kirche unter Hinweis auf die Bibel erzwungen –, bis sie durch Kopernikus, Galileo und Newton überwunden wurde.
Prüfen und beobachten
Der arabische Gelehrte ibn al-Haitham (im Westen bekannt als Alhazen) war ein früher Vertreter der wissenschaftlichen Methode. Er lebte um 1000 n. Chr. und entwickelte eigene Versuchsmethoden, um Hypothesen zu belegen oder zu widerlegen. Er arbeitete hauptsächlich zur Optik, leistete aber auch wichtige Beiträge zu Astronomie und Mathematik. So bewies er beispielsweise die Hypothese, dass jeder Punkt eines leuchtenden Körpers Licht geradlinig in jede Richtung abstrahlt.
Leider drangen al-Haithams Methoden nicht über die islamische Welt hinaus, und erst 500 Jahre später, während der wissenschaftlichen Revolution, tauchte ein ähnlicher Ansatz in Europa auf. Doch die Ansicht, dass man althergebrachte Theorien infrage stellen und verwerfen kann, wenn man eine Alternative beweisen kann, war im Europa des 16. Jahrhunderts nicht weit verbreitet. Die kirchlichen Autoritäten lehnten viele wissenschaftliche Ideen wie die des Astronomen Nikolaus Kopernikus ab. Akribisch und mit bloßem Auge beobachtete er den Nachthimmel und erklärte die scheinbare retrograde (»rückwärtige«) Bewegung der Planeten, zu der der Geozentrismus nie hatte etwas sagen können. Nach Kopernikus kam dieser Effekt dadurch zustande, dass die Erde und die anderen Planeten auf unterschiedlichen Bahnen um die Sonne kreisen. Obwohl Kopernikus den Heliozentrismus (Sonne im Mittelpunkt) noch nicht beweisen konnte, weist ihn das Verwenden rationaler Überlegungen, um alte Ansichten infrage zu stellen, als wahren Wissenschaftler aus. Etwa zur selben Zeit, 1543, wandelte der flämische Anatom Andreas Vesalius mit seinem mehrbändigen Werk zum menschlichen Körper das medizinische Denken. So wie Kopernikus seine Theorien auf genauen Beobachtungen stützte, analysierte Vesalius seine Befunde beim Sezieren menschlicher Körperteile.
Im heliozentrischen Modell des Kopernikus steht die Sonne (griechisch helios) im Mittelpunkt der Planetenbahnen. Die Kirche verbot dieses Modell und ächtete seine Verfechter.
Vesalius’ anatomische Darstellungen von 1543 setzten neue Maßstäbe für die Studien des menschlichen Körpers, die seit dem griechischen Arzt Galen (129–216 n. Chr.) unverändert war.
»Wenn jemand mit Gewissheiten beginnen will, wird er in Zweifeln enden. Wenn er sich aber bescheidet, mit Zweifeln anzufangen, wird er zu Gewissheiten gelangen.«
Francis Bacon
Der experimentelle Ansatz
Für den italienischen Gelehrten Galileo Galilei war der Versuch zentral für den wissenschaftlichen Zugang. Er zeichnete seine Beobachtungen sorgfältig auf – zur Planetenbewegung, zum Schwingen von Pendeln und zur Geschwindigkeit fallender Körper. Er stellte Theorien zur Erklärung auf und testete sie in Versuchen. Mit einem damals neuartigen Teleskop untersuchte er vier der Jupitermonde und bewies damit das heliozentrische Modell des Kopernikus – im Geozentrismus kreisen alle Himmelskörper um die Erde. 1633 wurde Galilei von der Inquisition angeklagt und wegen Ketzerei zu Hausarrest verurteilt. Er veröffentlichte aber weiter und schmuggelte seine Schriften an der kirchlichen Zensur vorbei in die Niederlande.
Im späteren 17. Jahrhundert verfestigte der englische Philosoph Francis Bacon die Bedeutung eines methodischen, skeptischen Zugangs für wissenschaftliche Untersuchungen. Seiner Ansicht nach musste man für wahres Wissen Axiome und Gesetze auf Beobachtungen aufbauen und durfte nicht (auch nicht teilweise) auf ungeprüfte Schlüsse und Folgerungen setzen. Zum Bacon'schen Weg gehören Beobachtungen, um überprüfbare Fakten zu schaffen; Verallgemeinerung vieler Beobachtungen, um ein Axiom aufzustellen (das nennt man Induktivismus), allerdings keine Verallgemeinerung über die Fakten hinaus; das Sammeln weiterer Fakten, um die Wissensgrundlage zu verbreitern.
Unbewiesene Wissenschaft
Wenn wissenschaftliche Behauptungen nicht bewiesen werden können, sind sie nicht unbedingt falsch. 1997 behaupteten Forscher am Gran-Sasso-Labor in Italien, Belege für die Dunkle Materie gefunden zu haben, die bis zu 27 % des Universums ausmachen soll. Die wahrscheinlichste Quelle sollten schwach wechselwirkende schwere Teilchen (sogenannte WIMPs) sein. Man könne sie als winzige Lichtblitze (Szintillationen) nachweisen, die beim Aufprall des Teilchens auf den Kern des »Zielatoms« entstehen. Trotz aller Bemühungen anderer Forscher, das Experiment zu wiederholen, wurden keine weiteren Belege gefunden. Möglicherweise gibt es eine unbekannte Erklärung – oder die Szintillationen wurden durch Heliumatome erzeugt, die in den Photomultipliern im Experiment vorhanden sind.
Aristoteles
Aristoteles war Sohn des Leibarztes der makedonischen Königsfamilie und wurde nach dem frühen Tod seiner Eltern von einem Vormund aufgezogen. Mit etwa 17 Jahren trat er in Platons Akademie in Athen ein, die führende Lehranstalt Griechenlands. Zwei Jahrzehnte studierte und schrieb er dort zu Philosophie, Astronomie, Biologie, Chemie, Geologie und Physik sowie zu Politik, Poetik und Musik. Auf seinen Reisen nach Lesbos gelangen ihm bahnbrechende Beobachtungen der Tier- und Pflanzenwelt der Insel.
343 v. Chr. ernannte Philipp II. von Makedonien Aristoteles zum Erzieher seines Sohnes, dem späteren Alexander dem Großen. 335 v. Chr. gründete er am Lykeion bei Athen eine Schule, an der er viele seiner naturkundlichen Abhandlungen schrieb. Athen verließ er 322 v. Chr. und ließ sich auf Euböa nieder, wo er mit etwa 62 Jahren starb.
Hauptwerke
Metaphysik
Über den Himmel
Physik
Die wissenschaftliche Methode in der Praxis
Photo 51, ein 1952 aufgenommenes Röntgenstrukturbild menschlicher DNA. Die X-Form weist auf die Struktur der DNA – eine Doppelhelix – hin.
Die Desoxyribonukleinsäure (englische Abkürzung DNA) wurde 1944 als Träger der Erbinformation des Körpers erkannt. Chemisch besteht sie aus vier verschiedenen Bausteinen, den Nukleotiden. Es blieb aber unklar, wie die genetischen Informationen in der DNA gespeichert sind. Drei Forscher – Linus Pauling, Francis Crick und James Watson – vertraten die Hypothese, DNA habe einen helixartigen Aufbau (griechisch helix »Schraubenlinie«). Den Ergebnissen anderer Forscher zufolge musste DNA auf Röntgenstrukturbildern dann x-förmig sein. Ihre Kollegin Rosalind Franklin prüfte diese Hypothese und fertigte ab 1950 Röntgenstrukturaufnahmen von kristalliner DNA an. Nachdem sie die Technik zwei Jahre lang verbessert hatte, gelang ihr das nebenstehende »Photo 51«, das zeigte, dass die DNA wie eine Helix aufgebaut ist. Die Hypothese war damit bewiesen und bildete den Ausgangspunkt für weitere Untersuchungen.
ALLES IST ZAHL
DIE SPRACHE DER PHYSIK
IM KONTEXT
SCHLÜSSELFIGUR
Euklid von Alexandria (um 325–270 v. Chr.)
FRÜHER
3000–300 v. Chr. In Mesopotamien und Ägypten werden Zahlensysteme und Lösungsverfahren für mathematische Probleme entwickelt.
600–300 v. Chr. Griechische Gelehrte wie Pythagoras und Thales formalisieren die Mathematik mithilfe von Logik und Beweisen.
SPÄTER
um 820 n. Chr. Der persische Mathematiker Al-Chwarizmi schreibt die Prinzipien der Algebra nieder.
um 1670 Gottfried Wilhelm Leibniz und Isaac Newton entwickeln unabhängig voneinander die Infinitesimalrechnung zur Untersuchung von Veränderungen.
Die Physik will das Universum verstehen – durch Beobachtung und Experiment, durch Modelle und Theorien. All dies ist eng verbunden mit der Mathematik. Mathematik ist die Sprache der Physik – gebraucht beim Messen und der Datenanalyse in Experimenten, bei präzisen Ausdrücken für Theorien und bei der Beschreibung des grundlegenden »Bezugssystems«, in dem alle Materie existiert und Geschehnisse ablaufen. Die Untersuchung von Raum, Zeit, Materie und Energie ist nur möglich, wenn man zuvor Größe, Form, Symmetrie und Änderung verstanden hat.
Getrieben durch die Praxis
Die Geschichte der Mathematik ist eine der zunehmenden Abstraktion. Frühe Ideen zu Zahlen und Formen entwickelten sich mit der Zeit zur allgemeinsten und genauesten Sprache. In prähistorischer Zeit, vor der Entwicklung der Schrift, führte das Hüten der Tiere und der Handel mit Gütern zu ersten Zählungen und Strichlisten.
In den Hochkulturen des Nahen Ostens und Mittelamerikas stieg der Anspruch an Genauigkeit und Vorhersagen. Mit der Kenntnis astronomischer Zyklen und jahreszeitlicher Muster, etwa Überschwemmungen, war Macht verbunden. Landwirtschaft und Architektur brauchten genaue Kalender und Landvermessungen.
»Die Zahl ist das Wesen aller Dinge.«
Pythagoras
Die ersten Stellenwertsysteme (wo die Stellung einer Ziffer in einer Zahl ihren Wert anzeigt) und Wege zum Lösen von Gleichungen entstanden vor mehr als 3500 Jahren in Mesopotamien, Ägypten und (später) in Mittelamerika.
Logik und Analyse
Der Aufstieg des antiken Griechenlands brachte neue Themen. Zahlensysteme und Messungen waren nun nicht mehr nur einfache Hilfen, die griechischen Gelehrten studierten sie um ihrer selbst willen. Sie hatten zwar viele mathematische Erkenntnisse von früheren Kulturen übernommen, auch Teile des Satzes von Pythagoras, nun aber führten sie die strenge logische Argumentation und einen in der Philosophie wurzelnden Ansatz ein – das griechische philosophia heißt »Liebe zur Weisheit«.
Mit dem Teilungsparadoxon wollte Zeno zeigen, dass Bewegung logisch unmöglich ist. Bevor jemand eine Strecke gehen kann, muss er die halbe Strecke gehen, vor der halben Strecke muss er ein Viertel der Strecke gehen usw. Das Laufen einer beliebigen Strecke erfordert also eine unendliche Anzahl von Schritten, die man erst in unendlicher Zeit vollenden kann.
Die Idee von Satz (eine allgemeine Aussage, die immer und überall wahr ist) und Beweis (eine formale Erörterung mithilfe logischer Gesetze) taucht erstmals im frühen 6. Jahrhundert v. Chr. in der Geometrie des griechischen Philosophen Thales von Milet auf. Etwa zur selben Zeit waren für Pythagoras und seine Anhänger die Zahlen die Bausteine des Universums.
Für die Pythagoräer mussten Zahlen »kommensurabel« sein, d. h. im ganzzahligen Verhältnis zueinander stehen. Diese Weltsicht wurde erschüttert, als der pythagoräische Philosoph Hippasus die irrationalen Zahlen entdeckte (wie , die sich nicht exakt als Verhältnis zweier ganzer Zahlen darstellen lässt). Der Legende nach wurde er von seinen aufgebrachten Mitjüngern gesteinigt.
Titanen der Mathematik
Im 5. Jahrhundert v. Chr. entwickelte der griechische Philosoph Zeno von Elea Paradoxien zur Bewegung, wie das von Achilles und der Schildkröte. Solche logischen Widersprüche waren in der Praxis leicht zu lösen, aber sie fesselten Generationen von Mathematikern. Sie wurden, zumindest teilweise, erst im 17. Jahrhundert mit der Entwicklung der Infinitesimalrechnung gelöst, die sich mit kontinuierlich veränderten Größen befasst.
Zentral ist hier die Idee, das unendliche Kleine (das Infinitesimale) zu berechnen. Vorweggenommen wurde sie von Archimedes von Syrakus, der im 3. Jahrhundert v. Chr. lebte. Um das Volumen einer Kugel näherungsweise zu berechnen, halbierte er sie, umschloss die Halbkugel mit einem Zylinder und stellte sich vor, diesen horizontal in Scheiben zu zerlegen – von der Oberseite der Halbkugel, wo der Radius infinitesimal klein ist, nach unten. Er wusste, dass das Ergebnis immer genauer würde, je dünner er die Scheiben machte. Archimedes ist bekannt für sein »Heureka!«, als er entdeckte, dass die Auftriebskraft eines Körpers im Wasser gleich der Gewichtskraft des Wassers ist, die der Körper verdrängt. Doch bekannt ist er auch dafür, dass er Mathematik auf die Mechanik und andere Gebiete der Physik anwandte und damit Probleme mit Hebeln, Schrauben, Rollen und Pumpen löste.
Archimedes studierte in Alexandria an einer Schule, die von Euklid, dem »Vater der Geometrie«, gegründet worden war. Euklid hatte die Grundlagen der Geometrie selbst untersucht und in seiner Abfolge von Behauptung und Beweis das Schema des mathematischen Denkens für die nächsten 2000 Jahre formuliert. In seinen Elementen führte er in 13 Büchern die »axiomatische Methode« für die Geometrie ein. Er definierte Begriffe wie »Punkt« und setzte fünf Axiome (d. h. selbstverständliche Wahrheiten) voraus, etwa: Zwischen zwei beliebigen Punkten kann eine Linie gezogen werden. Aus diesen Axiomen leitete er mit logischen Schlüssen Sätze ab. Aus heutiger Sicht sind Euklids Axiome mangelhaft; es gibt etliche Annahmen, die ein heutiger Mathematiker formal ausdrücken würde. Doch die Elemente bleiben ein wunderbares Werk, das nicht nur die ebene und die dreidimensionale Geometrie abdeckt, sondern auch Verhältnisse und Proportionen, Zahlentheorie und die »Inkommensurablen«, die Pythagoras abgelehnt hatte.
Griechische Philosophen zeichneten beim Geometrieunterricht ihre Figuren in den Sand. Archimedes soll Kreise im Sand gezogen haben, als ein römischer Soldat ihn tötete.
Sprache und Symbole
Im antiken Griechenland beschrieben und lösten die Gelehrten algebraische Probleme (d. h. die Berechnung unbekannter Größen, wenn einige Größen und Zusammenhänge bekannt sind) in Alltagssprache und mithilfe von Geometrie. Die äußerst knappe und präzise symbolische Sprache der modernen Physik, die sich besser zur Untersuchung von Problemen eignet und weltweit verstanden wird, ist weit jüngeren Datums. Um 250 v. Chr. jedoch führte der griechische Mathematiker Diophant von Alexandria in seinem Hauptwerk Arithmetica einige Symbole ein, um algebraische Probleme zu lösen. Das Buch beeinflusste die Entwicklung der arabischen Algebra nach dem Untergang des Römischen Reiches. Im Goldenen Zeitalter des Islam (vom 8. bis zum 14. Jahrhundert) erblühte die Algebra im Osten. Bagdad wurde zur Hauptstadt der Bildung. Hier konnten Mathematiker im »Haus der Weisheit« Übersetzungen der griechischen Bücher zur Geometrie und Zahlentheorie oder indische Werke zum Stellenwertsystem studieren. Im frühen 9. Jahrhundert stellte hier Muhammad ibn Musa Al-Chwarizmi seine Methoden zum Ausgleichen und Lösen von Gleichungen in dem Buch al-dschabr zusammen (aus diesem Titel wurde später das Wort »Algebra«). Er machte die indischen Zahlzeichen populär, die später zu den arabischen Zahlen wurden, beschrieb seine algebraischen Probleme aber noch in Worten.
In seiner Einführung in die Kunst der Analyse nutzte der französische Mathematiker François Viète 1591 erstmals Buchstaben als Symbole in Gleichungen. Nun konnten Mathematiker komplizierte Gleichungen kompakt aufschreiben, ohne Diagramme zu Hilfe zu nehmen. 1637 dann vereinte der französische Philosoph und Mathematiker René Descartes Algebra und Geometrie durch ein Koordinatensystem.
Islamische Gelehrte in einer von Bagdads großen Bibliotheken (Miniatur von Yahya ibn Mahmud al-Wasiti von 1237). Nach Bagdad kamen Gelehrte aus der ganzen islamischen Welt, die Persien, Ägypten, Arabien und Teile der iberischen Halbinsel umfasste.
» Die imaginären Zahlen sind ein wunderbarer Schatz des menschlichen Geistes, fast eine Amphibie zwischen Sein und Nichtsein. «
Gottfried Wilhelm Leibniz
Mehr abstrakte Zahlen
Über die Jahrtausende hatten die Mathematiker beim Versuch, verschiedene Probleme zu lösen, das Zahlensystem erweitert, von den einfachen ganzen Zahlen 1, 2, 3 … zu Brüchen und irrationalen Zahlen. Weitere Abstraktion brachten die Null und negative Zahlen. Im alten Zahlensystem war die Null nur ein Platzhalter, sodass man etwa 10 und 100 auseinanderhalten konnte. Etwa im 7. Jahrhundert n. Chr. wurden negative Zahlen zur Angabe von Schulden verwendet. 628 n. Chr. behandelte der indische Mathematiker Brahmagupta erstmals die negativen ganzen Zahlen beim Rechnen wie positive Zahlen. Doch in Europa betrachteten noch 1000 Jahre später manche Gelehrte negative Zahlen als inakzeptabel für die formale Lösung einer Gleichung.
» Eine neue, ungeheure und mächtige Sprache wurde entwickelt für künftige Analysen. Die Wahrheiten daraus lassen sich in der Praxis schneller und präziser für die Ziele der Menschheit nutzen.«
Ada Lovelace
Britische Mathematikerin und Computerpionierin
Die Differenzialrechnung untersucht zeitliche Änderungsraten, hier geometrisch als die Steigung einer Kurve dargestellt. Die Integralrechnung befasst sich mit gekrümmten Strecken, mit Flächen und Volumina, die durch gekrümmte Linien begrenzt sind.
Wie die negativen Zahlen erfuhren auch die komplexen Zahlen bis zum 18. Jahrhundert einigen Widerstand. Doch sie bedeuteten einen wichtigen mathematischen Fortschritt. Sie lösen nicht nur kubische Gleichungen, sondern – anders als reelle Zahlen – alle polynomen Gleichungen höherer Ordnung (bei denen zwei oder mehr Terme addiert werden und eine Variable in höheren Potenzen wie x4 oder x5 auftaucht). Komplexe Zahlen treten naturgemäß in vielen Zweigen der Physik auf, etwa in der Quantenmechanik und dem Elektromagnetismus.
Die Infinitesimalrechnung
Eine der für die Physik bedeutsamsten Entwicklungen waren die »infinitesimalen« Verfahren, um Kurven und Veränderungen zu untersuchen. Die alte griechische Methode der Exhaustion (die Bestimmung des Flächeninhalts durch Ausfüllen mit kleineren Polygonen) wurde verfeinert, um Flächen unter Kurven berechnen zu können. Daraus entwickelte sich die Integralrechnung. Im 17. Jahrhundert regte die Untersuchung von Tangenten durch den französischen Juristen Pierre de Fermat die Entwicklung der Differenzialrechnung an, bei der man Änderungsraten bestimmt.
Um 1670 erarbeiteten der englische Physiker Isaac Newton und der deutsche Philosoph Gottfried Wilhelm Leibniz unabhängig voneinander eine Theorie, in der Integral- und Differenzialrechnung zur »Analysis« oder Infinitesimalrechnung vereint werden. Die zugrunde liegende Idee ist, eine Kurve (eine sich ändernde Größe) mithilfe von vielen geraden Linien (einer Reihe verschiedener, fester Größen) anzunähern. Im theoretischen Grenzwert ist die Kurve gleich einer unendlichen Anzahl von infinitesimalen Näherungen.
Euklidische und nichteuklidische Geometrien
In der euklidischen Geometrie ist der Raum »flach«. Parallelen bleiben überall gleich weit voneinander entfernt und treffen sich nie.
In der hyperbolischen Geometrie von Bolyai und Lobatschewski ist eine Fläche sattelförmig. Geraden auf einer Fläche sind voneinander weg gekrümmt.
In der elliptischen Geometrie sind Flächen nach außen gekrümmt wie eine Kugel. Parallelen krümmen sich zueinander hin und schneiden sich schließlich.
Während des 18. und 19. Jahrhunderts explodierte die Anzahl der Anwendungen für die Analysis in der Physik. Physiker konnten nun dynamische (sich ändernde) Systeme präzise modellieren, von schwingenden Saiten bis zur Wärmediffusion. Das Werk des schottischen Physikers James Clerk Maxwell im 19. Jahrhundert beeinflusste die Vektorrechnung, die Phänomene beschreibt, die eine Größe und eine Richtung haben. Maxwell bahnte auch statistischen Verfahren zur Untersuchung einer großen Anzahl von Teilchen den Weg.
Nichteuklidische Geometrien
Das fünfte Axiom aus Euklids Elementen, das Parallelenpostulat, war schon in antiker Zeit umstritten. Nach diesem Axiom kann man durch eine Gerade und einen Punkt außerhalb der Geraden genau eine Parallele zu der Geraden zeichnen. Durch die Zeiten haben verschiedene Mathematiker vergeblich versucht, das Parallelenpostulat aus den anderen Axiomen herzuleiten. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts entwickelten der Ungar János Bolyai und der Russe Nikolaj Lobatschewski unabhängig voneinander eine Version der Geometrie (hyperbolische Geometrie), in der das fünfte Axiom nicht gilt und Parallelen sich nie treffen. Hier ist die Fläche nicht eben wie bei Euklid, sondern nach innen gekrümmt. Bei der elliptischen und sphärischen Geometrie (dort ist die Fläche nach außen gekrümmt) hingegen, ebenfalls im 19. Jahrhundert entwickelt, gibt es gar keine Parallelen, alle Geraden schneiden sich. Der deutsche Mathematiker Bernhard Riemann und viele andere formalisierten solche nichteuklidischen Geometrien. Einstein verwendete die Riemann‘sche Theorie für seine allgemeine Relativitätstheorie, in der die Masse die Raumzeit »krümmt«, sodass sie nichteuklidisch wird.
» Aus dem Nichts habe ich ein sonderbares neues Universum geschaffen. Alles, was ich dir zuvor geschickt habe, ist dagegen wie ein Kartenhaus im Vergleich zu einem Turm.«
János Bolyai
in einem Brief an seinen Vater
Abstrakte Algebra
Der Beginn des 19. Jahrhunderts brachte die Erforschung abstrakter Symmetrien, die auf den französischen jungen Mathematiker Évariste Galois zurückgeht. Er hatte 1830 bei der Untersuchung gewisser Symmetrien in den Lösungen polynomer Gleichungen eine Theorie abstrakter mathematischer Objekte entwickelt, sogenannter Gruppen. Damit codierte er verschiedene Arten der Symmetrie. Beispielsweise zeigen alle Quadrate dieselbe Spiegel- und Rotationssymmetrie und werden so mit einer bestimmten Gruppe verbunden. So zeigte Galois, dass es – anders als bei quadratischen Gleichungen (mit einer Variablen zur zweiten Potenz, x2, aber nicht höher) – keine allgemeine Formel zur Lösung von Polynomgleichungen zur fünften (mit Termen wie x5) oder zu noch höheren Potenzen gibt. Das war ein dramatisches Ergebnis: Er hatte bewiesen, dass es eine solche Formel nicht gibt.
In der Folgezeit veränderte sich die Algebra, sie untersuchte abstrakte Gruppen und ähnliche Objekte sowie die dadurch dargestellten Symmetrien. Im 20. Jahrhundert wurden Gruppen und Symmetrien entscheidend für die Beschreibung natürlicher Phänomene. 1915 fand die deutsche Mathematikerin Emmy Noether den Zusammenhang zwischen Symmetrien in Gleichungen und physikalischen Erhaltungssätzen, z. B. dem Energieerhaltungssatz. In den 1950er- und 1960er-Jahren entwickelten Physiker mithilfe der Gruppentheorie das Standardmodell der Teilchenphysik.
Ein Modell der Realität
Mathematik ist die abstrakte Untersuchung von Zahlen, Größen und Formen. Die Physik modelliert damit die Realität, drückt Theorien aus und sagt künftige Ergebnisse vorher – oft mit erstaunlicher Genauigkeit. So wurde der gyromagnetische Faktor des Elektrons – ein Maß für das Verhalten im elektromagnetischen Feld – zu 2,002 319 304 3616 berechnet, der experimentelle Wert liegt bei 2,002 319 304 3625 (weicht also um ein Billionstel ab).
Manche mathematische Modelle sind jahrhundertealt und benötigten nur kleinere Anpassungen. Beispielsweise ist das Modell des Sonnensystems, das Johannes Kepler 1619 entwickelte, nach einigen Verfeinerungen durch Newton und Einstein bis heute gültig. Die Physiker haben Ideen, die die Mathematiker entwickelten, zur Untersuchung von Mustern verwendet. Ein Beispiel ist die Anwendung der Gruppentheorie auf die moderne Quantenphysik. Es gibt auch Beispiele, wie mathematische Strukturen die Naturforscher antrieben. Als der britische Physiker Paul Dirac in seinen Gleichungen zum Verhalten des Elektrons doppelt so viele Lösungen fand wie erwartet, die alle der Relativitätstheorie und der Quantenmechanik genügten, postulierte er die Existenz eines Anti-Elektrons. Jahre später wurde es experimentell nachgewiesen.
Emmy Noether lehrte Algebra an der Universität Göttingen und wurde 1919 als erste Frau in Deutschland MathematikProfessorin. Als Jüdin wurde sie jedoch 1933 von den Nazis vertrieben. Sie starb 1935 mit 53 Jahren im amerikanischen Exil.
Während die Physik beschreibt, was im Universum »ist«, sind die Mathematiker uneins, ob ihre Wissenschaft sich mit der Natur und dem menschlichen Geist oder mit der abstrakten Manipulation von Symbolen befasst. In einer merkwürdigen historischen Wendung schlagen nun die Physiker, die sich mit der String-Theorie befassen, den Mathematikern revolutionäre Änderungen vor. Wie genau sich dadurch das Verhältnis von Mathematik, Physik und der »Realität« ändert, wird sich zeigen.
Euklid
Obwohl seine Elemente extrem einflussreich waren, ist über Euklids Leben nur wenig bekannt. Er wurde um 325 v. Chr. unter Pharao Ptolemäus I. geboren und starb um 270 v. Chr. Er lebte meist in Alexandria, damals ein wichtiges Zentrum der Gelehrsamkeit, könnte aber auch an Platons Akademie in Athen studiert haben.
In seinem Kommentar zu Euklid schreibt der griechische Philosoph Proklos im 5. Jh. n. Chr. (also etwa 700 Jahre später), Euklid habe die Sätze von Eudoxos, einem früheren griechischen Mathematiker, zusammengestellt und die Vorstellungen anderer Gelehrter »unwiderlegbar demonstriert«. Demnach sind die Sätze in den 13 Büchern von Euklids Elementen nicht von ihm, setzten aber für zwei Jahrtausende den Standard des Mathematikunterrichts. Die ältesten Drucke der Elemente stammen aus dem 15. Jh.
Hauptwerke
Elemente
Data
Optik
Phainomena
KÖRPER ERFAHREN KEINEN WIDERSTAND ALS DURCH DIE LUFT
DER FREIE FALL
IM KONTEXT
SCHLÜSSELFIGUR
Galileo Galilei (1564–1642)
FRÜHER
um 350 v. Chr. In seiner Physik erklärt Aristoteles die Schwere als eine Kraft, die einen Körper zu seinem »natürlichen Ort« ziehe – nach unten.
1576 Giuseppe Moletti schreibt, dass verschieden schwere Körper gleich schnell fallen.
SPÄTER
1651 Giovanni Riccioli und Francesco Grimaldi messen die Fallzeit fallender Körper und berechnen damit ihre Beschleunigung.
1687 In seinen Principia legt Isaac Newton die Gravitationstheorie dar.
1971 David Scott zeigt, dass ein Hammer und eine Feder auf dem Mond gleich schnell fallen.
Wenn auf einen bewegten Körper allein die Gravitation wirkt, befindet er sich im »freien Fall«. Ein Fallschirmspringer ist nicht im freien Fall – auf ihn wirkt ja der Luftwiderstand –, die Planeten bei ihrem Umlauf um die Sonne aber schon. Der antike griechische Philosoph Aristoteles glaubte, die Fallbewegung eines Körpers läge in »ihrer Natur« – sie würden sich eben nach unten bewegen, ihrem natürlichen Ort. Bis ins Mittelalter war es anerkannt, dass die Geschwindigkeit eines frei fallenden Körpers proportional zu seinem Gewicht ist. Wenn man also zwei Körper mit verschiedenem Gewicht gleichzeitig fallen lässt, dann wird der schwerere zuerst auf dem Boden ankommen. Nach Aristoteles sollten auch Form und Orientierung des Körpers seine Fallgeschwindigkeit bestimmen: Ein ungefaltetes Blatt Papier würde langsamer fallen als ein zusammengeknülltes.
Fallende Kugeln
Seinem Schüler und Biografen Vincenzo Viviani zufolge ließ der italienische Gelehrte Galileo Galilei zwischen 1589 und 1592 zwei Kugeln verschiedenen Gewichts vom Schiefen Turm von Pisa fallen, um Aristoteles’ Theorie zu prüfen. Obwohl das wohl eher ein Gedankenexperiment war und kein echter Versuch, soll Galilei entdeckt haben, dass die leichtere Kugel genauso schnell zu Boden fiel wie die schwerere. Dies widersprach der aristotelischen Ansicht, nach der ein schwerer Körper im freien Fall schneller zu Boden fällt als ein leichter – eine Ansicht, die schon zuvor von anderen Forschern angezweifelt worden war.
1576 hatte Guiseppe Moletti, Galileis Vorgänger am Mathematiklehrstuhl der Universität Padua, behauptet, dass Körper unterschiedlichen Gewichts, aber aus demselben Material, gleich schnell zu Boden fallen. Er glaubte auch, dass gleich große, aber aus verschiedenen Stoffen bestehende Körper gleich schnell fallen. Zehn Jahre später stiegen die niederländischen Forscher Simon Stevin und Jan Cornets de Groot in Delft 10 m hoch auf einen Kirchturm und ließen von dort zwei Bleikugeln, eine zehnmal größer und schwerer als die andere, herabfallen. Beide Kugeln schlugen gleichzeitig am Boden auf. Die uralte Theorie von schneller fallenden schweren Körpern wurde nach und nach widerlegt.
» Die Natur ist unerbittlich und unveränderlich, sie übertritt die ihr auferlegten Gesetze niemals […].«
Galileo Galilei
Eine andere Ansicht des Aristoteles – dass ein Körper im freien Fall mit konstanter Geschwindigkeit fällt – war schon früher angezweifelt worden. Um 1361 hatte der französische Gelehrte Nicole Oresme die Bewegung von Körpern untersucht. Demnach nimmt die Geschwindigkeit eines Körpers bei gleichmäßiger Beschleunigung direkt proportional zur Zeit zu, und die dabei zurückgelegte Strecke ist proportional zum Quadrat der Beschleunigungszeit. Es mag überraschen, dass Oresme die anerkannte aristotelische »Wahrheit« anzweifelte, die damals für die Kirche als unantastbar galt, war Oresme doch auch Bischof. Ob seine Untersuchungen die späteren Arbeiten von Galilei beeinflussten, ist nicht bekannt.
Kugeln auf Rampen
Ab 1603 begann Galilei damit, die Beschleunigung von Körpern im freien Fall zu untersuchen. Er glaubte nicht, dass sie mit konstanter Geschwindigkeit fallen, sondern dass sie im Fall beschleunigt würden – das Problem aber war, dies zu beweisen. Doch die Technik, solche Geschwindigkeiten genau zu messen, gab es einfach nicht. Galileis geniale Idee war es, die Geschwindigkeit auf einen messbaren Wert zu reduzieren, indem er statt eines fallenden Körpers eine Kugel nahm, die eine Rampe herabrollte. Die Zeit bestimmte er mit einer Wasseruhr – sie maß die Wassermenge, die in eine Urne strömte, während die Kugel rollte – und mit seinem Puls. Wenn er die Zeit des Rollens verdoppelte, so war der zurückgelegte Weg viermal so lang.
Um nichts dem Zufall zu überlassen, wiederholte Galilei den Versuch »ganze hundert Mal«, bis er eine Genauigkeit erreicht hatte, dass »die Abweichung zwischen zwei Beobachtungen nie mehr als »ein Zehntel eines Pulsschlags« betrug. Außerdem veränderte er die Neigung der Rampe: Machte er sie steiler, nahm die Beschleunigung gleichmäßig zu. Da Galileis Versuche nicht im Vakuum stattfanden, waren die Versuche natürlich fehlerbehaftet – die rollenden Kugeln erfuhren Luftwiderstand und die Rollreibung durch die Rampe. Trotzdem schloss Galilei, dass in einem Vakuum alle Körper – unabhängig von Form oder Gewicht – gleichförmig beschleunigt würden: Die Fallstrecke ist proportional zum Quadrat der Fallzeit.
Galilei führt in Anwesenheit von Don Giovanni de’ Medici sein Kugelexperiment zur Fallbeschleunigung vor (Fresco von Giuseppe Bezzuoli, Florenz, um 1841).
Wie groß ist die Fallbeschleunigung?
Trotz der Arbeiten Galileis war die Frage nach der Beschleunigung von frei fallenden Körpern noch Mitte des 17. Jahrhunderts umstritten. Von 1640 bis 1650 führten die Jesuiten Giovanni Battista Riccioli und Francesco Maria Grimaldi in Bologna verschiedene Untersuchungen durch. Entscheidend für ihren Erfolg waren Ricciolis Sekundenpendel zur Zeitmessung – damals das Genaueste, was es gab – und ein sehr hoher Turm. Die beiden Priester und ihre Helfer ließen schwere Körper von verschiedenen Ebenen des 98 m hohen Asinelli-Turms fallen und maßen ihre Fallzeit. Sie beschrieben ihr Vorgehen im Detail und wiederholten den Versuch etliche Male.
» Als Galilei seine Kugeln die schiefe Fläche mit einer von ihm gewählten Schwere herabrollen … ließ …, ging allen Naturforschern ein Licht auf.«
Immanuel Kant
» In Fragen der Wissenschaft ist die Autorität von Tausenden nicht so viel wert wie das bescheidene Nachdenken eines Einzelnen.«
Galileo Galilei
Leichtere Kugel
Schwerere Kugel
Galilei zeigte, dass Körper unterschiedlicher Masse gleichmäßig beschleunigt werden. Er maß die Zeit, die eine Kugel für eine bestimmte Strecke entlang einer schiefen Ebene benötigte, und konnte so die Beschleunigung berechnen. Die Fallstrecke war immer proportional zum Quadrat der Fallzeit.
Galileo Galilei
Galilei wurde 1564 als ältestes von sechs Kindern in Pisa geboren. Mit 16 begann er an der dortigen Universität Medizin zu studieren, doch seine Interessen weiteten sich, und ab 1589 war er Dozent für Mathematik, zuerst in Pisa, ab 1592 in Padua. Seine Beiträge zu Physik, Mathematik, Astronomie und Technik machen ihn zu einer der Schlüsselfiguren der wissenschaftlichen Revolution im Europa des 16. und 17. Jahrhunderts. Er erfand das erste Thermometer, verteidigte das heliozentrische Weltbild des Kopernikus und machte bedeutende Entdeckungen zur Gravitation. Da einige seiner Ideen der kirchlichen Lehre widersprachen, wurde er 1633 von der Römischen Inquisition als Ketzer verurteilt und stand bis zu seinem Tod 1642 unter Hausarrest.
Hauptwerke
1623Prüfer mit der Goldwaage (»Saggiatore«)
1632Dialog über die beiden hauptsächlichen Weltsysteme
1638Unterredungen und mathematische Demonstrationen über zwei neue Wissenszweige (»Discorsi«)
Hammer und Feder
1971 führte David Scott, Kommandant der Apollo-15-Mission, auf dem Mond ein Experiment zum freien Fall durch. Bei dieser vierten Mondmission konnten die Astronauten länger auf dem Mond bleiben als bei den vorigen Reisen, und es wurde erstmals ein Mondauto verwendet.
Apollo 15 legte auch mehr Wert auf wissenschaftliche Versuche als die Expeditionen zuvor. Am Ende des letzten Mondspaziergangs ließ Scott einen 1,3 kg schweren geologischen Hammer und eine Falkenfeder von 0,03 kg aus 1,6 m Höhe fallen. Im luftleeren Raum auf dem Mond ohne Luftwiderstand fiel die Feder mit derselben Geschwindigkeit zu Boden wie der schwere Hammer. Das Experiment wurde gefilmt, und Millionen Zuschauer wurden Zeuge, als damit Galileis Theorie, nach der alle Körper ungeachtet ihres Gewichts mit gleichmäßiger Beschleunigung fallen, endlich praktisch bestätigt wurde.
EINE NEUE MASCHINE ZUR VERVIELFACHUNG DER KRAFT
DRUCK
IM KONTEXT
SCHLÜSSELFIGUR
Blaise Pascal (1623–1662)
FRÜHER
1643 Der italienische Physiker Evangelista Torricelli zeigt mit einer Quecksilbersäule die Existenz eines Vakuums. Daraus wird später das Barometer entwickelt.
SPÄTER
1738 Der Schweizer Mathematiker Daniel Bernoulli sagt, dass die Energie in einem Fluid von Höhe, Druck und Bewegung abhängt.
1796 Der britische Erfinder Joseph Bramah erhält das Patent auf die erste hydraulische Presse.
1851 Der Mechaniker Richard Dudgeon erfindet den hydraulischen Wagenheber.
1906 Das US-Kriegsschiff Virginia erhält ein ölhydraulisches System zur Ausrichtung der Kanonen.
Bei der Untersuchung der mechanischen Eigenschaften von Flüssigkeiten (Hydraulik) machte der französische Mathematiker und Physiker Blaise Pascal eine Entdeckung, die später viele industrielle Vorgänge revolutionieren sollte: Übt man Druck auf einen beliebigen Teil der Flüssigkeit in einem geschlossenen Gefäß aus, so wird der Druck gleichmäßig auf jeden Teil der Flüssigkeit und der Behälterwandung übertragen. Heute spricht man vom Pascal'schen Gesetz.
Die Auswirkung
Demnach erzeugt der Druck auf einen Kolben an einem Ende eines flüssigkeitsgefüllen Zylinders einen gleichen Druckanstieg auf den Kolben am anderen Ende. Und: Wenn der Querschnitt des zweiten Kolbens doppelt so groß ist wie der des ersten, ist die Kraft dort doppelt so groß. Ein Gewicht von 1 kg auf dem kleinen Kolben kann also den großen Kolben 2 kg heben, und je größer das Verhältnis der Querschnitte ist, umso mehr Gewicht kann der große Kolben tragen.
Pascals Ergebnisse wurden erst 1663 veröffentlicht, im Jahr nach seinem Tod, doch bis heute wird die Bedienung von Maschinen damit wesentlich erleichtert. 1796 wandte Joseph Bramah das Pascal'sche Gesetz auf die Konstruktion einer hydraulischen Presse an, mit der man Papier, Stoffe und Stahl wesentlich effektiver glätten konnte als mit den alten Holzpressen.
Flüssigkeiten sind nicht komprimierbar und können in hydraulischen Systemen wie einer Hebebühne Kräfte übertragen. Eine kleine Kraft über einen langen Weg wird zu einer großen Kraft über einen kleinen Weg und kann sehr schwere Lasten heben.
BEWEGUNG BLEIBT ERHALTEN
DER IMPULS
IM KONTEXT
SCHLÜSSELFIGUR
John Wallis (1616–1703)
FRÜHER
1518 Der französische Naturphilosoph Jean Buridan beschreibt den »Impetus«, der später als Impuls gedeutet wird.
1644 In seinen Principia Philosophiae (Prinzipien der Philosophie) beschreibt René Descartes den Impuls als »Menge der Bewegung«.
SPÄTER
1687 Isaac Newton beschreibt in seinen dreibändigen Principia die Bewegungsgesetze.
1927 Laut dem deutschen theoretischen Physiker Werner Heisenberg kann man für subatomare Teilchen wie Elektronen den Impuls nur umso ungenauer bestimmen, je genauer der Ort bekannt ist, und umgekehrt.
Wenn zwei Körper zusammenstoßen, passieren mehrere Dinge. Sie ändern Geschwindigkeit und Richtung, und ihre Bewegungsenergie kann sich in Wärme oder Schall umwandeln.