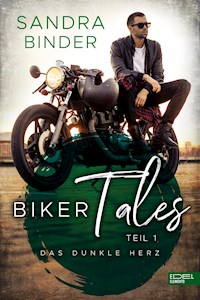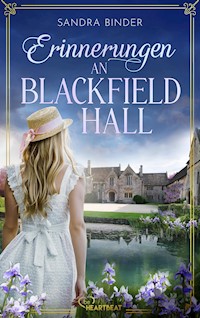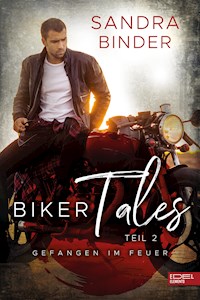
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Biker Tales
- Sprache: Deutsch
Der zweite Teil der "Biker Tales"-Reihe! Entgegen aller Vernunft hat sich Bea auf Charlie und den Motorradclub "Satan's Advocates" eingelassen - mit schwerwiegenden Folgen. Doch verhaftet zu werden, ist längst nicht das Schlimmste, was ihr passieren konnte. Als bei einer Ausfahrt auf Charlie und sie geschossen wird, erfährt Bea erst, dass der Club von einigen ehemaligen Mitgliedern bedroht wird. Dabei wollte Charlie doch offener zu ihr sein, ihr alles erzählen, sein Leben mit ihr teilen … Sagte er nicht, es würde ihr nichts geschehen? Er hatte es Bea sogar versprochen! An nichts anderes kann sie denken, als sie mitten in die Fehde hineingezogen wird und alles danach aussieht, als könnte Charlie dieses Versprechen nicht einhalten. Wie immer bei dieser Reihe gilt: Jeweils zwei Bände bilden eine Geschichte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 273
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kurzbeschreibung:
Der zweite Teil der »Biker Tales«-Reihe!
Nach einem dramatischen Beziehungsende muss Bea wieder einmal neu anfangen. Da sie noch dazu in finanziellen Schwierigkeiten steckt, hat sie keine andere Wahl, als zunächst von New York in das Provinzkaff Wolfville, Nevada, sprich, zu ihrer gleichgültigen, alkoholkranken Mutter zurückzukehren. Dort will sie nur so lange bleiben, bis sie einigermaßen auf die Beine gekommen ist, doch dann trifft sie auf einen alten Schulschwarm. Charlie erinnert noch immer an den Jungen von damals, ist aber inzwischen Vizepräsident des hiesigen Motorradclubs und Ärger steht ihm förmlich auf die Stirn geschrieben. Bea versucht, sich von dem Outlaw fernzuhalten und ihren Plan, Wolfville zu verlassen und ein besseres Leben zu führen, schnellstmöglich durchzuziehen. Sie scheitert jedoch kläglich an Charlies Anziehungskraft und den wieder aufkeimenden Gefühlen aus Schultagen. Schließlich lässt sie sich entgegen aller Vernunft auf ihn und den Club ein – mit schwerwiegenden Folgen ...
Sandra Binder
Biker Tales 2
Gefangen im Feuer
Roman
Edel Elements
Edel Elements
Ein Verlag der Edel Germany GmbH
© 2019 Edel Germany GmbHNeumühlen 17, 22763 Hamburg
www.edel.com
Copyright © 2019 by Sandra Binder
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Ashera Agentur
Covergestaltung: Marie Wölk, Wolkenart
Lektorat: Tatjana Weichel
Konvertierung: Datagrafix
Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des jeweiligen Rechteinhabers wiedergegeben werden.
ISBN: 978-3-96215-284-0
www.facebook.com/EdelElements/
www.edelelements.de/
Inhaltsverzeichnis
Prologue – Charlie
Chapter 10 – Behind Bars
Chapter 11 – Being Normal
Interlude – Scars
Chapter 12 – No More Lies
Chapter 13 – Respect
Interlude – Just a friend
Chapter 14 – In His World
Chapter 15 – Fuck Your World
Interlude – Crisis Meeting
Chapter 16 – Captured
Interlude – Support Your Local
Chapter 17 – The Blaze
Chapter 18 – Retaliation
Chapter 19 – Hellride Of A Love
Interlude – Lost Souls
Chapter 20 – The Truth About Me
Epilogue – Bea & Charlie
Prologue – Charlie
Wir alle treffen Entscheidungen. Jeden Tag. Manche sind leicht, andere kompliziert, und wieder andere bringen uns fast zum Verzweifeln. Aber das Schwierige ist nicht, sie zu fällen, sondern mit ihnen zu leben.
Niemand weiß, ob er die richtige Entscheidung getroffen hat oder nicht, denn wir sind gezwungen, das Leben vorwärts zu leben, obwohl es erst rückwärts Sinn ergibt.
Ich habe in meinem Leben viele Entscheidungen getroffen, und vielleicht waren einige davon falsch, das mag stimmen. Aber ich hatte niemals Angst davor, meinen eigenen Weg zu gehen. Im Gegenteil. Ich selbst zu sein und zu dem zu stehen, was ich tue, ist die einzige Möglichkeit für mich, dem Kerl im Spiegel morgens in die Augen zu sehen.
Angst … Das ist ein Gefühl, das ich mir schon als Kind abgewöhnen musste. Mein Adoptivvater sah es nicht nur als Schwäche an, er nutzte meine Ängste dazu, mich stets an der schmerzhaftesten Stelle zu treffen. ›Abhärten‹, nannte er das. Oder ›impfen‹.
Als Kind hatte ich fürchterliche Höhenangst. Ich kann mich noch genau daran erinnern, wie er mich bei unseren Wanderungen ohne Sicherung von den höchsten und gefährlichsten Felsen klettern ließ und mich verprügelte, wenn er danach nur eine Träne in meinen Augen schimmern sah.
»Schlappschwanz!«, brüllte er mich dann an. »Du willst ein Mann werden – dann heul nicht.«
Die Zeit mit Rektor Brown hätte einen Psychopathen aus mir machen müssen, doch stattdessen lernte ich, jedwede Scheiße zu ertragen und dabei ruhig zu bleiben. Ich lernte, förmlich aus meinem Körper zu gleiten, kurzzeitig nicht mehr da zu sein, und so die Furcht zu umgehen. Manchmal tue ich das heute noch. Aber es gibt Situationen, in denen die Angst stärker ist und diesen Schutzschild niederreißt.
Meine Erinnerung mag mich trügen, ich glaube jedoch, bisher nur zwei Mal in meinem Leben richtige Panik gehabt zu haben. Eine von denen, die dir den Magen umdrehen, dich gedanklich lähmen und dir klarmachen, dass du nur verlieren kannst, egal, was du jetzt tust.
Das erste Mal war es an dem Tag gewesen, an dem ich den Advocates meine Loyalität beweisen sollte. Damals war ich noch Prospect beim Vegas-Chapter und bekam die Aufgabe, unserem Pres die Kutte eines Bribons zu bringen. Das hieß so viel wie: Knall einen unserer Feinde ab, damit wir wissen, dass du weder zu ihnen noch zu den Cops gehörst.
Die Clubs lagen zu der Zeit noch im Clinch, und es war nicht leicht, unbemerkt in ihr Territorium einzudringen, aber ich war schon immer ein guter Planer. Ich wählte einen von ihnen aus, brachte in Erfahrung, wo er lebte, arbeitete und welchen Weg er zu seinem Clubhaus nahm. Ich wusste genau, wie ich es anstellen musste, ohne bemerkt zu werden, doch auch der beste Plan funktioniert nicht, wenn man sich nicht daran hält.
Mein Verstand hatte irgendwo auf dem Weg von Vegas nach Reno ausgesetzt, vermutlich auf Höhe Wolfville, denn ich fand mich urplötzlich im Haus meines Adoptivvaters wieder. Ich war den halben Weg zum oberen Stockwerk hinaufgegangen, ehe ich wie aus einem Traum erwachte und die Glock in meiner einen sowie das Messer in meiner anderen Hand beäugte. Ich erinnerte mich zwar nicht mehr, wie ich hergekommen war oder das Haus betreten hatte, aber eines wusste ich in diesem Moment mit absoluter, schreckensklarer Sicherheit: Der Wichser musste sterben.
Hitze stieg in mir auf, und mein Herz klopfte heftig gegen meine Rippen, als ich den Weg ins Schlafzimmer fortsetzte. Es war noch nicht spät, aber ich kannte Brown gut genug, um zu wissen, dass er im Bett lag und las, anstatt wie der Großteil der Amerikaner vor der Glotze zu hocken. Es war ihm immer ein Bedürfnis gewesen, sich von den ›einfältigen Normalbürgern‹ abzugrenzen. Und das verlangte er auch von mir.
So kam es, dass ich bereits mit dreizehn Bücher wie Moby Dick, Krieg und Frieden und die Ilias gelesen hatte. Verstanden ebenso, denn er ließ mich jeden Sonntag ein Referat über meine Lektüre halten. Und war es nicht ausführlich genug, zog er mir einen Kochlöffel über den Schädel und ließ es mich noch einmal schreiben und vortragen.
Dieses Mal, so schwor ich mir, wäre er es, der etwas über den Schädel gezogen bekam. Dieser Sadist, der mich adoptiert hatte, um sein eigenes, formbares Spielzeug zu besitzen, würde nun die Quittung erhalten. Denn ich war nicht formbar. Und das würde er gleich erfahren.
Langsam schob ich die Tür auf. Er bemerkte mich sofort, bewegte sich jedoch keinen Millimeter, sondern blickte nur träge von seiner Lektüre auf und verzog die wulstigen Lippen.
»Was willst du jetzt tun, Junge?« Seine Stimme klang gelangweilt und einen Hauch belustigt. »Kommst hier an in deiner weibischen Lederkluft und meinst, du könntest einmal im Leben etwas zu Ende bringen?« Er lachte heiser auf und senkte den Blick auf sein Buch. »Bisweilen sind es doch die Gene und nicht die Erziehung, die einen Menschen ausmachen. Gott weiß, ich habe mein Bestes getan.« Er blätterte die Seite um und beachtete mich nicht weiter. Er dachte wirklich, er hätte rein gar nichts von mir zu befürchten.
Innerlich kochte ich, äußerlich blieb ich jedoch ruhig. Die Glock steckte ich zurück ins Holster, nahm stattdessen das Messer in die rechte Hand und ging zum Bett.
Brown blickte entnervt seufzend zu mir auf, als wollte er fragen, wieso ich seine Zeit verschwendete. Einen Herzschlag lang war es vollkommen still, die gesamte Welt hatte den Atem angehalten, dann stach ich das Messer direkt in seine Halsschlagader und zog es sofort wieder heraus. Ich sagte nichts – keine Abschiedsworte, keine Begründung, nichts, was man in den Filmen immer sieht. Ich verspürte kein Bedürfnis dazu.
Das Blut pumpte aus seinem Hals und durchtränkte die weißen Laken. Mein Adoptivvater blickte mit großen Augen zu mir auf. Er war überrascht, hatte nicht erwartet, dass ich tatsächlich diesen Mut aufbringen würde. Und während ich zusah, wie das Leben aus ihm wich, wunderte ich mich selbst darüber.
Mein Herz raste, meine Handflächen waren derart feucht, dass mir fast das Messer aus den Fingern rutschte, und Schweiß perlte auf meiner Stirn. Mir wurde unwiderruflich klar, dass ich damit eine Grenze überschritten hatte.
Ich hatte einen Menschen aus Rache getötet. Und ich hatte nicht den Hauch einer Ahnung, zu was für einen Mann mich das machen würde.
Ich wusste, dass diese Aktion mein gesamtes restliches Leben veränderte. Und als ob mir das nicht schon eine Scheißangst eingejagt hätte, kam noch hinzu, dass ich mich trotzdem frei und gerecht fühlte. Von einem Moment auf den nächsten war ein anderer Mann aus mir geworden, und ich hatte keinen Schimmer, welchen Weg dieser Kerl einschlagen würde.
Es war eine dieser Entscheidungen, die mich ins Ungewisse führte und meine Zukunft veränderte – und von der ich erst am Ende meines Lebens wissen werde, ob sie richtig war.
Inzwischen glaube ich, dass der Tod nicht unbedingt das Gefährlichste am Leben ist. Vielleicht habe ich mich allmählich an ihn gewöhnt. Es ist vermutlich wie bei allen harten Aufgaben im Leben; irgendwann bekommt man Hornhaut an den Stellen, die man oft benutzt und wird dort gefühllos. Vielmehr als den Tod fürchte ich das Leben. Das, was es einem nimmt und wiedergibt.
Ich schwöre, nicht einmal mein erster Mord ließ mich derart verzweifelt zurück wie mein Wiedersehen mit Bea.
Sie stand auf der anderen Straßenseite, sah mich nur an mit ihren unergründlichen braunen Augen, und ich wusste, diese Scheiße konnte ich nicht kontrollieren. Sie würde mich entweder ins Glück oder ins Verderben stürzen. Himmel und Hölle standen für uns offen, und ich musste einmal mehr eine Wahl treffen.
Ich habe mich entschieden, für uns zu kämpfen, auch wenn es mir eine Scheißangst machte, und auch wenn ich wusste, dass es mich umbringen konnte. Aber ich glaubte fest daran, dass es das wert wäre. Ich musste sie davon abhalten, mich noch einmal zu verlassen.
Scheiße, ich könnte alles verlieren. Alles. Aber nicht sie.
Chapter 10 – Behind Bars
Ich wusste es. Ich wusste, dass es so enden würde!
Das klärt sich schnell, Bea. Sag nichts, hörst du. Ich schicke dir unseren Anwalt. Ich regle das.
Du hast schon genug getan. Siehst du das? Du hast das aus mir gemacht.
Die letzten Worte, die Charlie und sie gewechselt hatten, zogen unablässig durch Beas Kopf, während sie seinen gequälten Blick vor ihrem inneren Auge sah. Er hatte sie angesehen, als wäre er das Opfer.
Bea schnaubte und rieb sich die Handgelenke, dort, wo die Handschellen in ihre Haut gedrückt hatten, als sie abgeführt worden war. Abgeführt und aufs Revier gebracht, hineingesteckt in einen winzigen, stickigen Raum und stundenlang dort vergessen. Dann war endlich Chief Russo zu ihrer Befragung aufgetaucht. Ständig hatte er an seinem Schnauzbart herumgezupft und seine Fragen an die tausend Mal wiederholt, schien jedoch nicht überrascht zu sein, dass Bea nicht antwortete.
Irgendwann – sie hatte das Zeitgefühl verloren – brachte der Chief sie ins Untergeschoss und schubste sie in eine der Zellen. Und hier saß sie nun auf einer harten Pritsche und starrte an die nackte Wand. Das alles erschien ihr wie ein Traum. Ein Albtraum.
Hier eingesperrt zu sein, war Beas persönliches Worst-Case-Szenario. Es war das Ende, das ihr jeder, einschließlich sie selbst, prophezeit hatte, wenn sie in Wolfville und bei Charlie bleiben würde. Wie hatte sie es nur so weit kommen lassen können? Bea war stinkwütend auf ihn und die Jungs, aber am meisten auf sich. Sie war doch stärker, verdammt nochmal, klüger und weitsichtiger. Wieso hatte sie sich von ihm nur auf diese Weise ausnutzen lassen?
Sie liebte ihn zu sehr. Die Liebe zu Charlie war derart tief in ihrem Herzen verwurzelt, dass sie sie wohl nie vollständig herausreißen konnte. Diese Gefühle für ihn waren wie Unkraut – sie kamen ständig durch. Aber wenn sie sich wieder auf die Wut konzentrierte, die sie für ihn fühlte, konnte sie die anderen Empfindungen zurückdrängen und ihn einmal mehr verlassen.
Sie schwor sich, dass sie ihm für diesen fiesen Betrug eine verpassen würde, wenn sie ihn das nächste Mal sah. Der Tod dieser Ratte JJ scherte sie im Grunde sehr viel weniger, als dass Charlie sie belogen und benutzt hatte. Nach all der Zeit, nach allem, was er ihr versprochen hatte, tat er ihr das an. Bea fühlte sich schlichtweg verraten.
Sie spürte einen gewaltigen Stich im Herzen. Nicht zuletzt, weil ihr einfiel, dass sie ihren Plan, ihm eine reinzuhauen, wohl nicht so rasch in die Tat umsetzen konnte. Sie war hier eingesperrt, durfte keinen Besuch empfangen und würde wohl demnächst ins Gefängnis überstellt werden.
Knast. Das Wort klang fremd für sie. Aber bald würde sie mehr damit verbinden können, als ihr lieb war. Bea wunderte sich, wie ihre Augen beim Gedanken daran trocken blieben. Müsste sie sich nicht die Haare raufen und heulend an der Zellentür rütteln, statt auf ihrer Pritsche zu hocken, den Kopf gegen die Wand zu lehnen und zu warten? Wieso war sie derart ruhig?
Wie so oft in letzter Zeit verstand sie sich selbst nicht mehr.
Charlie hatte erneut dieses schwache, gefühlsgeleitete Wesen in ihr zum Vorschein gebracht und all ihre Versuche, ein besserer, ein anständigerer Mensch zu werden damit vereitelt. Sie war genau dort, wo ihre Eltern, Lehrer und Klassenkameraden sie immer gesehen hatten: Hinter Gittern. Bea zählte nun offiziell zum ›White Trash‹, dem weißhäutigen Abschaum, zu den kriminellen, verlorenen Seelen. Wieso also rastete sie nicht aus? Und wieso knurrte ihr der Magen? Wie konnte sie hungrig sein, jetzt, da ihr Leben vorbei war?
Es fühlte sich wie eine Ewigkeit an, bis es endlich Tag wurde. Zumindest schätzte Bea, dass es Tag wurde, da das Licht im Flur anging. Oder war sie in Wahrheit schon viel länger hier? Tage? Wochen? War sie einfach hier vergessen worden?
Sie erhob sich von der Pritsche, streckte sich, bis ihre Knochen knackten, und ging daraufhin zur Tür. Ihre Hände legte sie um die kalten Gitter, schob den Kopf so weit hindurch, wie es ging, und lauschte. Es vergingen einige zähe Sekunden, da hörte sie eine Tür zuschlagen, gefolgt von schlurfenden Schritten.
Bea wich von der Zellentür zurück, ehe jemand um die Ecke kam.
Der Chief nickte ihr zu, zog einen Schlüsselbund aus der Hosentasche. Er wirkte müde und genervt, genau wie bei ihrem letzten Aufeinandertreffen. Er schloss die Zelle auf und machte mit einer einladenden Geste einen Schritt rückwärts.
Bea legte den Kopf schief und beäugte ihn skeptisch. »Wo bringen Sie mich hin?«
»Nirgendwohin, so wie es aussieht, Prinzessin.« Er hob einen Mundwinkel und winkte sie ungeduldig heraus. »Sie sind frei.«
Bea wiederholte die Worte im Kopf, mehrmals, konnte sie aber nicht recht glauben. Vorsichtig machte sie einen Schritt nach vorn und hob die Hände ein wenig, um vorbereitet zu sein, falls er die Tür gleich vor ihrer Nase zuschlagen sollte. Nahm er sie auf den Arm?
Chief Russo rollte entnervt mit den Augen. »Was ist jetzt, Miss Kramer, wird das heute noch was? Ich habe einiges zu tun.«
»Ich verstehe nicht … Wieso bin ich frei?« Beas Gedanken rasten. Hatte jemand eine Kaution für sie hinterlegt?
»Das überrascht Sie ja wirklich.« Er hob den anderen Mundwinkel auch noch und schaute sie an, als amüsierte er sich über die Unwissenheit eines Kindes. »Nun, der Zeuge, der Sie belastet hat, zog seine Aussage zurück, und der Zeuge, der Shoemaker belastet hat, ist auf wundersame Weise verschwunden. Durch diese glücklichen Fügungen, wie wir sie einmal nennen wollen, kann der Mord nicht mehr mit dem MC in Verbindung gebracht werden. Daher verfolgt der Staatsanwalt die Sache nicht länger in diese Richtung.« Er machte erneut eine ungeduldig wedelnde Geste, die Bea zu einem weiteren Schritt in den Flur veranlasste. »Würden Sie meine Zeit jetzt bitte nicht noch länger verschwenden?«
Das erklärte, weshalb der Chief am Vorabend bereits derart genervt gewesen war. Er hatte geahnt, dass die Sache zu nichts führen würde.
Bea schüttelte irritiert den Kopf. Wie hatten sie das nur derart schnell geregelt? Und wollte sie die Antwort überhaupt wissen? »Dann kann ich jetzt einfach gehen?«
»Einfach war es bestimmt nicht«, er zuckte mit den Schultern, »aber Sie können gehen.« Als sie ihn weiterhin stirnrunzelnd anstarrte, machte er eine auffordernde Handbewegung. »Oder warten Sie noch auf ein Frühstück?«
Fast wäre ihr herausgerutscht, dass sie für eine Nacht unschuldig in der Zelle wenigstens ein Omelette verdient hätte, doch sie konnte sich noch bremsen. Wo kam das denn plötzlich her?
Nicht ohne den Chief misstrauisch im Auge zu behalten, ließ sie sich nach oben begleiten, wo sie noch Papierkram unterschreiben musste. Nachdem das erledigt war, schob Russo sie zur Tür und tippte sich zum Abschied an den Hut.
»Bis zum nächsten Mal, Miss Kramer«, meinte er.
»Darauf können Sie lange warten.«
Bea ließ sich geradezu gegen die Tür fallen und stürmte aus dem Polizeirevier in den milden Morgen hinaus. Sie wusste, dass es reichlich übertrieben war, aber sie schloss für einen Moment die Augen und sog die Luft tief in ihre Lungen, atmete die Freiheit ein.
Wie prachtvoll die staubige Straße und der einzelne kümmerliche Baum neben dem Revier doch wirkten, wenn man die Nacht auf einer schmalen Pritsche verbracht hatte, die direkt neben einer Toilettenschüssel stand. Bea hatte noch nicht einmal verarbeitet, verhaftet worden zu sein, und nun war sie schon wieder auf freiem Fuß. Wie war das möglich?
Plötzlich begann es in ihrem Rücken zu kribbeln. Sie spürte seinen Blick auf sich, bevor sie sich zum Parkplatz umdrehte und Charlie auf seinem Bike sitzen sah. Er rauchte eine Zigarette und musterte sie mit undurchdringlicher Miene.
Er war tatsächlich gekommen, um sie abzuholen. War das sein Ernst?
Bea atmete tief durch, stieg die Stufen von der Eingangstür zum Gehweg hinunter und überlegte, ob sie einfach in die andere Richtung davongehen sollte. Aber dann fiel ihr ein, dass sie sich etwas vorgenommen hatte. Sie ließ sich nichts anmerken, hielt Charlies Blick stand und ging betont gelassen auf ihn zu.
Ein vorsichtiges Lächeln formte sich auf seinen Lippen, ehe er sich von seinem Bike erhob und die Zigarette wegschnippte. Er streckte seine Finger nach ihr aus, in dem Moment ballte sie ihre rechte Hand zur Faust. Ohne Vorwarnung holte sie aus und verpasste ihm einen Schlag gegen das Kinn, der ihn überrascht keuchen ließ. Allerdings formte sich daraufhin direkt ein Grinsen auf seinen Lippen.
Vorsichtig tastete er die Stelle ab. »Du hast einen ganz schönen Bumms drauf, Kramer. Jetzt verstehe ich das mit der gebrochenen Nase deines Ex-Typen.«
Bea wäre am liebsten in den nächsten Supermarkt geflüchtet, um ihre Knöchel in eine Tiefkühltruhe zu stecken, aber sie biss die Zähne zusammen und versuchte, den pulsierenden Schmerz zu verdrängen.
Ihm eine zu verpassen, war nicht nur schmerzhaft, sondern auch längst nicht so befriedigend, wie sie es sich vorgestellt hatte. Zumindest blieb ihm dort, wo sich die Stelle langsam blau färbte, eine Erinnerung an ihre Wut.
Als sie die Arme vor der Brust verschränkte und Luft holte, hob Charlie ergebend die Hände. »Ich kann verstehen, dass du sauer bist …«
»Sauer? Ich wurde in aller Öffentlichkeit abgeführt, von einem gereizten Polizisten befragt und habe die Nacht in einer Zelle verbracht, weil man mir vorwarf, an der Ermordung eines Menschen beteiligt zu sein. Sauer beschreibt meinen Gemütszustand nicht einmal annähernd.«
Er kam auf Bea zu, die automatisch einen Schritt zurückwich. »Sie haben dich doch anständig behandelt?«
Sie konnte nicht anders, als aufzulachen und ihn dann ungläubig anzublinzeln. »Es war ganz toll, Charlie! Ich bekam eine schicke Einzelzelle mit Blick auf den Flur und eine extra kratzige Decke für meine Pritsche. Ich habe mich gefühlt wie ein Outlaw-VIP.«
»Bea.«
Sie schlug die Hand energisch fort, die er nach ihr ausstreckte. Glaubte er, er könnte alles wiedergutmachen, indem er hier auftauchte und sie nett anlächelte?
»Es tut mir leid, dass es dazu gekommen ist«, sagte er ernst, und seine silbergrauen Augen blickten sie durchdringend an. »Glaub mir, ich würde nie zulassen, dass dir etwas geschieht oder dich jemand einsperrt. Das war nur ein Missverständnis, das …«
»Aber genau das ist doch geschehen!« Bea deutete hinter sich auf das Polizeirevier. »Warst du nicht dabei? Sie haben mich eingesperrt. Deinetwegen.«
Er kam einen weiteren Schritt auf sie zu. Dieses Mal blieb sie stur stehen und funkelte ihn weiterhin zornig an.
»Darum geht es dir nicht wirklich.«
»Ach, nein? Es macht mir also nichts aus, dass ich deinetwegen beinahe das Leben weggeworfen hätte, für das ich jahrelang hart gearbeitet habe? Worum geht es mir denn dann?«
»Du verstehst genau, weshalb wir ihn loswerden mussten, und du weißt, dass es nötig gewesen ist, damit hier nicht die Hölle losbricht. Das widerspricht deiner antrainierten Gerechtigkeitsblindheit und macht dir eine Scheißangst. Glaub mir, ich kann das nachvollziehen, es ging mir anfangs ebenso.« Zögerlich streckte er eine Hand aus, nahm eine Strähne ihres Haars und ließ sie behutsam durch seine Finger gleiten. »Aber was dich so richtig wurmt, ist, dass ich es dir nicht erzählt habe.«
Als er sich näher zu ihr vorbeugte, legte sie die Hände auf seine Brust und schob ihn sanft, aber bestimmt von sich. »Du hast mich benutzt und belogen. Und nicht nur, was die Aktion mit JJ angeht: du hast mich glauben lassen, ich könnte das Leben, das ich mir wünsche, an deiner Seite leben. Du wolltest mir weismachen, dass ihr lediglich missverstandene Motorradfahrer seid, von den Medien in Verruf gebracht, und dabei würdet ihr euch doch ach so sehr für euer Zuhause einsetzen.«
»Das tun wir auch. Und du kannst das Leben, das du dir wünschst, an meiner Seite leben – wenn du endlich erkennst, welches Leben das wirklich ist.«
Frustriert warf Bea die Arme in die Luft. »Wieso bildest du dir überhaupt ein, mich besser zu kennen als ich selbst?«
»Weil es so ist.« Er packte sie an den Oberarmen, als wolle er sie schütteln, und sah ihr tief in die Augen. »Wir können unsere Ansichten und Ziele ein Stück weit ändern, ja, aber nicht unser Wesen, den Kern dessen, was wir sind. Ich kenne dich, Bea.« Er legte eine Hand auf seine Brust. »Und du kennst mich. Du weißt, dass ich dich niemals benutzen oder belügen würde.«
Sie seufzte. »Nichts zu sagen ist das Gleiche wie lügen.«
»Manches kann ich dir nicht erzählen, weil es um so viel mehr geht als nur um uns beide. Das sind … Clubangelegenheiten.« Er zuckte viel zu unbekümmert mit den Schultern. »Du musst mir in diesem Punkt einfach vertrauen.«
»Ich muss dir vertrauen?« Schnaubend schüttelte sie den Kopf und verschränkte erneut die Arme vor der Brust. »Clubangelegenheiten. Wenn ich das Wort noch einmal höre, ramme ich dein Bike mit Moms Pick-up.«
Sein Mundwinkel zuckte. Fand dieser Mistkerl ihren Zorn etwa witzig? »Glaub mir, ich habe dich nie belogen. Und wenn ich Informationen zurückgehalten habe, dann nur, um dich zu beschützen. Was dich und uns beide betrifft, werde ich immer ehrlich sein.« Aus seinen Augen sprach die pure Ernsthaftigkeit.
Sie hob eine Braue. »Gut, dann sag mir eins: Wieso bin ich frei?« Als er tief durchatmete, fügte sie hinzu: »Das ist etwas, das mich betrifft, oder nicht? Also erzähl schon: Wieso hat der Zeuge seine Aussage zurückgezogen?«
Charlie rubbelte sich über das blonde Haar und druckste herum: »Bea …«
»Weißt du, was? Es ist mir egal.« Sie hob die Hände und lachte bitter auf. »Es spielt keine Rolle mehr, denn ich werde meine Sachen packen und verschwinden. Ich habe genug davon.«
Urplötzlich war sie nur noch müde. Sie war es müde, seine Ausreden anzuhören; sie war es müde, immer wieder zu hoffen; und sie war es müde, ihn zu lieben.
»Du kannst mich mal«, murmelte sie daher zum Abschied, machte auf dem Absatz kehrt und marschierte davon. »Halt dich einfach von mir fern.«
»Willst du etwa nach Hause laufen?«, rief er ihr hinterher.
»Ja!«
»Du bist ein sturer Bock, Kramer!«
Ja, vielleicht war sie das. Aber sie würde sich bestimmt nicht auf dieses Bike setzen und die Arme um ihn schlingen. Völlig gleichgültig, wie heiß es wurde, wie erschöpft sie war und wie weit sie laufen musste.
Chapter 11 – Being Normal
Kaum hatte Bea die Tür hinter sich geschlossen, ließ sie sich auf den Fußboden im Flur ihres Elternhauses plumpsen, legte sich auf den Rücken und streckte ihre schmerzenden Glieder aus. Ihre Haut juckte vom Schweiß und dem feinen Sand in der heißen Luft, und ihre Lungen fühlten sich ebenfalls ganz rau an.
»Verdammte Wüste«, murmelte sie und holte keuchend Luft.
»Was soll das?«
Als Bea den Kopf drehte, konnte sie ihre Mutter durch die Wohnzimmertür auf der Couch sitzen sehen. Sie zog an einer Zigarette, als hinge ihr Leben davon ab, und blies den Rauch in einem Schwall wieder aus.
»Bist du betrunken?«, fragte sie.
»Nein. Du?« Bea rappelte sich so weit auf, dass sie ihren Rücken an die Wand lehnen und ihrer Mutter ins Gesicht sehen konnte. Wie so oft erschrak sie ob der aufgedunsenen Haut der Trinkerin, aber das war heute nicht das Schlimmste an ihrem Anblick. Rosemarys Augen waren total verquollen und rot gerändert.
»Bist verhaftet worden, hab ich gehört.« Ihre Stimme war ruhig, ihr Tonfall gleichgültig.
»War ein Missverständnis«, antwortete Bea schlicht.
»Was sonst.« Einmal mehr zog sie an der Zigarette und wandte den Blick von ihrer Tochter auf den Fernseher, woraus einige Frauenstimmen drangen, die heiter durcheinanderquasselten.
Was fanden die Leute nur an diesem blödsinnigen Frühstücksfernsehen?
Bea schüttelte schnaubend den Kopf und überlegte, wie solche Gespräche in normalen Familien abliefen. Allerdings war das hier nicht einmal für Rosemary Kramer ›normal‹. Früher hätte sie ihre Tochter geohrfeigt, grob beschimpft und aus dem Haus geworfen. War ihr jetzt etwa alles egal?
Tief durchatmend erhob sich Bea, stellte sich mit vor der Brust verschränkten Armen in den Türrahmen und musterte ihre Mutter, die sie geflissentlich ignorierte. »Ist das alles, was du dazu zu sagen hast?«
Träge hob Rosemary einen Mundwinkel, ohne den Blick vom Fernseher zu lösen. »Was willst du von mir hören? Ich wusste immer, dass du ein nichtsnutziges Gör bist, das nur Ärger macht.«
Am liebsten hätte Bea sie geschüttelt. »Kürzlich klang das alles noch viel leidenschaftlicher, Mom. Wo ist dein guter alter Hass hin?«
Endlich schaute ihre Mutter sie an, doch in diesem Moment wünschte Bea, sie hätte es nicht getan. Denn in ihren Augen sah sie lediglich dumpfe Leere.
»Weder die Entfernung noch die Jahre konnten ändern, was du bist. Ich habe alles versucht, aber ich sehe, dass es sinnlos war.« Sie drückte die Zigarette im Aschenbecher aus, stand vorsichtig auf und schwankte an Bea vorbei aus dem Zimmer, zur Treppe hinauf in den oberen Stock. »Ich bin mit dir fertig.«
Bea klammerte sich am Türrahmen fest, damit ihre weichen Knie nicht einknickten, und schaute Rosemary schockiert nach. Überraschend füllten sich ihre Augen mit Tränen.
Ihre Beziehung war vielleicht niemals die harmonischste oder gesündeste gewesen, die Mutter und Tochter haben konnten, doch an starken Emotionen hatte es zwischen ihnen nie gemangelt. Etwas in ihr berühren oder vielmehr auslösen zu können, egal in welche Richtung dieses Etwas ging, war für Bea immer der Beweis dafür gewesen, dass wenigstens ein winziger Teil in Rosemarys Herz für ihr einziges Kind schlug.
Es gab nur eines, das schlimmer war als Hass: Gleichgültigkeit.
Ihre Mutter hatte sie aufgegeben. Bea hätte niemals gedacht, dass sie dieser Umstand derart hart treffen würde. Ihre Mom endgültig zu verlieren, tat verdammt weh.
Höchste Zeit, von all diesem wirren Gefühlschaos Abschied zu nehmen und neu anzufangen.
*
Nachdem sie eine lange, kalte Dusche genommen hatte, fuhr Bea ins Büro. Hauptsächlich deshalb, weil sie nicht wusste, was sie sonst tun sollte, und zu Hause allein mit ihren Gedanken verrückt geworden wäre. Davon abgesehen brauchte sie diesen Job. Mehr denn je.
Sie verspürte den unbändigen Drang, sofort die Stellen- und Wohnungsanzeigen zu durchforsten. Momentan wäre sie bereit, jeden Job anzunehmen, wenn er nur weit genug fort von hier wäre. Aber vermutlich sollte sie nicht überstürzt den Staat verlassen, nachdem sie gerade erst als Verdächtige in einem Mordfall verhaftet wurde. Verdammt. Wie das klang … Konnte ihr Leben denn nicht ein einziges Mal normal sein?
Wieso war es für sie nur so schwer, das zu erreichen, was der Großteil der Menschen mühelos schaffte? Sie wollte doch nur einen anständigen Mann heiraten, ihre Kinder liebevoll aufziehen und in einem netten Häuschen im Vorort leben, ohne Geldsorgen, ohne Streit und Drama oder leere Bierdosen und Whiskyflaschen im Garten. Sie wollte es besser machen als ihre Eltern. Doch stattdessen schien sie deren Chaos magnetisch anzuziehen.
Bea hielt auf dem Parkplatz vor dem Rathaus an, stellte den Motor ab und legte die Stirn aufs Lenkrad. »Was stimmt nur nicht mit mir?«, murmelte sie und seufzte. »Was mache ich falsch?«
Sie spulte all die gescheiterten Beziehungen in ihrem Kopf ab, das vermasselte Studium, die verlorenen Jobs, die teuren Autos, die sie zu Schrott gefahren hatte. Bisher hatte sie gedacht, ein gewöhnlicher Pechvogel zu sein. Doch allmählich kam es ihr vor, als steckte ein System dahinter. Je mehr sie sich bemühte, je härter sie an sich und ihrem Leben arbeitete, desto heftiger wurde sie zurückgestoßen. Es war, als fraß die Welt sie Stück für Stück auf, und alles Strampeln und Schlagen half nicht, dagegen anzukommen.
Allmählich war sie mit ihrem Latein am Ende. Was sollte sie denn noch alles versuchen? Sie fühlte sich so hilflos …
Noch nie war sie so weit von ›normal‹ entfernt gewesen wie heute. Sie hatte einen schlechtbezahlten Aushilfs-Job, liebte einen Outlaw, war eben aus dem Polizeigewahrsam entlassen worden und schuldete einer kriminellen Vereinigung einen Riesenhaufen Geld. Wie zur Hölle konnte sie es nur so weit kommen lassen?
Ob sie sich letztendlich selbst im Weg stand? War sie es, die ihr Leben unterbewusst manipulierte? Seit sie aus Wolfville fortgegangen war, hatte Bea gegen diesen dunklen Teil in sich gekämpft. Doch er ließ sich nicht vertreiben, saß in ihrem Herzen wie ein hartnäckiger Tintenfleck und kam immer wieder zum Vorschein. Allmählich kam es ihr so vor, als sei es genetisch bedingt, dass sie nicht ›normal‹ leben konnte. Wie sollte sie diesen dunklen Fleck auf ihrer Seele nur jemals loswerden?
Sie stieg aus dem Wagen, schlug die Tür geräuschvoll zu und ging zum Rathaus. Es wäre vielleicht ein Anfang, sich wie eine zivilisierte Erwachsene zu verhalten und sich bei ihrer Chefin für die Verspätung zu entschuldigen.
Zielstrebig lief sie zum Büro von Mrs Sanchez hinauf, klopfte an die Tür und wartete brav, bis sie hereingebeten wurde.
»Miss Kramer.« Die Chefin schaute verwundert zu ihr auf, ehe ihr Blick zu der Analoguhr an ihrer Wand schweifte, die gerade einmal kurz nach zehn anzeigte. »Mit Ihnen hätte ich heute nicht mehr gerechnet.«
Bea legte die Hände aneinander und versuchte, so unschuldig wie möglich auszusehen. »Ich möchte mich in aller Form für meine Verspätung entschuldigen, Mrs Sanchez. Seien Sie versichert, dass so etwas nie mehr vorkommen wird.«
Sie hob die dünn gezupften Brauen. »Sie wollen also sagen, dass Sie von nun an nicht mehr verhaftet werden?«
Bea biss die Zähne zusammen und atmete durch. Für einen winzigen Moment hatte sie vergessen, dass sie hier in der Pampa war, wo sich Neuigkeiten wie ein Lauffeuer verbreiteten. »Nein, Ma’am, ich habe nicht vor, wieder verhaftet zu werden.«
Ihre Mundwinkel zuckten. »Na, das freut uns doch alle. Nun gehen Sie schon an die Arbeit.«
»Danke, Mrs Sanchez«, presste Bea zwischen zusammengebissenen Zähnen heraus, ehe sie das Büro verließ.
Im Flur schüttelte sie sich schnaubend. Musste sie sich von dieser Frau derart belächeln lassen? Heute fühlte sich das respektloser und demütigender an als je zuvor.
War das wirklich der Preis, den sie zahlen musste, wenn sie ›normal‹ sein wollte? Und fiel es anderen Menschen ebenso schwer, ihre Gedanken hinunterzuschlucken, des lieben Friedens willen?
Sie schüttelte den Kopf und schlurfte zu ihrem Arbeitsplatz, einem weiteren Merkmal dafür, wo sie in der Nahrungskette stand. Je kleiner der Schreibtisch, desto geringer der Wert des Menschen. Was für eine versnobte, ungerechte Gesellschaft das doch war!
Bea erwischte sich bei dem Gedanken, verstehen zu können, dass die Advocates in diesem System nicht mitspielen wollten und ihre eigenen Regeln machten.
Seufzend warf sie ihre Handtasche auf den Tisch und ließ sich in den Bürostuhl fallen.
»Du hast meine Anrufe ignoriert.« Mayas Kopf schob sich über die Trennwand, und ihre grünen Kulleraugen blickten Bea vorwurfsvoll an.
»Tut mir leid.«
»Seit wann bist du draußen?«
Bea stöhnte entnervt und warf den Kopf in den Nacken. »Weiß das etwa schon jeder?«
»Ja.« Maya lächelte geduldig.
»Schaut sie euch an, Beatrice Kramer, wie sie leibt und lebt.« Sie nahm einen Bleistift und schmetterte ihn gegen den Bildschirm. »Ein paar Leute werden sich diebisch darüber freuen, dass ihre Weissagungen korrekt waren. Bestimmt wurden nun auch einige fast verjährte Wetten gewonnen.«
»Scheiß drauf, was die Leute denken.« Maya verschränkte die Arme auf der Trennwand und legte den Kopf darauf ab. »Bist du echt das erste Mal in deinem Leben verhaftet worden?«
»Ist das so schwer zu glauben?« Bea warf ihr einen finsteren Blick zu, ehe sie zögerlich einlenkte. »Ich habe mich früher einfach nie erwischen lassen.«
Maya grinste. »Demnach kann dein neues Ich noch viel von deinem alten Ich lernen.«