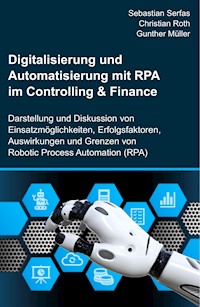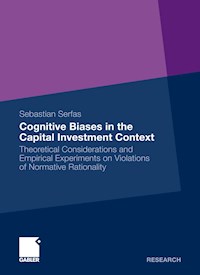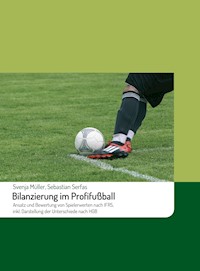
24,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Fußball bewegt die Menschen wie kaum eine andere Sportart und ist zugleich bedeutender Wirtschaftsfaktor. Längst haben sich die Strukturen im professionellen Fußball gewandelt: von reinen Sportvereinen hin zu gewinnorientiert handelnden Wirtschaftsunternehmen. Im Zuge dieser Entwicklung ist auch der Umfang der Rechnungslegungs- und Offenlegungspflichten gewachsen, denen sich professionelle Fußballclubs unterwerfen müssen. Von zentraler Bedeutung im Rahmen der Rechnungslegung von Fußballunternehmen sind dabei die Fußballspieler selbst: Sie werden als Spielerwerte direkt in der Bilanz erfasst und beeinflussen damit unmittelbar die Vermögens- und Finanzlage des betreffenden Clubs. M.Sc. Svenja Müller und Prof. Dr. Sebastian Serfas geben einen detaillierten Überblick zur grundsätzlichen Vorgehensweise und zu ausgewählten zentralen Aspekten der Bilanzierung von Spielerwerten im Profifußball. Sie zeigen auf, wie bei der Bilanzierung von Spielerwerten vorzugehen und was dabei zu beachten ist: vom erstmaligen Eintritt des Spielers in den Spielbetrieb - etwa durch Kauf, Tausch oder aus der eigenen Jugend - über die Zeit im Fußballclub bis hin zum Austritt, beispielsweise durch Transfer, Vertragsablauf oder Karriereende. Die dargestellten Inhalte werden durch eine Vielzahl an Beispielen aus dem deutschen und europäischen Profifußball ergänzt und veranschaulicht. Im Mittelpunkt der Betrachtung steht die Bilanzierung von professionellen Fußballspielern nach den internationalen Rechnungslegungsstandards IAS/IFRS (International Accounting Standards/ International Financial Reporting Standards). Ergänzend wird auf die Eckpunkte der handelsrechtlichen Bilanzierung von Spielerwerten eingegangen, um wesentliche Unterschiede bei der Bilanzierung nach HGB im Vergleich zum Vorgehen nach IAS/IFRS hervorzuheben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 134
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Svenja Müller ist derzeit als Referentin im Bereich Finance & Accounting für einen global operierenden Industriekonzern mit Stammsitz in Nürnberg tätig. Sie erwarb ihren Bachelor of Arts in den Fächern Ökonomie und Kunstgeschichte an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen. Im Anschluss absolvierte sie den Studiengang Finance & Accounting mit Abschluss Master of Science an der FOM Hochschule Nürnberg.
Prof. Dr. Sebastian Serfas beschäftigt sich seit 2005 mit wirtschaftlichen Aspekten im (Profi-) Sport. Er lehrt und forscht an der FOM Hochschule in Nürnberg mit Schwerpunkt im Bereich Finance & Accounting, ist Mitgründer des KompetenzCentrum für Entrepreneurship & Mittelstand, und berät Unternehmen bei strategischen und operativen Fragestellungen.
Die Inhalte des vorliegenden Buches wurden mit größter Sorgfalt recherchiert und nach bestem Wissen zusammengestellt, mit dem Ziel, dem Leser einen Überblick zur grundsätzlichen Vorgehensweise und zu ausgewählten zentralen Aspekten der Bilanzierung von Spielerwerten im Profifußball zu geben. Sie bieten jedoch explizit keinen Ersatz für eine fundierte juristische, steuerliche, oder vergleichbare Beratung, die aufgrund der Komplexität der Thematik und jedes Einzelfalls dringend angeraten wird. Alle Angaben erfolgen daher ohne Gewähr, jegliche Haftung seitens der Autoren oder des Verlages ist ausgeschlossen.
Svenja Müller, Sebastian Serfas
Bilanzierung im Profifußball
Ansatz und Bewertung von Spielerwerten nach IFRS
inkl. Darstellung der Unterschiede nach HGB
Bilanzierung im Profifußball:
Ansatz und Bewertung von Spielerwerten nach IFRS,
inkl. Darstellung der Unterschiede nach HGB
© 2017 Svenja Müller, Sebastian Serfas
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
ISBN Paperback
978-3-7439-0100-1
ISBN e-Book
978-3-7439-0101-8
ISBN Hardcover
978-3-7439-0102-5
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet abrufbar unter http://dnb.d-nb.de.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Rahmenbedingungen im Profifußball
2.1 Lizenz-, Vertrags- und Amateurspieler
2.2 Ablauf von Spielertransfers
2.3 Vom Idealverein zum Wirtschaftsunternehmen
2.4 Rechnungslegungs- und Offenlegungspflichten im Profifußball
3. Spielerwerte
3.1 Fußballspieler: materiell oder immateriell?
3.2 Humankapital in der Clubbilanz
3.3 Bewertungsanlässe
3.4 Marktwert, Preis und Buchwert
4. Immaterielle Vermögenswerte nach IFRS
4.1 Definitions- und Ansatzkriterien
4.2 Zugangsbewertung
4.3 Folgebewertung
4.4 Abgangsbewertung
5. Bilanzierungsfähigkeit von Spielerwerten
5.1 Abstrakte Bilanzierungsfähigkeit
5.2 Konkrete Bilanzierungsfähigkeit
5.2.1 Entgeltlicher Erwerb von Spielerwerten
5.2.2 Ablösefreier Erwerb von Spielerwerten
5.2.3 Selbst geschaffene Spielerwerte
5.3 Bilanzieller Ausweis
6. Zugangsbewertung von Spielerwerten
6.1 Erwerb von Spielerwerten
6.1.1 Entgeltlicher Erwerb von Spielerwerten
6.1.2 Ablösefreier Erwerb von Spielerwerten
6.1.3 Tausch von Spielern
6.2 Selbst erstellte Spielerwerte
6.3 Bilanzielle Behandlung von Leihspielern
7. Folgebewertung von Spielerwerten
7.1 Planmäßige Abschreibung
7.2 Außerplanmäßige Abschreibung
7.2.1 Nettoveräußerungswert
7.2.2 Nutzungswert
7.2.3 Wertminderungsbedarf
7.3 Wertaufholung
8. Austritt aus der Bilanz
8.1 Zur Veräußerung gehaltene Spieler
8.1 Abgang und Ausbuchung
9. Wahlrechte und Spielräume bei der Spielerbewertung
9.1 Faktisches Ansatzwahlrecht bei selbst erstellten Spielerwerten
9.2 Bewertungsspielräume
10. Bilanzierung von Spielerwerten nach HGB
10.1 Bilanzierungsfähigkeit von Fußballspielern
10.2 Zugangsbewertung
10.3 Folgebewertung
10.4 Beizulegender Zeitwert im Handelsrecht
10.5 Veräußerung und Austritt aus der Bilanz
10.6 Wahlrechte und Spielräume
11. Fazit
Anhang
Anhang I: Abkürzungsverzeichnis
Anhang II: Abbildungsverzeichnis
Anhang III: Tabellenverzeichnis
Quellenverzeichnis
1. Einleitung
Fußball bewegt die Menschen wie kaum eine andere Sportart: Rund 57 Prozent der Bundesbürger interessieren sich laut einer Erhebung der DFL für Fußball.191 Prozent davon halten die Bundesliga für einenfesten Bestandteil der Gesellschaft.2Ungefähr 18,8 Mio. Zuschauer verfolgten in der Saison 2015/2016 ein Spiel der 1. oder 2. Bundesliga im Stadion.3Fußball ist kein klassischer Industriezweig, deutschlandweit beschäftigt er jedoch innerhalb von Fußballclubs4und indirekt, beispielsweise über die Gastronomie, mehr als 165.000 Menschen.5Längst haben sich die Strukturen im professionellen Fußball gewandelt: von reinen Sportvereinen hin zu gewinnorientiert handelnden Wirtschaftsunternehmen, die nicht selten eine oder mehrere Kapitalgesellschaften halten.6Sie wurden zu Unternehmen, die ihr „Oberziel der Maximierung des sportlichen Erfolgs unter Aufrechterhaltung des finanziellen Gleichgewichts“7verfolgen. So erzielten beispielsweise allein die 18 Clubs der 1. Bundesliga in der Saison 2015/16 Umsatzerlöse in Höhe von 3,24 Mrd. Euro.8Sie wurden aber auch zu Unternehmen, die umfangreichen Rechnungslegungs- und Offenlegungspflichten nachkommen müssen.
Ein Blick in die Jahresabschlüsse von Fußballclubs offenbart dabei eine Besonderheit: So findet sich im Bereich der Vermögenswerte ein ganz charakteristischer Wert – der des Fußballspielers. Diese Spielerwerte sind ein zentraler Aspekt im Vermögen von Fußballunternehmen. Nicht nur beeinflussen Spielerwerte als Vermögenswerte die Aktiva der Clubbilanz in hohem Maße.Vielmehr sind Spielerwerte auch ein bedeutender Umsatzträger von Fußballunternehmen. Durch ihren Einsatz werden Zahlungsmit- telzuflüsse generiert, die sich unter anderem durch Ticketverkäufe sowie sämtliche dem Stadion- und Spielbetrieb zuzuordnende Umsatzerlöse ergeben, beispielsweise aus medialen Rechten, Merchandising, Stadiongastronomie, Logo-, Marketing- und Hospitalityrechten und nicht zuletzt aus ihrem Verkauf oder Abstellgebühren für Nationalspieler. Tabelle 1 zeigt exemplarisch am Beispiel von Borussia Dortmund, dem einzigen deutschen börsennotierten Fußballclub, dass die Umsatzerlöse im Geschäftsjahr 2015/2016 nur zu 12,4 Prozent aus dem eigentlichen Spielbetrieb stammten:
Erlösquelle
Mio. Euro
Anteil
Spielbetrieb
46,8
12,4 %
Werbung
84,6
22,5 %
TV-Vermarktung
82,6
22,0 %
Merchandising
39,8
10,6 %
Transfergeschäfte
95,0
25,2 %
Catering & Sonstiges
27,5
7,3 %
Summe
376,3
100 %
Tab. 1: Zusammensetzung der Umsatzerlöse von Borussia Dortmund 2015/2016, Konzern, gerundet9
Das Ziel dieser Ausarbeitung ist es, aufzuzeigen wie Spielerwerte grundsätzlich bilanziert werden. Im Mittelpunkt soll dabei die Bilanzierung von professionellen Fußballspielern nach den internationalen Rechnungslegungsstandards IAS/IFRS stehen. Die zentrale Fragestellung ist dabei, wie bei der Bilanzierung von Spielerwerten von ihrem Zugang in die Bilanz bis zu ihrem Austritt vorgegangen wird. Ergänzend wird auch auf die handelsrechtliche Bilanzierung eingegangen, um wesentliche Unterschiede zum Vorgehen nach IFRS hervorzuheben.
Vorab werden imKapitel 2wichtige Rahmenbedingungen erläutert, die den professionellen Fußball betreffen: So spielt die Untergliederung in Lizenz-, Vertrags- und Amateurspieler im Lizenzfußball eine Rolle, genau wie der Ablauf eines Spielertransfers, der verbandsseitig vorgegeben ist. Die Darstellung umfasst auch eine Erläuterung der Entwicklung vom Verein hin zur Ausgliederung der Lizenzabteilung in eine Kapitalgesellschaft – ein Weg, der auch national immer öfter beschritten wird und in Verbindung mit einer Kapitalmarktorientierung die Rechnungslegungspflicht nach IFRS mit sich bringt.
ImKapitel 3wird aufgezeigt, warum Fußballspieler in der Rechnungslegung als immaterielle Vermögenswerte angesehen und bilanziert werden.Kapitel 4gibt einen Überblick über die grundsätzliche Bilanzierung immaterieller Vermögenswerte nach IFRS im Allgemeinen, bevor anschließend imKapitel 5die Grundlagen zur abstrakten und konkreten Bilanzierungsfähigkeit von Spielerwerten unter Beachtung der Darstellungen des IAS 38 erläutert werden.
In den darauffolgenden Kapiteln werden wichtige Aspekte der Bilanzierung von Spielerwerten entlang des "Lebenszyklus" eines Fußballspielers aus Vereinssicht betrachtet.Kapitel 6beginnt mit der Zugangsbewertung. Dabei werden verschiedene Arten unterschieden, wie ein Fußballspieler zu einem Fußballverein kommen kann und die resultierenden Auswirkungen auf die Bilanzierung dargestellt. Den Schwerpunkt vonKapitel 7bildet die Folgebewertung von Spielerwerten, d. h. die bilanzielle Behandlung des Spielers, während er bei dem Fußballverein tätig ist. Dabei wird auch betrachtet, warum Spielerwerte regulär nur linear abgeschrieben werden und wie im Falle einer außerplanmäßigen Wertminderung oder einer Wertaufholung vorzugehen ist. Um den Kreis zu schließen, wird imKapitel 8schließlich aufgezeigt, auf welchem Weg ein Spieler einen Fußballverein wieder verlassen kann, und wie dies jeweils bilanziell zu erfassen ist.
Bei der Betrachtung des Vorgehens und der Vorgaben zur Bilanzierung von Spielerwerten zeigt sich deutlich, dass diese teilweise große Ermessensspielräume für das Management des Fußballclubs beinhalten. ImKapitel 9werden deshalb ausgewählte bilanzpolitische Möglichkeiten in Form von Wahlrechten und Spielräumen bei der Spielerbewertung dargestellt und diskutiert. ImKapitel 10wird anschließend ergänzend auch auf die Eckpunkte der handelsrechtlichen Bilanzierung von Spielerwerten eingegangen, um wesentliche Unterschiede bei der HGB-Bilanzierung im Vergleich zum Vorgehen nach IFRS hervorzuheben. Der Aufbau des Kapitels gestaltet sich dabei analog zu den vorherigen Betrachtungen nach IFRS.
ImKapitel 11werden schließlich die wichtigsten Aspekte nochmal kurz zusammengefasst und ein Fazit mit Ausblick gezogen. Im darauffolgendenAnhangbefinden sich neben einer Auflistung der verwendeten Abkürzungen auch Abbildungs- und Tabellenverzeichnisse sowie Hinweise zu Quellen und weiterführender Literatur.
2. Rahmenbedingungen im Profifußball
Die Teilnahme am professionellen Fußball ist geregeltdurch Rahmenbedingungen, die weltweit durch den Dachverband FIFA und europaweit durch eines ihrer Mitglieder, die UEFA, vorge-geben werden.10Auf nationaler Ebene ist der lt. Präambel der DFB-Satzung im Jahr 1900 gegründete DFB als Mitglied der UEFA und FIFA für die Durchführung des wettbewerbsmäßigen Fußballs auf Verbandsebene und in den Lizenzligen zuständig. Als Beginn der Professionalisierung des Fußballs gilt der Beschluss zur Gründung der Fußballbundesliga am 28. Juli 1962.11Alle 36 aktuell teilnehmenden Clubs der Ersten und Zweiten Bundesliga sind gem. § 1 Ziffer 1 der Satzung des im Jahr 2000 gegründeten Ligaverbands12Mitglieder im Ligaverband, dessen operativer Arm die DFL ist.13
So entscheiden Ligaverband, bzw. dessenTochtergesellschaft DFL, und der DFB, wer hierzulande als professioneller Spieler gilt und an Wettbewerben der Lizenzligen teilnehmen darf.14Das Ligastatut definiert mit der Lizenzierungsordnung (LO), der Lizenzordnung Spieler (LOS), der Spielordnung des Ligaverbandes (SpOL) und der Ordnung für die Verwertung kommerzieller Rechte (OVR) gem. Präambel des Ligastatuts sämtliche Rechte und Pflichten, die der Ligaverband und dessen Mitglieder haben, damit der professionelle Fußballbetrieb aufrecht erhalten werden kann.
2.1 Lizenz-, Vertrags- und Amateurspieler
Grundsätzlich besteht im Fußball eine Einteilung in Lizenzspieler,Vertragsspieler und Amateure.15Allen gemein ist, dass sie gem. Präambel derLOS i.V.m. § 8 der Spielordnung des DFB unter bestimmten Voraussetzungen an den Spielen der ersten und zweiten Bundesliga teilnehmen dürfen.16Als Lizenzspieler gilt gem. § 8 Ziffer 3 DFB-Spielordnung, wer einen Arbeitsvertrag mit dem Verein bzw. der zugehörigen Kapitalgesellschaft geschlossen hat und aufgrund des mit dem Ligaverband geschlossenen Lizenzvertrags am Spielbetrieb teilnehmen darf.
Die durch den Ligaverband als Alleingesellschafter der DFL17erteilte Lizenz ist gem. § 1 LOS unbefristet und basiert gem. § 2 Ziffer 2 LOS auf einem abgeschlossenen Vertrag mit einem lizenzierten Fußballclub i.V.m. weiteren Voraussetzungen gem. § 3 Ziffer 2 bis 7 LOS. Abbildung 1 verdeutlicht die Zusammenhänge, die zwischen Spieler, Lizenzabteilung und Ligaverband bestehen:
Abb. 1: Vereinfachte Darstellung des Verhältnisses zwischen Lizenzspieler, Ligaverband und Club18
Lizenzspielersind Profisportler. Sie haben einen Arbeitsvertrag mit dem Lizenzverein und sind durch Abschluss eines Lizenzvertrags mit dem Ligaverband zum Spielbetrieb zugelassen. Gem. § 5 Ziffer 1 LOS und Art. 18 Ziffer 2 des FIFA Reglementsbezüglich Status und Transfer von Spielern dauert die Laufzeit des Arbeitsvertrags zwischen Lizenzspieler und Clubmindestens bis Ende des laufenden Spieljahres und höchstens fünf Jahre.19Der Lizenzvertrag zwischen Spieler und Ligaverband ist, anders als der Arbeitsvertrag mit dem Fußballclub, gem. § 1 LOS unbefristet. Er ist Bedingung dafür, dass der Spieler zu Vertragsabschluss mit einem Club die Spielerlaubnis für Lizenzspieler in Lizenzmannschaften erhält, die gem. § 13 Ziffer 1 LOS mit dem Ligaverband geschlossen wird. Diese erlischt jedoch gem. § 13 Ziffer 6 LOS mit dem Ende des Arbeitsvertrags.
DerVertragsspielerist gem. § 8 Ziffer 2 DFB-Spielordnung Vereinsmitglied und zusätzlich auf vertraglicher Grundlage als Spieler aktiv, besitzt also einen Dienstvertrag mit dem Verein bzw. dessen Tochtergesellschaft, die Teilnehmerin des Spielbetriebs ist, und verdient regelmäßig mindestens 250 Euro pro Monat.
Amateuresind dagegen gem. § 8 Ziffer 1 DFB-Spielordnung Vereinsmitglieder, aber mangels regelmäßigen Entgelts keine Arbeitnehmer,20oder erhalten weniger als 250 Euro pro Monat. Unter den Voraussetzungen des § 14 Ziffer 1 LOS dürfen auch Vertragsspieler und Amateure am Lizenzbetrieb teilnehmen, gem. § 11 Ziffer 2b LOS i.V.m. § 53 Ziffer 2 DFB-Spielordnung dürfen jedoch höchstens drei Amateur- und/oder Vertragsspieler gleichzeitig an einem Spiel einer Lizenzmannschaft beteiligt sein.
Für Fußballclubs besteht gem. § 5 Ziffer 2 LOS die Möglichkeit, Spieler, die vertraglich bei einem anderen Club verpflichtet sind, auf Leihbasis einzusetzen.21Dazu ruht der beim verleihenden Club bestehende Arbeitsvertrag, so dass der leihende Club ein befristetes Arbeitsverhältnis schließen kann und somit auf bestimmte Zeit als Arbeitgeber fungiert.22
2.2Ablauf von Spielertransfers
Spieler, die entgeltlich oder unentgeltlich transferiert werden, stellen den größten Teil einer Lizenzmannschaft dar,ergänzt durch gem. § 5b Ziffer 1 LOS mindestens vier Spieler, die aus dem clubinternen Nachwuchs stammen.23Um die diversen, im Transferfall aufeinander treffenden Interessen der verschiedenen Parteien, bestehend aus Clubs, Spielern, Spielerberatern und Verband, zusammenzuführen, ist der Transferablauf verbandsrechtlich vorgegeben. Verbindliche Rahmenbedingungen finden sich auf nationaler Ebene in der LOS des Ligaverbands bzw. im durch die FIFA herausgegebenen Reglement bezüglich Status und Transfer von Spielern. Weitere Regelungen zum Transfer von Spielerwerten und zur Anstellung von Spielern geben UEFA und DFB vor.24
Üblicherweise findet der entgeltliche oder unentgeltliche Transfereines Spielers nach folgendem Schema statt: Ehe ein Lizenzspieler den Club wechseln darf, muss er in die Transferliste gem. § 4 LOS aufgenommen werden. Dies ist gem. § 4 Ziffer 2 LOS ganzjährig möglich, also auch außerhalb der Wechselperiode I vom 1.7. bis zum 31.8. sowie der Wechselperiode II vom 1.1. bis zum 31.1. eines Kalenderjahres. Für Lizenzspieler, die in die Transferliste aufgenommen werden sollen, muss gem. § 4 Ziffer 6 LOS sichergestellt sein, dass Verträge fristgerecht gekündigt werden bzw. auslaufen. Im Anschluss an den Vertragsabschluss mit dem aufnehmenden Club muss die Spielerlaubnis für den Spieler beim aufnehmenden Club durch die DFL gem. § 13 LOS erteilt werden. Diese wird benötigt, damit der Spieler in Spielen, in denen DFL oder DFB als Veranstalter auftreten, auflaufen darf. In Abbildung 2 wird der Transfervorgang schematisch dargestellt.
Abb. 2: Schematischer Ablauf eines Spielertransfers25
Der Vertragsabschluss zwischen Spieler und aufnehmendem Club ist ab Aufnahme in die Transferliste möglich,26während der Wechsel selbst an die Wechselperioden gebunden ist.
Für Spieler, die nach Ablauf eines Arbeitsvertrags transferiert werden, herrscht seit dem Urteilsspruch im Bosmann-Urteil des EuGH im Jahr 199527Ablösefreiheit, da ansonsten eine Einschränkung der Berufsfreiheit der Spieler bestehen würde.28Nur für Spieler, die vom aufnehmenden Club aus einem bestehenden Vertrag herausgekauft werden, zahlt jener an den abgebenden Club eine Transferentschädigung, auch als Ablösezahlung bekannt. Zudem tritt bei Spielern die Zahlung einer Ausbildungsentschädigung des aufnehmenden Clubs an den Ausbildungsclub in Kraft, sobald Spieler ihren ersten Profivertrag unterschreiben, und auch bei jedem weiteren Transfer, sofern der Spieler das 23. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Ob der Vertrag ausgelaufen ist oder der Transfer aus dem laufenden Vertrag heraus erfolgt, ist dabei unerheblich. Dies regelt Art. 20 i.V.m. Anhang IV des FIFA Reglements bezüglich Status und Transfer von Spielern.
2.3Vom Idealverein zum Wirtschaftsunternehmen
Obwohl im allgemeinen Sprachgebrauch der Begriff Fußballverein dominiert,führen im Lizenzfußball nicht mehr alle Fußballunternehmen die Rechtsform „e. V.“, wie es derzeit in der Bundesliga beispielsweise beim FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e. V., SV Darmstadt 1898 e. V. oder 1. FSV Mainz 05 e. V. der Fall ist.29Schließlich handelt es sich bei den Teilnehmern am Profifußball längst nicht mehr um Idealvereine, die die Voraussetzungen des § 21 BGB erfüllen,30wie es zu ihren Entstehungszeiten der Fall war,31sondern um kommerzielle Unternehmen mit steigenden Umsatz- und Transfererlösen32sowie signifikanten in den Lizenzkader fließenden Gehaltszahlungen.33Dennoch behalten einige Clubs die Rechtsform des e. V. im Namen, wie es unter anderem beim Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund der Fall ist, obwohl die Lizenzfußballabteilung längst in die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA ausgegliedert ist. Ob der Grund dafür, wie von Huwer angenommen, „die Camouflage des in der Öffentlichkeit als idealistisch empfundenen eingetragenen Vereins“34ist oder nur ein Relikt aus der Ursprungszeit der Vereinsgründung zum Ende des 19. Jahrhunderts35, lässt sich nicht mit Sicherheit feststellen. Allerdings wird vor dem Tatbestand der Rechtsformverfehlung bei Vereinen gewarnt, die nicht die Voraussetzungen des § 21 BGB, dafür aber die des wirtschaftlichen Vereins i. S. d. § 22 BGB erfüllen, jedoch in der Rechtsform des e. V. fungieren.36
Fußballclubs mit anderen Rechtsformen als der des Idealvereins gibt es, anders als in England, Frankreich oder Italien,37hierzulande erst seit 1998,38als es möglich wurde, Kapitalgesellschaften in den Rechtsformen der GmbH, der KGaA oder der AG39zum Spielbetrieb der ersten beiden Ligen zuzulassen, bzw. Vereine ihre Lizenzabteilung in eine Kapitalgesellschaft ausgliedern konnten.40Andere Rechtsformen als die des Idealvereins waren bisher für den Spielbetrieb untersagt.41Vor der Änderung mussten jedoch die Statuten des DFB geändert und durch den Bundestag gebilligt werden.42
Gründe für die Ausgliederung sind unter anderem die Möglichkeit, Investoren zu gewinnen43sowie der steigende Drang nach Etablierung der Clubs als Wirtschaftsunternehmen, um der immer stärker werdenden Professionalisierung44des Sports und wachsenden Vermarktungspotenzialen Rechnung zu tragen.45Die Ausgliederung spiegelt den Charakter der Lizenzspielerabteilung als Wirtschaftsunternehmen, das gewinnorientiert handelt, besser wider, zumal die Rechtsform des eingetragenen Vereins mit gemeinnützigem Ziel keine Gewinne erwirtschaften darf.46