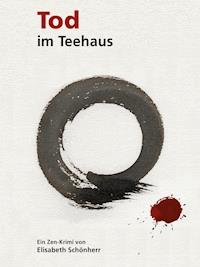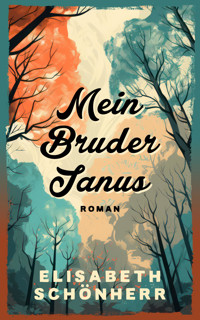Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Von gefälschten Originalen und echten Fälschungen In einer einsamen Villa am Stadtrand von Wien lebt eine alte Dame in einer versunkenen Welt voller Erinnerungen und kostbarer Antiquitäten. In ihrer Bibliothek hängt ein wunderbares Gemälde von Gustav Klimt. Wer das Bild sieht, will es besitzen. So verwundert es manchen Gast, dass das Gemälde noch immer an seinem Platz hängt, zumal bereits Einbrecher das Haus heimsuchten. Und obwohl in der Gegend um die Villa Diebe ihr Unwesen treiben, vermutet Chefinspektor Ivo Schalk die Einbrecher im Kreise der Familie und Freunde der alten Dame. Seine Ermittlungen scheinen erst eine Wendung zu nehmen, als neue Bewohner die Mansarde der Villa beziehen. Der Roman wurde von einer Jury der Verlagsgruppe Random House zum Top-Titel Twentysix April 2016 gewählt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 270
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bilder lügen nicht
TitelseiteDas BuchMottoPrologBegegnungenIm AtelierEdiths TräumeCamera obscuraDer ErmittlerDie alte DameEin echter LudekVersuchungenEin rechtschaffener BürgerLillys mysteriöser KundeDas StrandhausVersunkene WeltenAllerheiligenDas Herz des KäfersBilder lügen nichtNeujahrstreffenUnerwarteter BesuchFrühlingserwachenDas ewige LichtDie AuktionSommerfrischeGeige spielenDunkler WaldGlockengeläuteFalsche VersprechungenDer NotarNachkommenUnter WasserIn der WarteschleifeSchlange oder MausGlossarHinweiseDanksagungKapitelverzeichnisImpressumTitelseite
Bilder lügen nicht
Ein Fälscher-Roman
von Elisabeth Schönherr
Das Buch
In einer einsamen Villa am Stadtrand von Wien lebt eine alte Dame in einer versunkenen Welt voller Erinnerungen und kostbarer Antiquitäten. In ihrer Bibliothek hängt ein Landschaftsgemälde von Gustav Klimt. Wer das Bild sieht, will es besitzen. So verwundert es manchen Gast, dass das Gemälde noch immer an seinem Platz hängt, zumal bereits Einbrecher das Haus heimsuchten. Und obwohl in der Gegend um die Villa Diebe ihr Unwesen treiben, vermutet Chefinspektor Ivo Schalk die Einbrecher im Kreise der Familie und Freunde der alten Dame. Seine Ermittlungen scheinen erst eine Wendung zu nehmen, als neue Bewohner die Mansarde der Villa beziehen.
bilder-luegen-nicht.com
Die Autorin
Elisabeth Schönherr wurde 1971 in Tirol geboren. Seit 1998 lebt sie in Wien. Erste literarische Versuche reichen in ihre Jugend zurück. Später studierte sie Vergleichende Literaturwissenschaft und Slawistik und verbrachte längere Zeit in Russland und Polen. Neben ihrer schriftstellerischen Tätigkeit arbeitet die Autorin als Web- und Social-Media-Designerin.
elisabeth-schoenherr.info
Motto
Grelles Mittagslicht entblößte den Verfall des alten Schlosses. Grasbüschel, die aus den Spalten zwischen den gelockerten Steinen des Unterbaus ragten, abgesprungener Putz, rötliche Stellen am morschen Ziegelwerk, graue Wasserflecken, grüner Flechtenbewuchs.
Aus dem Roman Die Besessenen (Opętani) von Witold Gombrowicz
Prolog
Der Südwind schleuderte schwarze Wellen ans Ufer. Unten beim Bootshaus beutelte er eine Jacht auf dem stürmischen See. Der Schein einer Lampe fiel auf die Böschung. Ein Mann stieg den Weg von der Landstraße zur Uferpromenade hinab. Sein Auto hatte er in einiger Entfernung abgestellt.
Das Licht verlosch. Der Mann betrachtete die Schemen der umliegenden Häuser, deren zugeklappte Fensterläden an fest verschlossene Augen erinnerten, schritt dann auf das vor ihm liegende Anwesen zu. Bis jetzt verdeckten keine Holzverschalungen die Schnitzereien unter dem Schindeldach, um sie vor der Winterkälte zu schützen.
Der Herbst brach jedoch an, die Sommergäste waren abgereist. Über dem See lag Finsternis. Die Südseite der Villa mit ihren Giebeln, dem Balkon und der steinernen Terrasse versank in der Nacht.
Durch den Garten drang ein schriller Laut den Abhang empor. Wer das Geräusch nicht kannte, dachte vielleicht an ein verhageltes Metallglockenspiel. In Wahrheit rüttelte der Wind an der Takelage der auf dem Wasser schaukelnden Jacht.
Flink öffnete er das hölzerne Tor, schlüpfte ins Haus, leuchtete in den Salon, der dahinter lag. Die goldene Kassettendecke und die dunkelroten Tapeten schufen selbst im Licht des Tages eine Atmosphäre der Trübnis.
Der Schein der Lampe fiel in die hinterste Ecke der Diele. Von dort führten Stufen ins Obergeschoss und in der zweiten Etage eine Spindeltreppe in den Turm hinauf. Bei günstigem Wetter erblickte man aus dem obersten Fenster den Dachstein. Schon tappte er über die knarrende Treppe. Auch im Schlafzimmer darüber herrschte Finsternis. Wer die Villa nicht kannte, ahnte nicht, dass es im Sommer der schönste Raum war; morgens sah man vom Bett aus das Wasser des Sees funkeln wie einen großen türkisen Edelstein. Der Besucher zog einen Gegenstand aus der Tasche, legte ihn dorthin zurück, wo er ihn einst entdeckt hatte.
Eines Tages, dachte er, würde alles ihm gehören: das wunderbare Anwesen hier, die Villa im Wienerwald samt dem Garten mit den riesenhaften Bäumen, das Gemälde in der Bibliothek, die Biedermeiermöbel und das Porzellan. Es schien nur eine Frage der Zeit.
Begegnungen
Manche Menschen glauben, im Leben bleibe nichts dem Zufall überlassen: eine höhere Macht drehe die menschlichen Geschicke wie einen Faden um eine Spule. Edith hielt das für Unfug. Weder Schicksal noch Zufall hatten sie an jenem Septembermorgen in ein Kaffeehaus in Wien-Ottakring geführt. Vielmehr wohnte sie in der Gegend und hatte bei einem Besuch im Lokal den Pächter gefragt, ob er eine Kellnerin suche. Der hatte zur Antwort mürrisch genickt und sie daraufhin eingestellt.
Jetzt kniete sie auf dem Holzboden hinter der Theke und las die Scherben einer zerbrochenen Kaffeekanne auf. Die Uhr an der Wand zeigte fünf nach neun. Um sieben hatte ihr Frühdienst begonnen. Sie stand auf, um die Reste der Kanne in den Mülleimer zu werfen, blickte dabei zum Wirt, der bei den Stammgästen saß. Er schien ihr Missgeschick noch nicht bemerkt zu haben. Als genüge das nicht, schnitt sie sich in den Daumen. Sie hielt die Hand unter den Wasserhahn. Das Spülbecken färbte sich rot. Der Wirt hob den grauen, fast kahlen Schädel und kam herüber. Ein paar Sekunden, die Edith wie eine Ewigkeit erschienen, starrte er in das blutige Wasserbecken. Sie griff rasch nach einer Serviette, wickelte sie um den verletzten Finger, ließ Wasser in das Becken nachlaufen.
Ohne ihr in die Augen zu sehen, fragte er: „Was machst denn da für eine Schweinerei?“
Sie schwieg.
Da beugte er den schweren Kopf nach vorn und fügte leise hinzu: „Wenn das noch einmal vorkommt, fliegst raus, ist das klar?“ Endlich holte er ein Pflaster aus einer Schublade, drückte es ihr in die Hand und rief in die Küche: „Wir brauchen eine neue Kanne für den Filterkaffee.“
Dann setzte er sich wieder zu den Stammgästen, rauchte die nächste Zigarette, als wäre nichts geschehen.
Sie stand hinter der Theke, zupfte an der Jacke, die sie über die Bluse mit den Dreiviertelärmeln gezogen hatte. Die Wolle kratzte, doch ihr war kalt. Um kurz vor sieben war sie aus dem Bett gekrochen und durch die Dämmerung hierher gelaufen. Sie fixierte die hölzerne Eingangstür mit dem Jugendstilglas. Die Tür schwang auf und zu.
Gleich um acht werde er zur Post gehen, danach auf eine Tasse Kaffee vorbeikommen, hatte Philip am Vortag vor dem Einschlafen versprochen. Jetzt ließ er sich nicht blicken. Frühstücksgäste trafen ein. Teller mit Semmelresten und Eierschalen, Tassen mit eingetrockneten Kaffeerändern stapelten sich auf der Theke.
Sie räumte die Spülmaschine ein, dachte an Philips Aquarell aus Giżycko, einem Städtchen in Masuren im Nordosten ihrer Heimat. Sie war erleichtert, dass Lilly es endlich verkauft hatte, obwohl sie es eigentlich gern selbst behalten hätte. Es war hell und leicht, anders als die schwermütigen Bilder, die Philip sonst malte. Die Skizze zur Landschaft war auf einer Reise durch das Masurische Seengebiet entstanden, die sie vor Jahren gemeinsam unternommen hatten. Mit einem Schiff der Weißen Flotte waren sie an gelbgrünen Inseln vorbeigefahren und hatten auf ihrem Weg von Gewässer zu Gewässer enge Kanäle durchquert. Das Aquarell war mindestens dreitausend Euro wert, davon war Edith überzeugt. Lilly hatte es für tausend verkauft.
Wie auch immer, dachte Edith, sie freute sich auf Philips Vernissage. Sie hatte die Ausstellung organisiert und sogar an die siebzig Einladungen versandt. Im Veranstaltungskalender der aktuellen Ausgabe des Wiener Merkur stand eine Vorankündigung. Sie trug eine Flasche Bier zu den Spielautomaten. Dabei überlegte sie, wie viel einfacher ihr Leben wäre, wenn sie Geld hätte. Alles wäre einfacher, wenn sie Geld hätte. Keine großen Summen, sagte sie sich. Gerade so viel, dass es für sie und Philip reichte und sie all die Dinge tun könnten, die ihnen wichtig waren.
„Steh nicht rum“, rief der Pächter herüber, „schau nach den Toiletten.“
Edith beugte sich über eine schmutzige Kloschüssel. Der Boden darunter war klebrig. Der Geruch von Urin hing wie ein schmutziger Vorhang in der Luft. Es war Drecksarbeit, doch nachdem die Bank sie fristlos entlassen hatte, war sie froh über jeden Job, bei dem sich keiner nach ihrer Vergangenheit erkundigte.
Die letzten Frühstücksgäste brachen auf. Edith räumte die Tische ab. Jemand verschüttete Kaffee. Sie wischte das Parkett. Eine Spielerrunde tauchte auf. Sie leerte die Aschenbecher, brachte drei Weiße Spritzer, Hauswein mit Sodawasser gemischt, an den Tisch und fragte, was gespielt werde.
„Schwarze Katze“, schmunzelte ein Gast in Anzug und Krawatte; ein Beamter, vermutete sie, der vor der Langeweile im nahegelegenen Bezirksamt hierher geflohen war. Vor dem Fenster fuhr die Straßenbahn vorbei. Kurz darauf rauschte eine Limousine über die Kreuzung. Die Reifen quietschten und einige Gäste blickten auf, um zu sehen, wer es da so eilig hatte. Zu Ediths Erstaunen hielt der Wagen direkt vor dem Lokal. Eine Autotür sprang auf. Einen Moment hörte man Hundegebell und Geschimpfe. Dann knallte die Tür zu. Einen Augenblick später trippelte ein schmächtiger Herr in das Café. Er trug einen Trenchcoat, dazu Segelschuhe. In der Hand hielt er ein silbernes Gasfeuerzeug und eine Packung Chesterfield, unter seinem Arm klemmte eine Aktentasche.
„Guten Morgen, der Herr!“ Edith lächelte.
„Morgen“, murmelte der Gast und setzte sich an den Nischentisch neben der Tür. Es war ein Platz, der ihn vor Blicken schützte, aber Sicht auf das Lokal gewährte. Den Mantel legte er auf die Sitzbank gegenüber. Er schien das Kaffeehaus zu kennen, doch Edith hatte ihn nie zuvor gesehen.
„Was darf ich Ihnen bringen?“
„Eine Melange und ein Semmerl mit Marillenmarmelade.“
Als sie den Kaffee brachte, hatte er die erste Chesterfield zur Hälfte heruntergeraucht. Er las die Morgenzeitung. Auf dem Tischrand lagen ein Katalog des Wiener Auktionshauses Dorotheum und eine Ausgabe der Jacht-Revue.
„Dem Herrn seine Melange, das kleine Frühstück kommt gleich.“
Edith wagte nicht, in seine Augen zu sehen, bemerkte aber eine ungesunde, rötliche Bräune, die seine Wangen überzog. Als sie ihm das Tablett mit dem Kaffee vorsetzte, fiel ihr Blick auf seine Hände. Die waren damenhaft schmal und gepflegt. Ein paar Tropfen Kaffee schwappten über den Rand der Tasse, flossen auf den Teller.
„So schauen’s doch, was Sie tun.“ Er seufzte: ein gelangweilter, nasaler Ton, wie man ihn in den besseren Gegenden der Stadt noch manchmal hört. Er kramte nach einem Tuch. Edith eilte zur Theke, um eine Serviette zu holen. Kurz darauf nahm sie am Nachbartisch eine Bestellung auf. Unwillkürlich musterte er sie. Die blassen, eingefallenen Wangen und das strähnige Haar missfielen ihm. Straßenköterblond, dachte er.
Als sie später nochmals an seinen Tisch kam, bemerkte er das blutige Pflaster an ihrem linken Daumen. „Schrecklich, ganz schrecklich“, murmelte er und wandte sich ab.
Edith kehrte an die Theke zurück, sah zum Chef hinüber, der jetzt bei den Spielern saß. Die Frühstückszeit war verstrichen und die Mittagszeit ließ auf sich warten. Eine Gelegenheit, den vornehmen Herren zu beobachten. Der hatte sich beruhigt, blätterte im Wiener Merkur. Edith sah, wie er mit steinerner Miene den Leitartikel aufschlug, sich dann mit mehr Interesse dem Kulturteil zuwandte. Im Veranstaltungskalender stand die Ankündigung von Philips Vernissage.
„Haben Sie noch einen Wunsch?“ Edith versuchte, einen Blick in die Zeitung zu werfen.
Er zog an seiner Chesterfield, hustete, drückte sie aus. „Die Rechnung.“
Er bezahlte, ohne Edith eines Blickes zu würdigen. Wie zum Trost gab er ihr aber einen Euro Trinkgeld. Anschließend schlüpfte er in seinen Mantel und verließ das Lokal mit denselben flinken Schritten, mit denen er gekommen war.
Mit großen grauen Augen sah Edith ihm hinterher. Sie dachte an seine gepflegten Hände, an die Segelschuhe. Er wohnte nicht in der Gegend, da war sie sicher. Vielleicht gehörte ihm ein Häuschen auf einem der Hügel über der Stadt oder eine luxuriöse Altbauwohnung im Stadtinneren mit knarrenden Fischgrätböden und weiten auf einen Park gerichteten Fenstern, wo vom Herbstwind umflutete Platanen stehen.
Sie tauchte den Schwamm ins Spülwasser, um die Asche vom Tisch zu wischen, warf einen Blick auf die Bank dahinter. Die Zeitung hatte er liegen gelassen. Sie nahm den Wiener Merkur zur Hand. Der Stellenmarkt war aufgeblättert. Klein gedruckte Privatanzeigen. Putzfrauen und Haushälterinnen wurden gesucht. Sie überflog die Seite. Eine mit Kugelschreiber eingekreiste Anzeige sprang ihr ins Auge: Dame mit Kunstsinn sucht verlässliche Studentin für Haushalt und Gesellschaft. Großzügige Entlohnung.
Edith steckte die Zeitung in ihre Schürze, stellte die Getränkekarte auf den Tisch. Hinter der Theke nahm sie eine Schere, schnitt die Annonce aus und ließ sie in ihrer Tasche verschwinden.
Im Atelier
Der Schatten eines Menschen glitt über die Jalousie. Ein Bleistift kratzte auf Papier. Philip legte den Stift beiseite, zog das Rollo nach oben, öffnete das Fenster, streckte den Kopf hinaus. Die Zikaden, die in den Sommernächten den Hof vibrieren lassen hatten, waren verstummt. Der Herbst schickte seinen rastlosen Wind durch die Stadt. Philip hörte, wie er den Götterbaum im Hof schüttelte. Selbst im Winter hingen verwitterte Früchte von den Ästen.
Philip ging in die Garderobe, schlüpfte in eine Jacke. Auch ihm war kühl. Sein Blick fiel auf die Pinnwand über dem Telefon. Postkarten und Fotos hingen dort: die Paläste und Villen der Fabrikanten an der Piotrkowska, der Prachtstraße in der polnischen Stadt Lodz, die Birken im Hof der Filmhochschule. Er wusste, es war ein Ort, an den Edith mit Wehmut dachte. Mittlerweile lag es einige Jahre zurück, dass sie gemeinsam Polen bereist hatten. In einem Städtchen, etwa zwei Autostunden von Warschau entfernt, war Edith aufgewachsen. Im Gegensatz zur Hauptstadt war es kein Ort des pulsierenden Lebens. Selbst Philip, der anfangs so begeistert gewesen war von der Ruhe und der fast märchenhaften Stille, bemerkte bald die Langeweile, die trüb und schwer über den Backsteinbauten um den mit Kopfstein gepflasterten Marktplatz und der Burg mit der zerfallenen Stadtmauer hing. Auch die Stille hatte nichts Erholsames. Sie bedrückte eher.
Als er sich jedoch an einen Badetag an der Weichsel erinnerte, an das sandige Ufer des Flusses und den weißen Himmel darüber, ahnte er, was Edith zurückgelassen hatte. Gemeinsam mit ihr war er an einem Sonntagmorgen vom Plattenbau am Stadtrand, wo nur das Knattern eines Sportflugzeuges von Zeit zu Zeit die Stille durchbrach, durch die Kiefernwälder stadteinwärts spaziert. Aus den geöffneten Fenstern hörte man Fernsehstimmen. Den ganzen Sonntag lang strömten Menschen aus den Kirchen. Am Nachmittag fuhren sie zum Carrefour, einem französischen Hypermarkt an der Peripherie.
„In den Supermärkten arbeiten die Kassiererinnen bis zu zwölf Stunden ohne Pause“, erzählten die Leute. Von den Löhnen könne man kaum leben und die ausländischen Firmen würden keine Steuern zahlen. In den Augen der Nachbarn im Plattenbau hatte Edith es deshalb geschafft.
„Jeder, der von hier wegkommt, hat es geschafft. Niemand fragt, warum man wegläuft, nur wenn man zurückkommt, wundern sich die Leute und stellen Fragen.“
Und obgleich Krystyna, Ediths Mutter, bei ihren Anrufen und Besuchen gern erzählte, wie viel sich in ihrer Heimat mittlerweile zum Besseren gewandelt habe, war auch sie froh, dass ihre Tochter in Wien verheiratet war. Freilich ahnte Philip, sie hätte sich einen ganz anderen Schwiegersohn gewünscht. Einen besser situierten vielleicht, einen fleißigeren und verlässlicheren bestimmt. Er verübelte es ihr nicht. Eben hatte er den großen, gelben Briefumschlag, den er zur Post bringen sollte, auf dem Garderobenschrank gefunden. Er sah auf die Uhr. Das Postamt in der Nähe schloss in fünf Minuten. Nach dem Abendessen würde er zum Bahnhof fahren, um ihn abzuschicken. Philip dachte daran, wie Edith sich in aller Früh fröstelnd und feucht vom Duschwasser in ihre Servierbluse gezwängt hatte. Sie hatte von dem Wettbewerb geredet und dem Preisgeld, das sie sich davon versprach.
Draußen im Treppenhaus hörte er Schritte, gemächliche Schritte. Nein, Edith war noch nicht zurück.
Dennoch ließ er das Kuvert in einer Tasche verschwinden und kehrte ins Atelier zurück.
*
An den Wänden klebten Skizzen, die im Dämmerlicht an die Flügel schwarzer Vögel erinnerten. Auf dem Werktisch lagen Farbtuben, Spachteln, Messer, Paletten. Philips Leben war ohne Regeln, die tägliche Arbeit die einzige Konstante in diesem Widerstreit aus Formen und Farben. Er malte vom frühen Morgen bis zum späten Nachmittag, aß nichts zu Mittag. Nur eine Kanne Tee mit einer Zitrone stand bereit.
Er nahm die Krähenfeder, die Lilly ihm geschenkt hatte, um den Staub von einem Ölbild zu wischen, das sie ihm vor einigen Tagen zur Ansicht geliefert hatte. Keine große Sache, ein leicht beschädigtes Heiligenbild aus einer Dorfkirche. Er betrachtete die Risse auf der Oberfläche und stellte das Bild auf die Wandstellage mit den selbst gebastelten Keilrahmen. Dann schlug er ein großformatiges Buch auf. Es handelte sich um den Katalog zu einer Ausstellung, die vor zwei Jahren im Städtischen Museum gezeigt worden war. Er traf Vorbereitungen für den nächsten Auftrag.
Wie immer würde er Edith nichts verraten. Es ging um ein Ölbild auf Holz ohne Signatur, das Lilly einem Händler auf dem Flohmarkt für hundert Euro abgekauft hatte. Leider war es unvollendet, aber Lilly hatte am Telefon von den sorgfältig ausgearbeiteten Vorzeichnungen geschwärmt.
„Könnte ein Ludek sein. Der verkauft sich zurzeit gut.“
„Bring das Bild gleich vorbei.“
„Du bekommst es am Freitagabend.“
Wie immer hatte er sich für den Auftrag bedankt, als würde Lilly ihm einen Gefallen tun. Dabei war es anders. Ihm blieben Arbeit und Risiko. Lilly nahm das Geld.
Ediths Träume
Gegen sieben Uhr kehrte Edith aus dem Kaffeehaus zurück. Sie schimpfte über den Schmutz in der Küche, nahm die Tassen vom Tisch, leerte abgestandenen Tee und Milchkaffee in den Abfluss. Philip hatte vergessen, das Brot in die Brotlade zu legen. Auch die Butter hatte er nicht in den Kühlschrank gestellt. Sie wischte Krümel vom Tisch. Er stand wortlos daneben. Wenn sie von der Arbeit heimkam, hätte er sich am liebsten irgendwo im Atelier verkrochen, so gereizt war sie.
„Hast du wenigstens die Unterlagen zur Post gebracht?“, fragte sie.
„Welche Unterlagen?“
„Das weißt du genau.“
Sie wischte sich mit dem Ärmel über das müde Gesicht. Philip legte eine Hand auf ihre Schulter, fühlte die weiche Haut unter dem Ausschnitt ihres Shirts. Drei Monate hatten Alex und sie an dem Konzept für ihr Drehbuch gearbeitet. Wie richtige Filmleute hatten sie Schlüsselszenen entwickelt, das Storyboard auf Packpapier gezeichnet, an die hundert Karteikarten mit Notizen zu Figuren und Schauplätzen gesammelt. Die Karten lagen sortiert und wie Spielkarten gestapelt in einem Karton unter Ediths Bett. Am Vorabend hatte sie letzte Änderungen an der Geschichte vorgenommen.
„Ich hab’s zur Post gebracht“, behauptete Philip, goss dabei heißes Wasser in eine Teekanne.
„Warum hast du dich dann nicht bei mir blicken lassen?“
„Ein neuer Auftrag ist reingekommen.“
„Hat Alex bei dir angerufen?“
„Nicht dass ich wüsste.“
Alex war ein Bekannter, den Edith in einem Kino kennengelernt hatte. Auch er hatte die Aufnahmeprüfung für die Schauspielschule nicht geschafft, später Theaterwissenschaften studiert.
„Und die Miete? Ist die endlich überwiesen?“, fragte sie.
„Mach ich noch.“
„Hast du Geld dafür?“
„Lilly hat noch ein Bild verkauft“, sagte er.
„Welches?“
„Die Ölskizze von der Schwarzenbergallee.“
„Ich bin gespannt auf Freitagabend“, sagte sie.
Philip entgegnete nichts. Edith stellte den Kräutertee beiseite und nahm einen Schluck Bier aus der Flasche. Vierhundertfünfzig Euro zahlten sie Miete in diesem heruntergekommenen Zinshaus. Dazu kamen die Kosten für die Ausstellungsräume in der Grundsteingasse, eine kurzfristige Ausgabe zwar, doch dafür mussten sie ebenfalls selbst aufkommen. Lilly nahm dafür keine Prozente; immerhin hatte sie ihnen die Räume organisiert.
Edith und Philip, beide hatten Träume. Und obwohl Philips Träume bescheidener und näher an der Wirklichkeit waren, ließ er sich treiben. Er dachte selten weit voraus, wünschte sich höchstens ein geräumigeres Atelier, doch eigentlich war ihm auch die Kammer im Hinterhof in Ottakring recht, wenn nur Edith zufrieden war.
Edith hingegen wollte immer mehr. In ihren Träumen gab es ein Haus mit Garten, Rosen im Sommer, Hagebutten im Herbst, dreifarbige Katzen, Glückskatzen, die sich auf der verglasten Veranda sonnten, und in einer Senke einen Pool, in dem im Sommer zwei oder drei Kinder planschten. Gewiss, betrachtete man ihr Leben, so schien das vermessen, doch sie gestaltete ihre Träume mit derselben Kraft und Liebe zum Detail, mit der Philip seine Bilder malte. So hielt Edith das Gartenhaus in Neuwaldegg, das ihnen Lilly besorgt hatte, für einen Boten künftigen Glücks, für ein Geschenk, das ihr aus Gründen, die sie nicht verstand, nicht verstehen konnte, zugefallen war; auch wenn es winzig und desolat war, sie waren auf dem richtigen Weg.
*
Donald Paulus Moll zog sich in eine Ecke seines Arbeitszimmers zurück. Dort stand ein Sekretär aus Edelholz, vollgestopft mit Papieren. Eigentlich war das Schreibpult viel zu groß für den kleinen Raum. Es war eine Antiquität, wie sie in der Villa seiner Tante überall herumstanden, im Grunde genommen zu wertvoll für den täglichen Gebrauch und auch zu wenig handlich.
Unter dem Schreibtisch schliefen Molls Windhunde Ares und Hermes. Schakale nannte er sie manchmal im Scherz. Gegenüber stand ein Klavier mit aufgeschlagenen Noten, eine recht anspruchsvolle Nocturne von Chopin. Eben brachte ihm die Haushälterin seine geliebte Melange.
„Gehen’s, Frau Theresa, seien Sie so lieb, holen Sie mir eine Stange Zigaretten aus der Trafik!“ Er öffnete eine Schublade, holte ein Kuvert mit Geldscheinen hervor, gab ihr einen Hunderter. „Vom Rest kaufen Sie sich was Schönes.“
„Aber der Herr Doktor hat g’sagt ...“
„Na, was denn.“
Theresa wäre das Herz des Hauses gewesen, wenn es ein Herz gegeben hätte. In jedem Fall der einzige Mensch, von dem er sich etwas hätte sagen lassen. So rauchte er vor dem Aufstehen im Bett zwei bis drei Zigaretten. Dann aber spürte er ein Stechen in der Brust und bekam es wieder mit der Angst zu tun. Der Arzt hatte ihm das Rauchen verboten, stattdessen sollte er mit den Hunden spazieren gehen. Das wäre auch ein probates Mittel gegen die Melancholie.
Moll richtete sich auf, seufzte, schlurfte in Pantoffeln und Morgenrock zum Fenster hinüber, um einen Blick in die Straßenschlucht hinabzuwerfen. Auf dem Schreibtisch leuchtete eine Lampe. Er hasste die Düsternis seines Arbeitszimmers. Knappe fünfzehn Quadratmeter voller Bücher und Aktenschränke. Er hüstelte. Sicher, als seine Mutter noch gelebt hatte, war seine Lage noch unerträglicher gewesen. Mutter und Sohn auf achtzig Quadratmetern zusammengepfercht. Im Winter kein Licht, im Sommer die drückende Schwüle des Zwischengeschosses, beschönigend Mezzanin genannt. Dazu die Mutter, die ständig in seinen Sachen wühlte. Natürlich hätte er sich eine eigene Wohnung mieten können, doch er brauchte das Geld für seine Reisen und das Boot. Moll drehte an der Kordel des Morgenrocks. Er wollte sich anziehen und ins Café Hummel gehen. Der Ortswechsel würde auch seiner Arbeit guttun.
Er blätterte in Hans Mayers Monografie über Richard Wagner. Vor fünf Tagen war er in Zürich gewesen und hatte eine allzu zeitgemäße Inszenierung des Fliegenden Holländers mit Video-Installationen über sich ergehen lassen. Für den Landboten schrieb er nun einen Verriss, brillant gewiss, aber auch böse, wie man sich das von ihm erwartete. Grundtenor: Der Fliegende Holländer erleide Schiffbruch. Ein optischer Reiz allein trage eben keine Geschichte. Von postmoderner Beliebigkeit war da die Rede, ebenso von einer maroden Moderne und von der kolossalen Lieblosigkeit unserer Zeit.
Geschickt spannte er den Bogen vom jungen Wagner in Paris, einem Moment gescheiterter Ambition, narzisstischer Kränkung und Eifersucht, hin zur übersteigerten Erlösungsidee des Holländers. Gern hätte Moll den Text seinem ehemaligen Wiener Stammblatt angeboten. Doch dort wollte man nichts mehr von ihm drucken, obwohl seine Kritiken und Glossen dreißig Jahre Flaggschiffe des Verlags gewesen waren. Jetzt sah man dort junge nichtssagende Gesichter ohne Gesinnung und Arbeitsverträge. Ihn hatte man in den Ruhestand gedrängt.
„Wo bleiben die Zigaretten?“, rief Moll in die Küche hinaus.
Theresa kam. Auf einem Tablett trug sie eine geöffnete Packung Chesterfield und einen Brief. Als er seinen Vornamen auf dem Kuvert las, erfasste ihn Wut. Wegen diesem lächerlichen Donald Paulus war er als Kind oft gehänselt worden. Nachdem er das Kuvert aufgerissen hatte, besserte sich seine Laune aber deutlich. Es war der Kostenvoranschlag der Versicherung. Jetzt musste er nur noch seine Tante überzeugen, deren Sturheit ihm seit Jahren das Leben erschwerte. Am Nachmittag würde er nochmals nach Dornbach fahren, um mit ihr zu sprechen.
*
Es war Freitagnachmittag. Am Abend würde Philips Ausstellungseröffnung sein. Mit spitzen Fingern hob Edith den Deckel der Mülltonne, hielt den Atem an. Fliegen schwirrten herum. Sie warf eine Bananenschale auf den Müllberg. Dabei fiel ihr Blick auf die Rosette am Tor. In Philips Atelier hing ein Foto des Jugendstilglases. Das Glas war trüb von Schmutz und an mehreren Stellen zerbrochen, aber er mochte es wie vieles in diesem Haus. Über der Rosette sah sie die Fenster im Treppenhaus, die selbst, wenn es kalt war, offenstanden. Sie dachte an die hohen Stromrechnungen im Winter und ärgerte sich über die Gleichgültigkeit der Nachbarn. Im Haus wurde ausschließlich mit Strom geheizt. Edith stieg die Steintreppe in das Obergeschoss hinauf. Ehe sie die Wohnungstür am Ende des Korridors erreicht hatte, warf sie einen Blick in den Hof hinab. In einem Häuschen mit löchrigem Ziegeldach lebten verwahrloste Jugendliche. Bierdosen und Weinflaschen lagen herum. Manchmal sah sie einen der jungen Männer inmitten von halb verrottetem Hausrat seine Notdurft verrichten. Auch zwei Katzen, eine weiße und eine graue, lebten dort unten. Edith fütterte sie regelmäßig.
Die Jalousien in der Küche und im Schlafzimmer waren heruntergezogen. Auch hinter dem Mattglas der Türe zu Philips Atelier war es still. Philip war sicher gleich nach dem Frühstück in die Grundsteingasse gefahren, um letzte Vorbereitungen für den Abend zu treffen und erst vor kurzem zurückgekehrt. Jetzt schlief er. Edith hatte ihm aufgetragen, Wein, Bier und Knabbergebäck zu kaufen. Als sie das Haus um kurz vor sieben Uhr verlassen hatte, war die Kennmelodie der Radionachrichten aus seinem Atelier gedrungen. Wie immer war er früh aufgestanden, um die Zeit zu nutzen und an einer Skizze zu arbeiten.
Edith ging ins Schlafzimmer, um die Rollos an den Fenstern hinaufzuziehen. Im Sommer verschluckten die Blätter der Kastanienbäume auf der Hasnerstraße das ohnehin spärliche Licht. Nur im Winter, wenn die Blätter abgefallen waren, drang dünnes Sonnenlicht in das Zimmer. Philips Atelier lag gegenüber. Es war größer, heller. Eine Zwergpalme und zwei Kakteen standen auf dem Sims des Fensters. Selbst im Winter wärmte die Sonne den Raum und im Sommer blieben wegen der Hitze tagsüber oft die Jalousien verschlossen.
„Das Haus ist schrecklich heruntergekommen“, hatte Lilly gelästert, als sie zum ersten Mal hier gewesen war.
Edith hatte nichts erwidert, doch heimlich zugestimmt. Philip aber schien nur den Stuck an den Decken und die feingliedrigen Jugendstilfenster zu sehen. Weder der Schmutz im Hof noch die Mäuse und Ratten, die nachts unter dem Kellergitter hervorkrochen und durch das Treppenhaus liefen, störten ihn.
Nach dem Essen legte sich Edith auf ihr Futonbett, knipste das Licht aus. Draußen dämmerte es. Auf dem Schreibtisch neben dem Bett lag ein Stapel sorgsam sortierter Farbkopien. Es waren von ihr zusammengestellte Presseunterlagen: Philips Lebenslauf mit einem ausführlichen Werkverzeichnis. Niemand würde es lesen, doch jedes Mal, wenn Edith im Dämmerlicht zum Schreibtisch hinüberblickte, erfüllte sie eine unbestimmte Freude und Zuversicht.
Sie war frisch geduscht und hatte ein Handtuch um den Kopf gewickelt. Über dem Bett an der Wand hingen Kinoposter sowie aus Bildbänden gelöste Fotografien. Zwei Männer, ein alter und ein junger, auf einem Segelboot. Der Alte hält dem Jungen ein Messer entgegen. Es war ein Standbild aus dem Film DasMesser im Wasser von Roman Polanski. Gegenüber hing ein Foto von Faye Dunaway, die mit einer Zigarre im Mund und einer Pistole in der Hand lässig vor einer schwarzen Limousine posierte, eine Szene aus Arthur Penns Bonnie and Clyde.
Edith knotete das Handtuch auf, massierte ihre Stirn. Sie musste an Lilly denken. Einmal hatte sie in Lillys Dachgeschosswohnung in der Josefstadt gesessen. Überall hingen dort Erinnerungsstücke von Reisen: eine japanische Trommel, Massai-Holz-Skulpturen. Die Flusssteine, die Lilly in einem Weidenkorb auf der Anrichte im Wohnzimmer aufbewahrte, hatten sie besonders angezogen. Lilly hatte die Steine aus Neuseeland mitgebracht und von einem Steinmetz polieren lassen.
Während Edith kurz alleine war, nahm sie einen der Steine und steckte ihn in ihre Tasche. Gleich darauf kehrte Lilly mit einer Kanne Tee zurück. Edith hielt den Stein ganz fest zwischen ihren Fingern, als hätte sie Angst, Lilly würde ihr den Schatz aus der Tasche ziehen. Sie blicke auf ein erfülltes Leben zurück, hatte Lilly dann gesagt, obwohl Edith nicht danach gefragt hatte.
Camera obscura
„Vor dreißig Jahren gehörte die Gegend hier zu den besten Einkaufsadressen Wiens“, behauptete Edith.
Philip hörte die Enttäuschung in ihrer Stimme und beobachtete ihre Augen, die die leere Gasse absuchten. Da war ein Feuer, das langsam erlosch. Sie lehnten am Eingang. Die Holzstände auf dem Brunnenmarkt standen leer. Irgendwo wurde mit einem Besen über nassen Asphalt gefegt. Der Geruch von Kebab mischte sich mit der Regenluft. Ein Geruch von Lila. Philip fand, dass der Herbst lila roch. Er liebte den Indianer-Sommer. Gern wäre er mit Edith an den Comer See gefahren oder auf eine griechische Insel geflogen, in eines der einsamen Hotels am Strand, wo sich um diese Jahreszeit wiederkehrender Regen über die Küsten ergießt, das Meer aber immer noch warm ist.
Er legte Edith sein Sakko um die Schultern, fühlte ihre weiche Haut. Sie trug das Seidenkleid, das er ihr zum dreißigsten Geburtstag geschenkt hatte. Er liebte das Graublau. Es war die Farbe ihrer Augen. Es passte zu den lila Flecken, die auf ihre Wangen traten, wenn sie miteinander schliefen; was im Übrigen viel zu selten geschah. Doch es war jetzt nicht die Zeit, um über das Warum nachzudenken, das ihn sonst manchmal quälte. Er nahm einen Schluck Bier.
„Betrink dich bitte nicht.“
Er schüttelte den Kopf.
Edith beugte sich ein wenig nach vorn. Er roch ihren süßen Atem. Sie lutschte ein Bonbon, ließ den Blick durch den kargen Raum wandern.
„Scheiß Beleuchtung“, flüsterte sie und sah zu den nackten Glühbirnen an der Decke. Sie senkte die Hand, legte die Plastikfolien mit den Presseunterlagen beiseite. Ein paar Besucher standen herum. Der Tisch mit den Getränken und Brötchen war fast unberührt.
An den Wänden hingen Öl-Skizzen und Aquarelle, aber auch Fotografien, die im vergangenen Sommer entstanden waren. Kolkraben auf einem brachliegenden Acker. Rehe auf einer Lichtung im Pötzleinsdorfer Schlosspark. Die Aufnahme einer grünhäutigen Schlange, die auf dem Steinpflaster der Höhenstraße überfahren worden war, hing neben dem Aquarell aus Giżycko. Edith hatte den Vermerk verkauft seitlich auf dem Rahmen angebracht, doch Philip hatte die Notiz wieder entfernt.
Das übliche Publikum, das man sonst bei Vernissagen antrifft, hatte sich nicht eingefunden. Keiner stellte Fragen zu den Bildern. Niemand interessierte sich für die Verkaufspreise. Und Zeitungsleute waren auch keine gekommen. Stattdessen streunte eine Handvoll Schaulustiger umher. Jugendliche, angezogen vom leuchtenden Schaufenster und den Bierkisten vor der Tür, traten kurz ein, blickten sich um, zogen weiter.
Ein Obdachloser hatte sich mit einer Flasche Bier in eine Ecke verkrochen. Philip nickte ihm zu, worauf er den Kopf senkte. Er hielt die Geste wohl für eine Aufforderung zu verschwinden, dabei störte er ihn nicht. Edith hatte zwei Schauspieler bestellt, ein burschikoses Mädchen mit dunkler Stimme und einen schmächtigen Kerl in einer abgewetzten Lederjacke. Die beiden sollten ein wenig das Publikum aufmischen, für Unterhaltung sorgen, aber auch für Verwirrung.
„Wir werden mit der Performance warten, vielleicht kommen noch Gäste“, ordnete Edith an.
Es war kurz vor elf. Der Abend schien gelaufen. Nicht einmal Lilly hatte es der Mühe wert befunden aufzutauchen. Nur ein paar Schulfreunde von Philip waren gekommen. Sie tranken Bier und spielten mit seiner Camera obscura. Es war eine selbst gebastelte Holzkiste mit verschiebbarem Transparentpapier auf der Rückseite, um die Brennweite einzustellen. Vorn steckte ein drehbarer Deckel mit verschieden großen Löchern, der die unterschiedlichen Blenden eines Fotoapparats simulieren sollte. Zusätzlich war an der Halterung eine Lupe montiert.
Edith trat auf die Straße hinaus, um frische Luft zu schnappen. Sie hob den Kopf, starrte in den Himmel über der Stadt. Er war kohlschwarz. Darunter hing ein voller Mond. Kurz darauf drängte ein Peugeot Coupé in eine Parklücke gegenüber. Im Scheinwerferlicht erkannte sie Lillys schmalen Kopf mit der fein geschwungenen Nase und den aufgeworfenen Lippen, hinter denen sich ein Lebenshunger verbarg, für den manche Frauen zahlen. Lilly gehörte nicht zu ihnen.
Es nieselte. Edith lehnte unter dem Vordach. Lilly hatte keinen Schirm dabei. Für sie kein Grund zur Eile. Langsam näherte sie sich. Sie war nicht allein gekommen. Ein deutlich jüngerer Begleiter folgte ihr.
„Das Wetter ist doch grauenhaft“, sagte sie mit ihrer heiseren Stimme, strich dabei eine dunkle Locke aus der Stirn. Der Tonfall verriet keinen Ärger, vielmehr Gleichgültigkeit. Lilly trug ein knielanges violettes Kleid mit silbergrauen Pailletten an der Vorderseite. Wieder einmal war Edith überrascht, wie klein und zart sie vor ihr stand. In ihren Gedanken war sie groß und drängte sich immerfort in ihr Leben.
Lilly stellte sich zu Edith unter das Vordach, kramte in ihrer Tasche, holte Zigaretten hervor, beugte sich zur Seite und zündete sich eine an.
„Ich dachte, du hast mit dem Rauchen aufgehört“, sagte Edith. Lilly hatte hunderte Male mit dem Rauchen aufgehört und Edith kostete diese Schwäche aus wie roten Wein.
„Wie war der Sommer in meinem Gartenhaus?“, fragte Lilly.
Mein Gartenhaus. Edith ärgerte sich. Es war eine Holzhütte, nicht mehr, außerdem hatte Philip ihr dafür drei Bilder überlassen, die sie mit Sicherheit für gutes Geld verkauft hatte.
„Im Frühjahr wärt ihr wohl wieder gern draußen in Neuwaldegg?“
Edith antwortete nicht. Wer wusste, was im nächsten Jahr sein würde. Stattdessen musterte sie Lillys Begleiter, einen kleingewachsenen Mann um die dreißig mit dunkelblonden Locken, eine Spur zu pummelig.
Lilly hatte ihn als ihren neuen Assistenten vorgestellt. Irgendwie erinnerte er Edith an ein Engelchen in einer Barockkirche. Dann hieß er auch noch Sebastian. Vielleicht war er schwul. Jedenfalls schlief Lilly nicht mit ihm, dachte Edith. Nun zündete auch er sich eine Zigarette an. Während er rauchte, wanderten seine Augen umher, angezogen vom Licht der Ausstellungsräume. Neugierig, aber auch ein wenig unsicher, misstrauisch.
„Wie läuft der Job im Kaffeehaus?“, wollte Lilly wissen.
„Kein Grund zur Klage“, entgegnete Edith trotzig.
„Man sieht dich immer noch früh morgens servieren?“, fragte sie. „Da hätte ich einen gemütlicheren Job für dich. Ein Bekannter von mir sucht eine verlässliche Betreuung für seine Tante. Ruf ihn doch an.“ Lilly kramte in ihrer Tasche nach der Visitenkarte, konnte sie aber nicht finden. „Ich schicke dir die Nummer per Mail.“
„Viel unterwegs? Wundert mich, dass du überhaupt noch zum Arbeiten kommst.“ Lillys Begleiter klopfte Philip auf die Schulter, deutete auf die Bilder an den Wänden. Die Vertrautheit der Geste überraschte sie.
Lilly, Philip und Sebastian zogen sich in eine Ecke zurück. Edith kümmerte sich um die Gäste. Es standen immer noch ein paar Leute herum. Mario, ein Schulkollege von Philip, war mit einem Mädchen aufgetaucht. Sie hatten zu viel getrunken, zogen nun schäkernd umher.
„Das würde ich mir gern in mein Schlafzimmer hängen.“ Das Mädchen zeigte auf eine grüne Urwaldlandschaft mit einem schlafenden Kind.
„Das Ölbild besteht aus mehr als fünfzig Grüntönen. Es ist eine Hommage an Henri Rousseau, den Zöllner, einen Autodidakten im Übrigen, den Philip sehr schätzt“, erzählte sie.
„Wie viel kostet es?“
„Da muss ich ihn fragen.“
Edith sah sich um. Philip war fort. Sie trat zur Tür, blickte in die Nacht hinaus. Dabei beobachtete sie, wie Lilly sich über den geöffneten Kofferraum ihres Peugeots beugte, während Sebastian einen Schirm hielt und Philip einen in Luftpolsterfolie verpackten Gegenstand aus dem Auto hob.
„Philip ist tatsächlich ein genialer Bursche. Er könnte einen Monet kopieren und damit den erfahrensten Kunstsammler aufs Glatteis führen.“
Lilly war zurückgekehrt. Sie blinzelte Philip neben sich zu. Edith erschrak über den Scherz, sagte aber nichts. Lilly verabschiedete sich ohnedies bald. Sie sei in Eile. Am folgenden Tag würden Geschäfte in München warten.
Der Ermittler
Chefinspektor Ivo Schalk lag auf der Couch seiner kleinen Dachgeschosswohnung mit Blick auf den Liechtensteinpark im neunten Wiener Gemeindebezirk. Auf dem Tisch neben dem Sofa befanden sich eine Baseball-Mütze, eine Zeitung und eine Schachtel mit den Resten einer Pizza. Den ganzen Tag lang hatte er nichts Ordentliches gegessen und nach Dienstschluss bei der Heimfahrt diese mit Salami und Peperoni belegte Pizza verschlungen. Zu Hause eingetroffen, drückte ihn der Magen. Er seufzte, streckte sich auf dem Sofa aus. Aus dem Fernseher drang die Stimme einer Frau Inspektor.