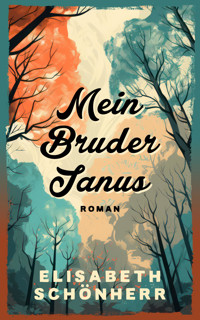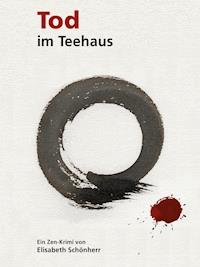
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Als Katharina Sakura eines Morgens leblos im Gartenteich vor ihrem Teehaus aufgefunden wird, gibt ihr Tod Rätsel auf. Denn das Mädchen ist nicht ertrunken, sondern an einer Verletzung verstorben. Die Behörden gehen vorerst dennoch von einem Unfall aus, während Boulevardmedien die Eltern im Visier ihrer Berichterstattung haben. Doch bald schon führen die Spuren in ein buddhistisches Zendo. Außerdem treibt sich ein geheimnisvoller Obdachloser in der Gegend um den Garten der Familie herum. Inspektor Marek ist alarmiert. Er verdächtigt eine Freundin der Toten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 261
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Tod im Teehaus
Über dieses BuchProlog1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.GlossarBibliografische NachweiseWidmung und DankImpressumÜber dieses Buch
Die Geschichte, von der ich erzählen werde, hat sich vor einigen Jahren ereignet. Die Personen tragen jedoch andere Namen und Merkmale, um eine Identifizierung der wahren Beteiligten auszuschließen. Aus diesem Grund ist auch ein Teil der Schauplätze fiktiv, obwohl die Ereignisse gerade dort hätten stattfinden können.
In den vergangenen Monaten habe ich mich bemüht, alle Akten und Dokumente, die zu diesem Fall vorliegen, zu studieren. Soweit es mir möglich war, führte ich Gespräche mit den Beteiligten, und obgleich gewiss immer noch einiges im Dunkeln liegt, habe ich nun eine Vorstellung davon, was damals geschah.
„Das Gesicht eines Menschen erkennst du bei Licht, seinen Charakter im Dunkeln.“ (Asiatische Weisheit)
Prolog
In jener Nacht kauerte Yumiko am Rand der Matratze und schaute in die Dunkelheit. Für einen Augenblick machte sie Licht, setzte sich auf, rutschte zur Mitte, ließ den Kopf in das Kissen sinken. Schließlich griff sie nach der feuchten Bettdecke, zog sie bis zum Kinn hinauf. Als sie den Schweiß roch, stieß sie die Decke wieder weg. Ihr Mann schlief auf der anderen Seite des Bettes. Mit leicht geöffnetem Mund lag er da und atmete tief. Yumiko verstand nicht, wie er schlafen konnte.
Allmählich sickerte Morgenlicht in den Raum. Bald erreichte es den Wandschrank gegenüber. Es war ein antiker Schrank mit knarrenden Türen und tiefen dunklen Fächern, ein Hochzeitsgeschenk eines Freundes ihres Mannes. Yumiko hatte den Schrank nie gemocht.
„Wo der wohl schon überall gestanden hat?“, pflegte sie zu sagen, denn sie fürchtete, Gegenstände mit viel Vergangenheit könnten Unglück ins Haus bringen.
Als die Vögel hinter dem Haus mit ihrem Gesang begannen, stand Yumiko auf und stellte sich unter die Dusche. Ein flüchtiges Gefühl der Erleichterung erfasste sie, als das lauwarme Wasser über ihren schmalen Körper lief. Sie schlüpfte in ein frisches Nachthemd, dann in ihren Bademantel, worauf sie das Nebenzimmer betrat und die Bambusrollos nach oben zog. Die Bettdecke war glatt gestrichen, das Bett noch immer leer. Am Boden lag ein Kissen. Sie hob es auf, strich es zurecht und legte es auf das Bett. Irgendwann in der Nacht hatte sie das Kissen an sich gedrückt. Als der vertraute Geruch durch die Nase in ihr Hirn gedrungen war, hatte sie ihre Tränen und mit ihnen ihren Speichel hineinfallen lassen und es dann voller Verzweiflung auf den Boden geschleudert.
Aus ihrem Atelier, das auf der anderen Seite des Korridors in einem Wintergarten lag, schaute Yumiko in den Garten. Eine Tanne stand ein wenig schräg im Wind. Für einen Moment glaubte sie, jemand beobachte sie aus dem Dickicht dahinter. Geschwind schloss sie die Jalousien.
Um auf andere Gedanken zu kommen, betrachtete sie das Bild, das sie am Nachmittag gemalt hatte. Es war keines der blassen Landschaftsbilder aus Tusche, die sie von Zeit zu Zeit malte, weil sie ihrer Tochter gefielen, sondern eines der bunten Ölbilder, die ansonsten in ihrem Atelier lagerten. Sie stellte es zum Trocknen an den Fuß des Werktischs, der sich in der Mitte des Raumes befand.
Danach holte sie ihre Zigaretten und betrat das Arbeitszimmer ihres Mannes. Auf dem Schreibtisch vor dem Fenster stand ein offener Laptop. Daneben lagen ausgedruckte Papiere mit Notizen an den Rändern. Unter dem Tisch befand sich ein Rollwagen mit verschließbaren Laden. An einer steckte ein Schlüssel. Yumiko öffnete die Lade. Auch hier stapelten sich Papiere. Sie nahm ein Blatt auf, begriff jedoch nicht, was darauf geschrieben stand. Achtlos ließ sie es wieder fallen, schloss die Lade.
Eben wollte sie in das Schlafzimmer zurückkehren, da fiel ihr Blick durch das Fenster in den Garten. Zwischen Wolken schaute der Mond hervor. Am Ende des Gartens stand das Teehaus, über dessen Holzdach allmählich die Dämmerung verschwand. Davor lag der Teich, auf die Wasserfläche fielen die Schatten einer Weide.
Yumiko betrachtete das grünliche Schwarz. Einen Augenblick schien ihr, als treibe dort etwas Bleiches, das sich schon aufzulösen begann und bald wieder von der Spiegelung des Morgenlichts verdeckt wurde. Es war wohl ein Trugbild, dachte sie, eine Laune der Natur, dennoch wollte sie nun im Garten nach dem Rechten sehen.
Auf dem Tisch der Veranda stand ein voller Aschenbecher neben schmutzigen Biergläsern. Vorsichtig stieg sie die Stufen in den Garten hinab. Sie schlüpfte in Pantoffeln, die ihr viel zu groß waren, und schlurfte entlang der Trittsteine in Richtung Teich. Auf dem Steg, der über das Wasser führte, hielt sie und warf einen Blick hinunter, dann ging sie weiter zum Teehaus. Die Tür stand offen. Der Raum war fast leer. Nur eine Holzbank mit einer Vase voller Wiesenblumen und einem schwarzen Buddha befand sich darin. Der Buddha hielt den Nacken gesenkt und den Blick abgewandt.
Yumiko kehrte zum Teich zurück, setzte sich auf die Bank daneben. Irgendwo in der Nachbarschaft bellte ein Hund. Auf dem Fußweg vor dem Haus waren Schritte zu hören. Sie zündete sich eine Zigarette an. Für einen Augenblick wurde ihr Kopf ganz leicht. Dann jedoch geschah etwas Seltsames. An einer seichten Stelle des Teichs, wo sie im Spätherbst eine tote Schlange gefunden hatte, hörte sie ein Plätschern.
Sie nahm das Netz, das an der Bank lehnte, und beugte sich über das Ufer. Dort glaubte sie ein Gewirr von Haaren inmitten von Blättern zu erkennen. Bald verschwand der Schopf im Morast, dann tauchte er wieder auf. Ein Weilchen stocherte sie so im Wasser herum, versuchte, das Büschel mit dem Netz aus dem Wasser zu ziehen, bis sie an etwas Hartes stieß. Als sie dann auf den Steg trat und hinunterschaute, wollte sie erst gar nicht glauben, was sie da sah.
Sie warf sich auf die Knie, griff in das kalte Wasser. Ein zusammengekauerter Körper trieb da auf dem Grund. Vom Gesicht war nichts zu erkennen, nur Finger mit einem Ring zwischen dem fliehenden Haar. An diesem Ring erkannte Yumiko ihre Tochter, auch wenn schon die zarten, im Wasser taumelnden Schultern dazu genügt hätten.
Gleich darauf erfüllte ein Schluchzen den Garten, drang von dort über die Bambushecken zum Fußweg vor dem Haus, woraufhin eilige Schritte sich entfernten.
1.
Einige Tage zuvor hatte Johanna das Zendo besucht und dort Katharina zum letzten Mal lebend gesehen. Sie erinnerte sich deshalb so genau, weil sie etliche Wochen nicht dort gewesen war. Sie litt noch immer an den Folgen eines Einbruchs in ihre Wohnung. Wegen der dabei erlittenen Verletzung hatte sie sogar einige Tage im Krankenhaus verbracht. Wie sie später erfahren sollte, war zu jener Zeit auch Katharina selten in das Zendo gekommen.
Im Krankenbett hatte Johanna oft an die junge Frau denken müssen. Sie war klug, schön und gerade mal sechzehn. Ihre vielfältigen Interessen und Fähigkeiten und der Rückhalt eines wohlhabenden Elternhauses versprachen ihr eine glänzende Zukunft, während Johanna immer öfter das Gefühl hatte, ihr Leben zerfalle wie eine Festung aus Sand. Alleinstehend und ohne abgeschlossene Berufsausbildung hatte sie bis jetzt weder privat noch beruflich nennenswerte Erfolge vorzuweisen. Oft wünschte sie sich, sie hätte die Dinge so genommen, wie sie gekommen waren, und das Beste daraus gemacht, anstatt immerzu auf irgendetwas zu warten, wobei sie noch nicht einmal wusste, worauf.
Vermutlich war das der Grund, warum sie sich schließlich dem Zen zuwandte. Geht es beim Zen doch um die Wertschätzung der kleinen Dinge, während den vermeintlich großen Ereignissen des Lebens wie Liebe, Tod und Geburt mit mehr Gelassenheit begegnet wird, als dies in einer christlich geprägten Kultur der Fall ist. An jenem Abend hatten sie beinahe vollzählig versammelt um Bashos Tisch gesessen, Tee getrunken und geplaudert. In der Mitte hockte ein Buddha aus schwarzem Stein, zu dessen Füßen eine Kerze brannte. Der Raum um den Tisch war im Dunkeln gelegen. Nur vor den Fenstern waren bemalte Gläser gestanden, in denen kleine Lichter flackerten.
„Hast du die Gläser bemalt?“, fragte Johanna.
„Ein Geschenk von Katharina, liebste Jeanne“, entgegnete Basho.
War Basho gut gelaunt, so nannte er sie Jeanne. Der Name erinnerte ihn an seine Tage in der belgischen Stadt Mons, die er zu den glücklichsten seines Lebens zählte, wie er Johanna einmal anvertraut hatte. Auf seinem Gesicht lag ein verschmitztes Lächeln. Er freute sich, dass so viele Leute gekommen waren.
„In den letzten Wochen war wenig los hier.“
Sie erwähnte daraufhin den Einbruch in ihre Wohnung und ihre Zeit im Krankenhaus.
„Nach diesem Schrecken verständlich“, sagte er. „Die Frage ist nur, ob Medizin da hilft?“
Als sie keine Antwort gab, fuhr er fort: „Vielleicht wärst du besser zu uns gekommen, um mit uns zu sitzen.“
Innerhalb der Gemeinschaft bedeutete Sitzen eine Atemmeditation im Fersensitz.
„Ich habe mir jedenfalls fest vorgenommen, jetzt wieder regelmäßig in das Zendo zu kommen“, versprach sie.
Wie um ihren Entschluss zu bekräftigen, glitt ihr Blick zur Wand, wo ein Porträt von Katsumi Tokusan, Bashos Meister, hing. Seine schwarzen Augen blickten ins Leere. Beinahe übermenschliche Ruhe und Konzentration gingen von ihnen aus.
„Hast du den Film über Tokusan dabei?“, fragte sie.
Basho machte eine abwehrende Handbewegung. „Ich habe ihn selber noch nicht gesehen.“
Als Johanna ihn später nochmals danach fragte, verschwand er im Nebenraum und kehrte mit einem schwarzen Karton zurück. Kurz vor dessen Tod hatte das französische Fernsehen diesen Film über Katsumi Tokusan gedreht. Tokusan war nach dem Zweiten Weltkrieg aus Japan nach Belgien gekommen, „um den Samen des Zen in eine neue Erde zu pflanzen wie den Samen einer Blume“. Basho hatte ein paar Monate in dessen Kloster gelebt, bevor er nach Wien zurückkehrte und hier sein eigenes Zendo gründete. Mittlerweile hatte sich Basho einen beachtlichen Ruf als Zen-Meister und Haiku-Dichter erworben, der weit über die Grenzen der Stadt hinausging. Von Zeit zu Zeit erschien ein Interview in einer überregionalen Zeitung oder er sprach im Radio, sodass Basho mittlerweile als wichtiger Botschafter des Zen galt.
Johanna nahm die DVD, bedankte sich und versprach, sie bald zurückzubringen. Während dieses Gesprächs saß Katharina schweigend da und steckte sich von Zeit zu Zeit eine mit Schokolade überzogene Macadamianuss in den Mund. Dabei wischte sie mit ihren weichen Händen über ihre feuchten Lippen.
Alles war so wie immer, nur als ihr Handy klingelte, verhielt sie sich merkwürdig. Katharina zog ihr Telefon aus der Tasche und drückte es fest an ihr Ohr, wobei sie sich die andere Hand vor den Mund hielt. Sie sagte aber nichts, hörte nur zu. Währenddessen breitete sich ein großer Ernst von ihrem kindlichen Mund über das ganze Gesicht aus. Später würde Johanna versuchen, sich dieses Bild in Erinnerung zu rufen, denn sie glaubte zu wissen, wer an jenem Abend so dringend mit Katharina hatte sprechen wollen. Gleich darauf stopfte Katharina das Telefon in ihre Tasche zurück. Kurz sah man noch die Anspannung um den Mund, die sich jedoch bald wieder verflüchtigte.
Als Basho sie fragte, ob sie in Schwierigkeiten stecke, schüttelte sie den Kopf, sprach stattdessen von großen Plänen. Im Garten ihrer Eltern stand ein Schuppen, in dem sie im Frühling begonnen hatte, ein Teehaus einzurichten.
Sie zog einen Bildband aus ihrer Umhängetasche und zeigte ein paar Fotos herum. Es waren Bilder von unter Kiefern und Farngewächsen versteckten Hütten, zu denen mit Moos bewachsene Trittsteine führten. Der Weg zum Teehaus glich dem Gang in eine rätselhafte Welt. Der Besucher durchschritt einen Garten voller Schatten, der umso dichter wurde, je näher er dem Teehaus kam. Vor dem Eingang streiften die Gäste ihre Schuhe ab und krochen dann auf allen Vieren in das Innere. Die Samurai früherer Zeiten legten sogar ihre Waffen ab. Es waren Gesten der Demut, aber auch des Vertrauens.
Mit Katharina hatte Johanna sich oft über die Bedeutung des Teewegs, auf Japanisch Chadō genannt, unterhalten. Das Teehaus war für sie ein Ort, an dem es weder Gut noch Böse, sondern nur das ewige Jetzt gab, das in Form von Licht durch die kleinen Fenster in die kahlen Räume dringt.
Die Schalen aus grobkörnigem Porzellan und die halb verblühten Wiesenblumen hingegen waren Symbole des Lebens und seiner Vergänglichkeit, mit der Johanna bald auf so schreckliche Weise in Berührung kommen sollte. Als Katharina von einem Mord im Teehaus sprach und ihn einen besonderen Frevel nannte, ahnte Johanna nicht, welche Bedeutung diese Worte für sie noch erhalten würden. Am Abend vor ihrem Tod ging Katharina zeitig zu Bett. Sie löschte das Licht und zog einen Sessel ans Bett, stellte darauf ihren Laptop und schob dann jene DVD, die Johanna ihr am Vortag in die Hand gedrückt hatte, in das Laufwerk. Zwar hatte Johanna sich die DVD von Basho ausgeliehen, doch nachdem sie gemeinsam das Zendo verlassen und vor der Tür ein Weilchen geplaudert hatten, merkte Johanna, wie sehr Katharina darauf brannte, den Film zu sehen. So hatte Johanna vorgegeben, sie hätte im Moment ohnedies keine Zeit, um sich den Film anzusehen. In der Bibliothek wäre so viel zu tun. Während der drei Wochen ihres Krankenstandes hätten sich Berge von Unterlagen auf ihrem Schreibtisch angesammelt, die es nun abzuarbeiten gälte.
Katharina steckte sich ein Kissen unter den Nacken und drehte sich auf die Seite. Der Film begann. Ein Zitat auf Französisch erschien. Dann flimmerten Ausschnitte aus einem Acht-Millimeter-Streifen über den Bildschirm. Eine Weile gelang es ihr, dem Film zu folgen, doch dann wandte sie sich ab. Woran sie das, was sie sah, erinnerte, wollte sie lieber vergessen. Verärgert stoppte sie den Film, zog ein Notizbuch unter der Matratze hervor und kritzelte ein paar Sätze hinein. Nach kurzem Zögern schob sie es unter die Matratze, wo sie es meistens hintat, wenn sie den Raum für kurze Zeit verließ. Als sie in das Badezimmer hinüberging, um sich die Zähne zu putzen, vernahm sie den Fernseher aus dem Schlafzimmer ihrer Eltern. Ihr Vater war am Nachmittag nach Wien gefahren und bis jetzt nicht zurückgekehrt. Die Mutter war wie immer früh zu Bett gegangen und hatte dann den Fernseher laut gestellt. Durch die Wand vernahm Katharina die Stimme irgendeines Inspektors, der neugierige Fragen stellte. Bis zur Rückkehr des Vaters würde der Lärm im ganzen Haus zu hören sein. Sie schloss die Augen und dachte an ihr Teehaus, das immer noch eher einem Schuppen glich. Gleich am nächsten Morgen wollte sie dort weiterarbeiten.
Eben war sie eingenickt, da weckte sie ein Geräusch. Es klang so, als habe jemand einen Kieselstein an die Fensterscheibe geworfen. Sie stand auf, öffnete das Fenster und blickte hinunter. Wie ein Graben tat sich die Nacht unter ihr auf. Erst allmählich zeichneten sich Umrisse in dieser Finsternis ab. Ihr Zimmer lag auf der Rückseite des Hauses, wo Gestrüpp wuchs und hinter Stacheldraht ein mit Buchen und Tannen bewachsener Hügel anstieg. Jetzt hörte man das Donnern der Eisenbahn, die auf der anderen Seite des Hügels vorbeifuhr. Es war ein Lärm, der im ganzen Ort zu hören war, hier aber ein wenig vom Wald gedämpft wurde.
Katharina wandte ihre Aufmerksamkeit wieder dem Garten zu. Dort knackte jetzt etwas, als verstecke sich jemand hinter einem Strauch und wäre versehentlich auf einen trockenen Zweig getreten. Sie beugte sich noch weiter aus dem Fenster und flüsterte einen Namen. Erst blieb es still, dann antwortete eine leise Stimme. Schnell schlüpfte sie in ihre Straßenkleidung, steckte Schlüssel und Telefon in ihre Tasche, holte das Tagebuch unter der Matratze hervor und ließ es hinter dem Wandschrank verschwinden. Dann eilte sie die Treppe in den Keller hinab, von dem eine Tür in den Garten führte. Johanna strich eine Haarsträhne, die schwer wie nasser Sand auf ihrer Stirn klebte, aus dem Gesicht und rieb ihre Hände an den Ärmeln ihrer Jeansjacke trocken. Eben hatte sich ein Unwetter über der Stadt entladen. Der Himmel hatte sich verdunkelt und nun prasselte Regen auf die Dächer, in die Höfe. Wasser strömte durch die Gassen und Alleen, Wind beutelte die weitverzweigten Äste der alten Bäume. Immer noch war Donnergrollen in der Ferne zu hören, dazwischen tönten die Sirenen der Städtischen Feuerwehr. Als der Zug das Bahnhofsgelände verließ, sah sie große Wagen mit violetten Lichtern durch überflutete Straßen biegen.
Sie ließ den Kopf in die Polsterung des Sessels sinken und schloss die Augen, versuchte sich auf das Klopfen des Regens zu besinnen, der auf das Dach fiel und von dort auf die Fensterscheiben tropfte. Das Gewitter tat gut, denn es lenkte sie ein wenig ab von der Zerrüttung tief in ihr. Ein Anruf von Josef van Bruneck vor einer Woche hatte sie in diesen schmerzhaften Zustand versetzt. Mit seiner seltsam hohen Stimme hatte er gefragt: „Nicht wahr, Sie sind eine Freundin unserer Tochter? Wir haben Ihre Nummer unter ihren Aufzeichnungen gefunden.“
Als Johanna das bejahte, fuhr er fort: „Sie ist tot. Wir dachten, Sie sollten das wissen.“
Seit dieser Nachricht konnte sie weder essen noch schlafen. Auch fiel es ihr unendlich schwer, sich auf ihre Arbeit zu konzentrieren. Manchmal gelang es ihr, den Anruf für einige Augenblicke zu vergessen, doch gleich darauf quälte sie die Erinnerung an Katharina umso mehr.
Sie dachte an die Worte, mit denen Basho sie zu trösten versucht hatte: Auf der Welt herrsche ein ständiges Kommen und Gehen, alles befinde sich im Fluss, dieser Gedanke nehme auch dem Tod vieles von seinem Schrecken. Es war eine Vorstellung, die sie beruhigte, wenn auch nur für kurze Zeit.
Den Medienberichten zufolge fand die Mutter ihre Tochter am frühen Morgen tot im Gartenteich. Das Mädchen wäre aber nicht ertrunken, sondern an einer Kopfverletzung gestorben. Die Polizei ging dennoch von einem Unfall aus. Diese Nachrichten verleiteten Johanna dazu, nochmals Kontakt mit den Eltern aufzunehmen. Die Eltern baten sie daraufhin zu einem Gespräch in ihr Haus. In den Monaten vor ihrem Tod hatte Johanna immer wieder lange Gespräche mit Katharina geführt. Meist verabredeten sie sich in Kaffeehäusern, wo sie Tee tranken, den sie aus kleinen weißen Kannen in weite Schalen gossen. Dabei diskutierten sie über das eine oder andere Koan, das Basho ihnen nach dem Zazen mit auf den Weg gab. Wenn Katharina dann von Kyōto erzählte, wo sie fast jedes Jahr hinfuhr, leuchteten ihre schwarzen Augen, so dass ein dunkler Glanz sie erfüllte, und Johanna glaubte, jeder, der sie sah, müsste darin versinken. Obwohl Johanna mehr als zehn Jahre älter war, fühlte sie sich dem Mädchen dann so nah. Manchmal ertappte sie sich sogar bei der Vorstellung, Katharina wäre die jüngere Schwester, die sie hätte haben können, wenn ihre Mutter nach ihr noch ein Kind zur Welt gebracht hätte, denn ihre einzige, um viele Jahre ältere Halbschwester lebte im Ausland und ließ selten von sich hören.
Nun saß Johanna im Regionalzug nach Waldegg, wo Katharinas Eltern lebten. Als der Zug an einem menschenleeren Bahnhof hielt, fiel ihr ein Zinshaus aus der Gründerzeit gegenüber der Trasse auf. Hinter Nebelschwaden erkannte man Balkone aus Schmiedeeisen. Mit der Inbetriebnahme der Westbahn im Jahre 1860 waren die Sommerfrischler aus der Großstadt gekommen, um in dieser Gegend ihre Ferien zu verbringen. Heute waren es Vororte, die mehr oder weniger gut an die Innenstadt angebunden waren. Katharina hatte sich dennoch oft beklagt, dass ihre Eltern so abseits lebten. Nachts hielten nur wenige Züge und Taxis kosteten viel, weshalb Katharina oft mit dem Rad nach Hause gefahren war.
Türen wurden aufgerissen, zugeknallt. Der Zug fuhr wieder los. Die Bäume neben den Gleisen flogen vorüber und die Berge dahinter versanken in der Abenddämmerung. Bei der nächsten Station stieg Johanna aus, schlug dann nach kurzem Zögern jenen Weg ein, der oberhalb der Uferböschung eines schmalen Flusses zu einer Siedlung am äußersten Rand des Ortes führte. Die Menschen, die hier wohnten, waren wohlhabend und führten ein zurückgezogenes Leben. Doch seit Katharinas Tod war auch hier vieles anders, als es vorher gewesen war.
2.
Die Häuser standen auf einem abgelegenen Waldstück, umgeben von einem hohen Maschendrahtzaun. Obwohl Johanna schon einmal hier gewesen war, war sie sich nicht mehr sicher, welches die Van-Bruneck-Villa war. Nach einer Weile kam sie zu dem Schluss, es müsse jenes Haus sein, das etwas abseits stand. Während die anderen Villen eine kleine Gruppe bildeten, stand jenes Haus allein hinter einer hohen Hecke zwischen im Wind schaukelnden Bäumen.
Wieder las sie das Schild, auf dem vor frei laufenden Hunden gewarnt wurde, obwohl es hier doch gar keine Hunde gab. Sie erinnerte sich, dass Josef van Bruneck gemeint hatte, das Schild wäre zur Abschreckung vor Einbrechern angebracht worden. Über bessere Sicherheitsmaßnahmen wären er und seine Nachbarn bislang nicht übereingekommen.
Nach etwa fünfzig Metern erreichte sie eine schwach beleuchtete Einfahrt. Als sie an der Glocke läutete, öffnete sich das Tor. Sie nahm die Trittsteine, die quer durch den Garten zur Villa führten, einem in puristischem Stil erbauten Haus aus Glas und Beton, das in seltsamem Widerspruch zu dem es umgebenden Garten stand, in dessen Mittelpunkt ein Teich mit einem Holzsteg lag. Von all dem war nun wenig zu erkennen. Der Garten mit seinen Kiefern, den Azaleen, den weitverzweigten Ästen von Buchen und Ahornbäumen lag in der Dämmerung. Das Haus ragte wie ein hell erleuchteter Schaukasten aus deren Schatten hervor.
Die Eingangstür öffnete sich. Jemand rief Johannas Namen. Sie trat ein. In der oberen Etage lief ein Fernseher. Mit ernster, aber gefasster Miene kam ihr Josef van Bruneck entgegen. Er war barfuß und trug eine lange schwarze Schürze. Van Bruneck entschuldigte sich, legte die Schürze ab, kramte im Garderobenschrank nach Hausschuhen für sich und für Johanna.
Sie hatte ihn beim Begräbnis zum ersten Mal gesehen und war überrascht gewesen von seiner kräftigen Statur. Am Telefon klang seine Stimme meist etwas heiser, doch ähnlich hoch wie die einer Frau. Die kräftigen Schultern und der fast kahle Schädel passten nicht zu dieser Stimme. Er nahm ihre Hand und drückte sie so fest, dass Johanna sie unwillkürlich zurückzog.
Er fragte, ob sie gut hergefunden hätte. Sie erwiderte, dass sie bereits einmal hier gewesen sei. Kurz nach Neujahr hatten sie Kathis sechzehnten Geburtstag gefeiert, allerdings ohne ihn. Katharina hatte damals gesagt, ihr Vater wäre auf einem wichtigen Symposium in Berlin.
Van Bruneck bedankte sich für die Blumen, die Johanna mitgebracht hatte, und führte sie in den Wohnraum, an den eine verglaste Veranda mit einem Tisch aus Birkenholz, einer cognacfarbenen Ledercouch und zwei Sesseln aus Rattan anschloss. Auf dem Tisch stand eine Vase mit Rosen neben einem Bild der verstorbenen Tochter. Kurz schreckte Johanna zurück. Das Foto war so gut getroffen, dass sie für einen Augenblick glaubte, Katharina stehe vor ihr. Schwarzes schulterlanges Haar berührte Wangen und Stirn. Die beiden Gesichtshälften waren auffallend symmetrisch, was dem Gesicht eine bestechende Schönheit, aber auch eine gewisse Strenge verlieh. Die Lippen waren aufeinandergepresst, die Mundwinkel leicht nach unten gezogen. Der feste Blick zwischen den schmalen Lidern der weit auseinanderstehenden Augen machte ihr fast ein wenig Angst. Sie fühlte die Schatten an den Wänden, das Dunkel der Bücherregale im hinteren Teil des Raums. Plötzlich schien ihr, die Tote oder zumindest ein Teil von ihr wäre noch immer irgendwo im Haus.
Dann wandte sie ihre Aufmerksamkeit wieder dem Tisch zu. Neben der Vase mit den Rosen und dem Foto der Verstorbenen waren geöffnete Kuverts aufgestellt. Offensichtlich handelte es sich um Kondolenzbriefe, die die Eltern nach dem Tod ihres einzigen Kindes erhalten hatten. Ein Umschlag fiel ihr besonders auf. Er war karminrot und mit weißen Lettern beschriftet. In Japan war Weiß die Farbe der Trauer, glaubte sie sich zu erinnern.
Van Bruneck stellte die Lilien neben die Rosen. Dann bat er Johanna, auf der Couch Platz zu nehmen, und setzte sich auf den Sessel gegenüber.
„Die Rosen und der Brief sind von Basho“, sagte er und zeigte auf den roten Umschlag.
Sie nickte. Nach dem Begräbnis hatte Basho die Mitglieder des Zendos zu einer Meditation eingeladen, um die Geister zu vertreiben, die den Hinterbliebenen keine Ruhe ließen, wie er erklärt hatte. Als sie van Bruneck davon erzählte, zuckten seine dünnen Lippen, es war wohl ein Anflug von Spott, dann ließ er den Kopf in die offenen Hände sinken.
„Unsere Tochter hat oft von Ihnen gesprochen. Wo haben Sie sie überhaupt kennengelernt?“, fragte er.
Johanna erzählte daraufhin von ihrer Arbeit in der Städtischen Bibliothek mit ihrem reichen Bestand an fernöstlicher Literatur. Kathi habe sich dort immer wieder Bücher ausgeliehen und da wären sie eines Tages ins Gespräch gekommen. Durch Kathi hätte sie auch Basho kennengelernt.
„Davon hat mir Kathi gar nichts erzählt“, sagte er und erkundigte sich nach dem Leiter der Bibliothek. Als Johanna den Namen Bauernfeind erwähnte, gab er sich überrascht. Er kenne Erich, wie er ihn nannte, von früher. Bauernfeind wäre ein Freund aus Studientagen, von dem er allerdings seit Längerem nichts gehört habe. Der Fernseher im Obergeschoß wurde jetzt leiser gestellt. Van Bruneck schaute zur offenen Treppe.
„Eben war der Arzt hier“, sagte er. „Ich mache mir Sorgen um meine Frau. Sie redet nichts, isst nichts, starrt den ganzen Tag teilnahmslos auf den Bildschirm.“
„Ihre Frau hat Kathi gefunden?“, wagte Johanna zu fragen.
„Ich wollte, ich hätte es getan.“
Er schlug die Beine übereinander und begann mit dem Fuß zu wippen. Den Nachmittag habe seine Tochter in ihrem Zimmer über den Hausaufgaben verbracht, fuhr er fort. Danach sei er weggefahren.
„Als ich am späten Abend zurückkehrte, war sie weg. Zwar kam es manchmal vor, dass Kathi, ohne etwas zu sagen, nach Wien fuhr, um Freunde zu besuchen, aber meistens rief sie an. Meine Frau ahnte deshalb gleich, dass etwas passiert sein musste.“
Sein Fuß wippte schneller, der Pantoffel rutschte über den Fußrücken und blieb schließlich an den nackten durchgedrückten Zehen hängen.
„Die ganze Nacht lag meine Frau wach. Als es hell wurde, ging sie dann zum Teich in den Garten. Dort entdeckte sie unsere Tochter leblos auf dem Grund des Wassers. Ihr Körper war gekrümmt wie der eines Embryos, doch das Gesicht war alt und starr. Ich stieg dann in die Kälte und holte sie da raus.“
Eine Weile sagte Johanna nichts, schaute stattdessen auf die Blumen auf dem Tisch. „Stimmt es, dass die Polizei erst viel später gekommen ist?“, fragte sie vorsichtig.
Er zuckte zusammen. In den Zeitungen hatte gestanden, die Polizei wäre erst einige Stunden nach Auffinden des Leichnams vom Hausarzt verständigt worden, weshalb mögliche Spuren bereits verwischt waren.
„Natürlich hätten wir gleich die Polizei rufen sollen, doch wir konnten einfach nicht fassen, was geschehen war. Darum wickelten wir Kathi in ein Betttuch und nahmen sie mit ins Haus. Yumiko hoffte, dort würde sie wieder aufwachen.“
Mit gesenktem Blick folgte Johanna seinen Schilderungen. Als sie aufsah, wunderte sie sich über seinen ruhigen Gesichtsausdruck.
„Meine Frau ist starke Raucherin und schafft es nicht, davon loszukommen. Zu unserem Ärger begann auch Kathi vor einigen Monaten zu rauchen. Da wir ihr das in ihrem Zimmer verboten hatten, ging sie manchmal nachts in den Garten hinaus. Wir glauben, dass sie unglücklich gestürzt und dabei in den Teich gefallen ist.“
Johanna hatte Katharina niemals mit einer Zigarette gesehen. Erneut betrachtete sie ihr Foto. Der Blick des Mädchens schien ihr jetzt noch rätselhafter.
Van Bruneck seufzte und wischte sich mit der Hand über den Mund. Offensichtlich entging ihm Johannas Misstrauen nicht. Als wolle er sich rechtfertigen, fuhr er fort: „Außerdem hatte sie seit einigen Wochen einen Freund, ihr erster, soweit wir wissen. Er war um vieles älter. Wie Sie sich vielleicht vorstellen können, waren wir nicht glücklich über diese Beziehung. Vielleicht haben Sie ihn auch gekannt?“
„War er denn ein Mitglied des Zendos?“, wollte Johanna wissen.
Van Bruneck schüttelte den Kopf. „Die beiden haben sich hier im Haus kennengelernt“, gab er nach einigem Zögern zu. „Ich bin nämlich gerade dabei, meine Bibliothek zu katalogisieren, und da sich im Laufe der Jahre eine Fülle von japanischen Büchern angesammelt hat, mein Japanisch aber nicht gerade überwältigend ist, hatte ich ihn gebeten, mir beim Sortieren zu helfen.“
Er zeigte auf die Bücherregale, die links und rechts der Veranda die Wände füllten. Da und dort sah man eine Leiter neben einem Stoß Bücher.
Johanna hätte es noch interessiert, wie dieser Freund hieß und ob die Polizei ihn befragt hatte, doch sie wollte nicht zu neugierig erscheinen.
„Er war viel zu alt für sie, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er etwas mit dem Tod unserer Tochter zu tun hat“, meinte van Bruneck abschließend.
Oben hörte man einen dumpfen Laut, dann ein leises Schluchzen. Van Bruneck stand rasch auf und eilte die Treppe hinauf. Sie hätte nicht herkommen sollen, dachte Johanna, als sie aus dem Haus schlich. Der schmale Fluss unterhalb des Fußweges plätscherte dahin. Ein paar ockerfarbene Lichter fielen vom gegenüberliegenden Ufer auf das Wasser zwischen den Grabenwäldern. Johanna lief durch den Regen zur Bahnstation. Mehrmals drehte sie sich um, denn ihr schien, dass hinter ihr jemand mit schweren Schritten durch die Pfützen lief und sich ihr unaufhaltsam näherte. Doch außer Bäumen und Sträuchern, deren Schemen den Mond verdeckten, war nichts zu sehen.
Auch in der Bahnstation sah sie keinen Menschen. Eine mit Graffiti beschmierte Betonröhre verband die beiden Bahnsteige. Laub, Zeitungspapier und Plastiktüten wirbelten im Wind. Der nächste Zug nach Wien würde erst in einer Stunde fahren. Sie setzte sich also in den Warteraum, der zwar nicht beheizt war, doch zumindest Schutz vor dem Nordwind bot.
Die Station war nach dem berühmten Sanatorium benannt, das auf der anderen Seite des Flusses lag. Es war ein Jugendstilbau, der mit seiner geradlinigen Fassade, den spärlichen Ornamenten, den Mosaikböden und erlesenen Möbeln in vielen Architekturführern abgebildet war.
Van Bruneck hatte erwähnt, dass täglich an die dreihundert Züge durch das Ortsgebiet von Waldegg fuhren. Die wenigsten hielten, einige Regionalzüge und dann und wann ein Schnellzug, um auf einen entgegenkommenden Zug zu warten. In der Nacht, in der Katharina gestorben war, hätte in unmittelbarer Nähe des Hauses ein Schnellzug ohne erkennbaren Grund angehalten. Jemand habe die Notbremse gezogen und sei ausgestiegen. Bis heute kenne man weder den Fahrgast noch sein Motiv, hatte van Bruneck erzählt. Johanna trat ins Freie, schaute auf die Leuchttafel über dem Bahnsteig. Der letzte Zug aus Wien hielt um null Uhr dreißig. Danach gab es bis zum Morgen keine Verbindung hierher.
Sie nahm ihren Kalender, notierte sich die Abfahrtszeiten. Eben wollte sie in den Warteraum zurückkehren, da fielen zwei Kärtchen aus dem Umschlag ihres Kalenders. Ehe sie Zeit fand, sie einzusammeln, trug ein Windstoß sie davon. Im selben Augenblick waren Schritte zu hören. Johanna blickte sich um. Ein junger Obdachloser näherte sich. Sein Gesicht war freundlich, doch der Bart und das verfilzte blonde Haar ließen Johanna zurückweichen. Obwohl er ihre Furcht bemerkte, näherte er sich weiter. Der Wind flaute ab, die Kärtchen, die aus ihrer Tasche gefallen waren, blieben neben ihm liegen.
Er bückte sich etwas ungelenk und hob sie auf. Nachdem er einen Blick darauf geworfen hatte, bewegten sich seine aufgesprungenen Lippen, als wolle er etwas sagen. Langsam streckte er seine lange, schmale Hand in Johannas Richtung. Sie überlegte, ob sie ihm ein paar Euro geben sollte, doch sie hatte Angst, ihre Geldbörse aus der Tasche zu ziehen. Dann klingelte ihr Handy. Josef van Bruneck wollte wissen, ob sie den Zug, der eben abgefahren sei, erreicht hatte. Ansonsten würde er sie mit dem Auto nach Wien bringen. Kurz darauf hielt ein grauer Mercedes gegenüber der Bahnstation. Als Johanna einstieg, sagte van Bruneck: „Haben Sie Angst vor mir oder warum sind Sie davongelaufen?“
Der Wagen wendete, bog auf die Landstraße. Sie blickte auf die Fahrbahn, wo die Scheinwerfer Löcher in das Schwarz der Nacht fraßen, das wie ein Tuch über der Landschaft lag. Sie fuhren durch ein Waldstück. Da und dort sah man Forstwege, an deren Rändern frisch geschlagene Bäume lagen, die mit ihren aufgeschnittenen Stämmen an Menschenleiber erinnerten, denen auf schreckliche Weise Gewalt angetan worden war. Daneben standen dem Verfall preisgegebene Villen, die mit ihren Erkern und Türmen wie viktorianische Spukschlösser ausschauten.
Van Bruneck erzählte, dass der Arzt eben erneut bei seiner Frau gewesen sei und ihr eine weitere Beruhigungsspritze gegeben habe. Johanna kramte währenddessen in ihrer Tasche, um zu überprüfen, was sie auf dem Bahnsteig verloren hatte. Van Bruneck machte daraufhin Licht und drückte ihr eine Zeitung in die Hand. Kurz streifte sie seine Hand.
„Ich kann das nicht lesen. Sagen Sie mir, ob etwas über unsere Kathi drin steht?“
Er habe seit Tagen keine Zeitung gelesen. All die Lügen, die sie über ihn und seine Familie verbreiteten, ertrage er nicht.
Für die Zeitungen schien die Tote aus dem Gartenteich, wie sie überall genannt wurde, ein gefundenes Fressen. Der tragische Todesfall versprach Abwechslung von all den Polit- und Wirtschaftsskandalen, die in den Monaten zuvor die Nachrichten dominiert hatten. Außerdem hatte sich van Bruneck in der Vergangenheit immer wieder öffentlich zu politischen Themen geäußert und da er als aufrechter Linker galt, berichtete vor allem die konservative Presse ausführlich über den Fall.
„Die Zeitungen werden bald was anderes finden“, versuchte Johanna ihn zu trösten.
Sie erreichten die Linzer Straße. Mittlerweile war es elf Uhr nachts. Am Rand der Fahrbahn standen Prostituierte, die in ihren Stiefeln zwischen den geparkten Autos herumstakten und auf der Suche nach Freiern den vorbeifahrenden Autos in die Windschutzscheiben schauten.
Johanna bat van Bruneck, in der Nähe einer U-Bahn-Station zu halten. Sie wollte von dort alleine weiterfahren.
Als Johanna kurz darauf aus dem Wagen stieg, sagte sie: „Ich wollte Sie nicht beunruhigen mit meinem Besuch, aber ich vermisse Katharina so sehr und wollte, dass Sie das wissen.“
Dann wünschte sie ihm eine gute Nacht. Während sie die Straße überquerte, hörte sie durchdrehende Reifen auf dem nassen Asphalt. Van Bruneck brauste in Richtung Wienerwald davon. Der Obdachlose stand noch immer auf dem Parkplatz vor der Bahnstation von Waldegg und schaute der Limousine hinterher, die längst auf der dunklen Landstraße im Wald verschwunden war. Er hatte das Auto wie auch den Fahrer wiedererkannt, die junge Frau auf dem Beifahrersitz allerdings hatte er auf dem Bahnsteig zum ersten Mal gesehen.
Mit seinen schmutzigen Fingern wühlte er in einer der zerschlissenen Nylontaschen, die er bei sich trug, suchte die Visitenkarten, die die Frau kurz zuvor auf dem Bahnsteig verloren hatte. Endlich fand er sie inmitten leerer Bierdosen. Auf beiden Kärtchen stand dieselbe Adresse. Er überlegte. Da fiel ihm ein, dass er die Gegend ja kannte. Im Winter übernachtete er da manchmal in einem Hinterhof, während er im Sommer lieber unter freiem Himmel schlief. Schließlich steckte er eines der Kärtchen in seine Nylontasche zurück, das andere ließ er achtlos auf den Asphalt fallen. Dann richtete er sich auf. Mit schlenkernden Armen bewegte er sich in jene Richtung, aus der kurz zuvor Johanna gekommen war. Gegen Mitternacht erreichte Johanna das Zinshaus in der Hasnerstraße im sechzehnten Wiener Gemeindebezirk, wo sie seit einigen Jahren wohnte. Die Wohnung bestand aus Bad, Küche und einem Zimmer. Die Räume waren vor ihrem Einzug renoviert worden, doch ansonsten befand sich das Gebäude in einem erbärmlichen Zustand. Vergangenen Winter wäre beinahe das Treppenhaus eingestürzt.