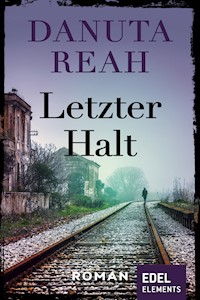Die alten Fabrikgebäude am verlassenen Kanal von Sheffield scheinen der Galeristin Eliza Eliot der ideale Ort, um die düsteren Bilder des Malers Daniel Flynn auszustellen. Alles läuft wie geplant, bis kurz vor der Vernissage die Leiche einer jungen Frau aus dem modrigen Kanal gezogen wird. Ist es ein Zufall, dass die Tote gerade vor ihrer Galerie gefunden wird? Oder steht dieser Mord in Zusammenhang mit einem Fall aus Elizas direkten Umfeld?
1
Das Grab wirkte zu schmal für das, was es beherbergen sollte. Eliza zitterte im Wind, der über den hoch gelegenen Friedhof fegte. Sie befand sich inmitten des seltsamen Grüppchens, das sich um die Grabstelle versammelt hatte, und ihr Künstlerauge registrierte dort, wo die Totengräber den gefrorenen Boden durchtrennt hatten, die Erdschichten: das Schwarze des Mutterbodens, dann das Gelb des Lehms und darunter die Dunkelheit des Grabes selbst.
Die aufgeworfene Erde war mit Kunstrasen abgedeckt, und die Totengräber hatten sich hinter den Erdwall zurückgezogen und warteten auf das Ende der Beerdigung. Den Sarg hatten sie bereits hinabgelassen und die Seile gelöst. Die Pastorin trat vor und sprach die vom Ritual vorgesehenen Worte. Ihre Stimme war leise und hatte nichts von der erzwungenen Emotionalität, die Eliza bei anderen Begräbnissen gespürt hat. Diese Frau hatte Maggie nicht gekannt. Keiner der Anwesenden war Maggie wirklich nah gewesen, nicht in den letzten paar Jahren. Der einzige Mensch, auf den dies zutraf, ruhte bereits hier auf dem Friedhof.
Unwillkürlich glitt Elizas Blick zu dem dunklen Grabstein links des neuen Grabs. Polierter Granit mit Goldlettern. Die Goldeinlage verblasste bereits, aber die Worte waren tief in den Stein geschnitten und würden erst nach jahrhundertelanger Verwitterung verschwinden. Sie würden so lange überdauern wie jene Menschen, denen sie etwas bedeuteten, diesen Ort besuchten: Ellie Chapman, 1989–1998. Liebe ist so stark wie der Tod.
Ein Mann im dunklen Anzug beobachtete sie. Unter den bunt gemischten Fremden, die gekommen waren, um sich von Maggie zu verabschieden, wirkte er seltsam förmlich. Er war verspätet zum Gottesdienst erschienen und stand jetzt neben dem Granitstein. Sie kannte ihn nicht. Sie kannte niemanden von den Leuten, die hier waren. Im Lauf der Jahre waren Maggies Freunde weniger geworden.
Die Zeremonie war vorbei, und die Menschen entfernten sich von der Grabstätte. Elizas Blick fiel auf die Blumen, allesamt in Zellophan verpackt, die man, sobald die Grube aufgefüllt war, auf das frische Grab legen würde. Sie würden in ihren Verpackungen verblassen, die Botschaften der Anteilnahme würden von der Witterung ausgelöscht werden, und in ein paar Tagen würde man sie abräumen und vernichten. Dann wäre die ganze Geschichte vorüber.
Unvermittelt schritt Eliza Seite an Seite mit dem Mann im dunklen Anzug. Sie blickte zu ihm hoch. »Ich heiße Eliza Eliot«, stellte sie sich vor. »Ich habe mit Maggie das College besucht. Aber wir kennen uns nicht, oder?«
»Roy Farnham. Nein. Ich kannte sie nicht gut.« Er schien sich darüber klar zu werden, dass dies ein wenig knapp formuliert war. »Sie suchte mich wegen Frasers Berufungsantrag auf«, fügte er hinzu.
»Dann waren Sie ihr Anwalt?« Das würde den Anzug erklären.
Er schüttelte den Kopf. »Nein, ich bin Polizeibeamter.«
Natürlich. »Waren Sie mit den Ermittlungen betraut?« Den Ermittlungen im Mordfall Ellie Chapman vor vier Jahren.
»Nein, aber ich habe einen Artikel über das Berufungssystem verfasst. Er erschien, als die Neuigkeiten von Fraser bekannt wurden. Sie dachte, ich könnte etwas dagegen unternehmen.« Sie blieben am Friedhofstor stehen.
»Entschuldigen Sie bitte!« Eliza drehte sich um. Ein junger Mann mit einem Notizbuch in der Hand sah sie an. »Ich komme vom Star«, sagte er und bezog sich damit auf die Lokalzeitung. »Ich glaube, Sie waren eine Freundin von Margaret Chapman?«
»Maggie«, berichtigte ihn Eliza. »Ja, wir waren zusammen im College.« Sie richtete ihren Blick hoch zum Himmel. Er war klar und wolkenlos, und die Äste eines Baums, der neben dem frischen Grab stand, hoben sich schwarz von dem strahlenden Sonnenlicht ab. Eine Freundin Maggies … Wie sollte man eine solche Frage beantworten, überlegte Eliza. Sie war sich bewusst, dass Roy Farnham ein wenig abseits stand und das Gespräch verfolgte. Mit professionellem Interesse?
Sie hatte von Maggie in den letzten vier Jahren ihres Lebens nur sehr wenig mitbekommen. Sie hatten gemeinsam an der Kunstakademie studiert, eine Wohnung und die ersten Aufregungen und Ängste eines unabhängigen Lebens geteilt, aber am Ende dieser drei wichtigen Jahre hatten sie getrennte Wege eingeschlagen. Eliza war nach London gegangen, um weiterzustudieren, danach in Galerien von Florenz und Rom, um dort zu arbeiten und die Techniken der Renaissancemeister zu studieren, anschließend nach Madrid mit einem Stipendium, das ihr erlaubte, im Prado Restaurationstechniken zu erlernen. Maggie hingegen vergrub sich mit ihrer Ausbildung als Kunstlehrerin und einem kleinen Baby, um das sie sich kümmern musste, in Sheffield. Sie waren in Kontakt geblieben. Eliza war in regelmäßigen Abständen nach England gekommen und hatte dort einige Zeit mit Maggie und Ellie, dem Baby, verbracht, das sich nach und nach in eine Persönlichkeit verwandelt hatte – ein energisches Kleinkind, ein lebhaftes kleines Mädchen, ein intelligentes, aber nachdenkliches Kind. Eliza mochte Ellie. Aber im Lauf der Jahre waren andere Freunde und andere Interessen
aufgetaucht, und sie und Maggie trafen sich immer seltener.
Ihre Freundschaft war auf Weihnachtskarten und die Geburtstagskarte mit Geschenk zusammengeschrumpft, das Eliza jedes Jahr an Ellie schickte. Und Ellie schrieb jedes Mal zurück. Eliza musste lächeln, als ihr einige der Briefe wieder einfielen. Der letzte – Ebeil Azile, hci eknad rid rüf … So etwas hatte Eliza auch gemacht, als sie in Ellies Alter war. Einmal hatte sie ihrer Großmutter in Hieroglyphen geschrieben, was eine ziemlich knappe Antwort zur Folge hatte. Und dann war Ellie gestorben.
»Ich glaube nicht, dass Maggie sich je davon erholt hat«, teilte Eliza dem Reporter nun mit.
»Hat die Tatsache, dass Mark Fraser versucht, in Revision zu gehen, zu Maggies Tod beigetragen?« Er brauchte Eliza nicht zu bitten, ihre Bemerkung zu erläutern. Der Mord an Ellie Chapman war vor vier Jahren zu einem kurzen cause célèbre geworden. Eliza erinnerte sich noch an Maggies verzweifelten Anruf, erinnerte sich, wie sie am frühen Morgen losgegangen war, um sich die englischen Zeitungen gleich nach ihrem Erscheinen zu holen, und wie sie BBC eingeschaltet hatte. Keine Hinweise auf die vermisste Ellie.
»Ich weiß es nicht«, sagte Eliza. Maggie hatte eine Kampagne ins Leben gerufen, damit Fraser im Gefängnis blieb – obwohl eine vorzeitige Entlassung keineswegs wahrscheinlich war. Ohnehin hätte er Ellie nicht zurückzubringen vermocht.
Sie tauschte mit dem jungen Mann Belanglosigkeiten aus, aber keiner sprach die Frage aus, die über dem Bestattungsritual geschwebt hatte und jetzt zwischen ihnen in der Luft hing. War Maggies Tod ein Unfall? Ein Autounfall, in den sonst keiner verwickelt war, war genau die Art von höflichem Selbstmord, wie Maggie ihn begangen hätte. Andererseits
war sie unberechenbar und zerstreut geworden und hatte sich allzu sehr dem Alkohol hingegeben. Sie hatte getrunken gehabt, als sie starb.
»Danke«, sagte der Reporter nach einer Weile. »Und Sie sind …?«
»Eliza Eliot.«
»Ich danke Ihnen.«
Ihr Blick wanderte den Pfad zurück zu dem neuen Grab, den dunklen Grabstein daneben. Dort stand ein Mann und betrachtete den Stein. Es sah aus, als würde er die Inschrift lesen. Er hatte die Hände in die Taschen gesteckt und krümmte sich vor Kälte. Seine Stoffjacke wirkte viel zu dünn für diesen Wintertag. Sein Gesicht vermochte sie nicht zu erkennen, aber er hatte was Vertrautes. Jemand aus dem College? Jemand, der Maggie von der Arbeit her kannte?
Roy Farnham trat neben sie, und gemeinsam setzten sie ihren Weg zum Ausgang des Friedhofs fort. »Ich hatte mit mehr Menschen gerechnet«, meinte er.
»Maggie hat den Kontakt zu ihren Freunden verloren.« Oder ihre Freunde hatten in der Folge von Ellies Tod den Kontakt zu Maggie verloren.
»Ich konnte ihr nicht helfen«, sagte er. Eliza sah ihn an. »Sie wollte Garantien, dass Fraser im Gefängnis blieb.«
»Glauben Sie denn, dass er rauskommt?«
Er blieb stehen und dachte nach, den Blick in die Ferne gerichtet. Der Friedhof war einer der am höchsten gelegenen Punkte der Stadt, und die Hügel liefen nach Westen hin aus, eine Kaskade aus Dächern und Winterbäumen. »Ich habe mir den Fall angesehen, nachdem sie mich aufgesucht hatte. Ich weiß es nicht – um die Wahrheit zu sagen.«
Sie verharrten einen Moment in Schweigen, dann sagte Eliza: »Es war nett von Ihnen, das zu tun.«
Er zuckte mit den Schultern. »Viel war es nicht.« Er sah
sie wieder an. »Sind Sie von hier?« Er war es eindeutig nicht, aber sie konnte seinen Akzent nicht zuordnen.
»Nein, aber ich war hier in der Kunstakademie. Letzten Sommer bin ich zurückgekehrt.«
»Und was hat Sie wieder hierher geführt?«
»Ich …« Plötzlich zögerte Eliza fortzufahren. Er sah sie an, wartete. »Ich bin hergekommen, um für die Second Site Galerie zu arbeiten.«
Er zog seine Brauen hoch. »Unten am Kanal? Wo …?« Wo Ellies Leiche sechs Monate nach ihrem Verschwinden gefunden worden war, verborgen im dichten Unterholz neben dem Treidelpfad, kilometerweit entfernt von dem Ort, an dem man sie zuletzt gesehen hatte.
»Ja«, sagte Eliza. Er erwiderte nichts darauf, sah sie aber unverwandt an. »Ich gehe jetzt lieber«, erklärte sie. »Wir haben wirklich viel zu tun. Nächste Woche haben wir eine große Ausstellung, und am Freitag findet eine Vernissage statt.«
»O ja«, meinte er mit höflichem Interesse. Dann betrachtete er sie genauer. »Ich habe darüber gelesen.«
Für eine neue Kunstgalerie in der Provinz hatte die Ausstellung eine Menge Publicity bekommen. »Es ist die neueste Arbeit von Daniel Flynn«, erklärte sie. Einen Augenblick lang war sie wieder in den Straßen von Madrid. Es war Frühsommer, und der Puerta del Sol war von Licht überflutet. Daniel lachte über eine Äußerung von ihr. Wer war sonst noch dabei gewesen? Sie konnte sich nicht mehr daran erinnern. Sie waren eine Gruppe gewesen und hatten vor dem Café gesessen und die müßig durch den Nachmittag schlendernden Madrileños beobachtet. Daniel.
Sie holte sich in die Gegenwart zurück. »Sie müssen es sich anschauen.«
»Mal sehen«, sagte er. Ein vorsichtiges Ausweichen. »Worum geht es denn?«
»Es besteht aus einer Reihe von Interpretationen eines Brueghel-Gemäldes.« Sie sah ihn an. »Es heißt Der Triumph des Todes.«
Ihr Blick richtete sich noch einmal auf die Gräber, aber der Mann, der dort gestanden hatte, war verschwunden.
Im Laufe des Tages bewölkte sich der Himmel, und es bildete sich eisiger Nebel, der die Ränder des neuen Grabs – schwarz aufgeworfen, ein langes, schmales Rechteck im Gras – verschwimmen ließ. Auf der Erde lagen die in Zellophan verpackten Blumen. Die Aufbahrungskapelle war verschlossen und still, die Betriebsamkeit des Tages war vorüber.
Ein junges Mädchen stand vor dem Grab. Sie trug sommerliche Kleidung, unpassend für das Winterwetter, dünne, knöchellange Bluejeans, und ein Sweatshirt, das vorne mit Pailletten verziert war – Blumen und Vögel. Sie war dünn, mit zerbrechlichen Fuß- und Handgelenken, schmalen Hüften und schmalem Rücken.
Die Knie ihrer Jeans waren verdreckt, und sie hatte die schmutzigen Hände und das Gesicht eines Kindes, das gerade gespielt hatte. Mit den Händen rieb sie sich die Tränen aus dem verschmierten Gesicht. Dann wandte sie sich dem Friedhofstor zu, und ihre Knöchel knickten um, als sie über den unebenen Weg stolperte. Mit einem wütenden Aufschrei rannte sie los, aus dem Friedhof hinaus auf die Straße, wo die Schuhe auf dem Asphalt klapperten.
Die Aussegnungskapelle lag ruhig und verlassen in der wintertoten Landschaft. Die meisten Gräber waren alt, mit bemoosten Steinen, auf denen die Inschrift schon lange bis zur Unleserlichkeit verblasst war. Neben dem frisch ausgehobenen Grab ragte, von Gras umwuchert und von Lorbeer in Besitz genommen, der polierte Granit eines neueren Grabsteins empor. Auch auf diesem Grab lagen Blumen,
aber es sah aus, als hätte eine launische Bö sie erfasst und ihre Blütenblätter in einer dunkelroten Kaskade über die schwarze Erde dieses einen Grabs gestreut. Ellie. Liebe, so stark wie der Tod.
Hatte über dem Vormittag frostiges Schweigen gelegen, so taute dieses jetzt zu Regen, eisig, hartnäckig und peitschend. Eliza schaltete die Heizung in ihrem Wagen ein, und die Scheibenwischer hatten Mühe, eine klare Sicht zu gewährleisten. Die Windschutzscheibe beschlug, und sie musste das Fenster herunterkurbeln. Trotz des über die Ohren gezogenen Huts und des mit einem Schal geschützten Gesichts war ihr kalt. Als hätte diese eine Stunde, die sie in der Aussegnungskapelle verbracht und neben dem gefrorenen Grab gestanden hatte, sie bis ins Mark ausgekühlt. Es würde einige Zeit dauern, bis die Wärme sie durchdringen würde.
Der trübe Nachmittag drückte auf ihr Gemüt, als sie im dahinschleichenden Verkehr zurück ins Stadtzentrum fuhr. Von der Straße spritzte Regenwasser hoch, und sie erhöhte die Wischgeschwindigkeit ihrer Scheibenwischer, um überhaupt noch geradeaus sehen zu können. Es ging ein paar Meter voran, dann stockte der Verkehr wieder.
Die graue Witterung war wie ein Echo des eisigen Friedhofs, und sie musste an Maggie denken, die allein im Dunkeln unter der Erde lag, tot in alle Ewigkeit. Und an Ellie, so voller Verheißungen. Sie wünschte sich zurück in den Sommer Spaniens, oder wenn dies schon nicht glückte, dann nach Hause in die Wärme und Farbigkeit ihrer Wohnung oder in die Weitläufigkeit der Galerie. Im Schritttempo glitt sie an der Busstation vorbei, dann befand sie sich im Gewirr des Kreisverkehrs um den Park Square. Geschickt wechselte sie die Spuren, ohne auf das ungeduldige Hupen zu achten, das hinter ihr ertönte, und fuhr hinunter zu den Neubauten des Kanalbeckens und weiter die Straße entlang,
dorthin, wo sich die alten Industriegebäude erhoben, noch immer unverändert und verlassen.
Die Galerie und Elizas Wohnung waren in einem der alten Lagerhäuser untergebracht, abseits des teuren, neu belebten Kanalbeckens, das die Demarkationslinie zwischen dem neuen Sheffield mit seiner Wohlstandsverheißung und dem alten Sheffield darstellte, von dessen Fleisch sich die Nutznießer des industriellen Reichtums genährt hatten, wovon jetzt jedoch nur noch die verrottenden Gebeine zu sehen waren. Nachts, wenn die Galerie verlassen war, fühlte Eliza sich manchmal so isoliert, als lebte sie auf einer fernen Insel der Shetlands und nicht inmitten eines städtischen Ballungsraums.
Sie fuhr an dem Hotel vorbei, das das Ende der bewohnten Gegend zu markieren schien, dann unter der Brücke hindurch zu der Straße, die am Kanal entlangführt. Es war ein abrupter Wechsel. Das Mauerwerk auf dieser Seite der Brücke bröckelte, war fleckig vom Wasser, das aus den geborstenen Fallrohren lief. Unter der Brücke führte ein schmaler Pfad hindurch, eine Sackgasse, in der alter Hausmüll abgeladen wurde, um zu verrotten.
Sie nahm die Abfahrt, die zur Kanalstraße führte, und fuhr vorbei an den mit Ketten und Vorhängeschlössern gesicherten Toren zu den alten Ladebuchten und den Büros der Kanalreedereien. Jetzt hatte sie die Galerie erreicht, das alte Lagerhaus wirkte düster und abweisend im schwindenden Licht. Im Tageslicht war es mit seiner Vorderfront aus warmem Ziegelstein und den halbrunden Fenstern, die für Balance und Symmetrie sorgten, ein schönes Gebäude, auch schon vor der Renovierung.
Eliza schloss den Wagen ab und schaltete die Alarmanlage ein. In dieser Gegend war Vorsicht angebracht. In Gedanken entfernte sie sich bereits von den Ereignissen des Vormittags und wandte sich den Aufgaben zu, die sie noch
zu erledigen hatte. Ihr fiel auf, dass Jonathan Masseys Auto neben dem alten Lagerhaus parkte.
Jonathan Massey war der Galeriedirektor. Eliza kannte ihn schon seit Jahren – er war an der Kunstakademie ihr Tutor gewesen, ebenso der von Maggie. Sie hatte nicht damit gerechnet, dass er heute da sein würde. Er war zu einer Besprechung im Kulturreferat gewesen.
Sie betrat die Galerie und nickte Mel zur Begrüßung zu, einer jungen Praktikantin, die Jonathan noch vor Eliza eingestellt hatte. Mel hatte ihre Ausbildung für Kunst und Design am örtlichen College abgebrochen. Man habe ihr dort nichts mehr beibringen können, hatte sie Eliza gegenüber behauptet. Sie saß auf einer der Fensterbänke und las eine Zeitschrift, More oder Hello!, wie Eliza aus Erfahrung vermutete. Sie versuchte, ihren Ärger zu unterdrücken. Mel sollte heute die Vernissage vorbereiten, die Einladungen durchsehen, sich vergewissern, dass die Rückmeldungen beigelegt waren, und die Bestellungen für das Büfett überprüfen, während Eliza an der Ausstellung arbeitete.
»Sind Sie mit dem Überprüfen der Einladungslisten fertig geworden?«, fragte sie, als sie ihren Hut abnahm und sich aus ihrem Schal wickelte.
Mel drehte sich um und zuckte mit den Schultern. »Ich habe auf Sie gewartet«, sagte sie. Heute täuscht sie Bohèmeglamour vor, ging es Eliza durch den Kopf, angesichts des Stufenrocks aus Leder und Chiffon, der bestickten Jacke und den Stiefeln von DocMartens. Mel machte sich ihre Kleider meist selbst. Ihr derzeit schwarzes Haar war streng nach hinten gegelt.
Das heißt dann also ›nein‹. »Aber Sie brauchen mich dafür doch gar nicht«, entgegnete Eliza schroff. »Wenn Sie das nächste Mal auf mich warten«, fuhr sie fort, entschied dann jedoch, sich diese Mühe lieber zu sparen. Mels Vertrag lief
nur noch fünf Monate, dann würde sie sich nach jemand anderem umschauen müssen.
Jonathan würde in seinem Büro sein. Sie klopfte an seine Tür und trat ein. Mit dem Rücken zu ihr wühlte er in seiner Schreibtischschublade. »Jonathan?«, sagte sie.
Er fuhr herum. »Eliza! Ich hatte nicht …« Er schloss die Schublade. »Wie war es?«
Eliza ließ die Schultern sinken. Eine Beerdigung war eine Beerdigung. Was sagte man da? »Ich habe mir überlegt, mit dem Aufbau der Ausstellung weiterzumachen. Haben Sie was verloren?«
»Oh, nur einen Brief«, sagte er. »Ich werde Mel fragen … Es kam heute auch noch eine Nachricht für Sie, wegen Freitag.«
»Von Daniel?« Das letzte Mal hatte sie Daniel vor sechs Monaten gesehen, aber auch nur kurz in einer Bar an ihrem letzten Abend in Madrid. »Was hat er gesagt?«
»Keine Ahnung.« Jonathan schob Papier zurück in ihre Ordner. »Mel hat das Gespräch angenommen.«
»Gut.« Der Triumph des Todes. Es war auch Elizas Triumph, gedacht, ihre Anstellung als relativ unerfahrene Kuratorin in der neuen Galerie zu rechtfertigen. Aber Jonathan hatte überraschend wenig Begeisterung gezeigt, als sie ihm vorschlug, eine Vorbesichtigung von Daniel Flynns neuester Ausstellung zu organisieren. »Flynn?«, hatte er gesagt. »Der wird überbewertet. Und er denkt viel zu sehr an sich selbst, um in einer Galerie wie dieser auszustellen. Was sollte das also bringen? Er war immer nur an London interessiert.« Jonathan und Daniel hatten gemeinsam an der St. Martin’s School of Art studiert. Und Eliza hatte sich über Jonathans abschätzige Reaktion auf die Ausstellung, der prestigeträchtigsten, der sich die Galerie seit ihrer Eröffnung vor sechs Monaten rühmen konnte, seitdem immer wieder geärgert.
Der die Galerie finanzierende Trust hatte die Zielvorgabe gesetzt, wichtige und innovative Werke in die Provinz zu bringen und somit die Machtposition aufzubrechen, die London in der Kunstszene spielte. »Daniel Flynn wäre perfekt«, hatte Eliza gemeint. »Sein Werk erregt Aufsehen – es werden viele Leute kommen. Überlegen Sie doch, Der Triumph des Todes ist bereits für London geplant, aber ich denke, er wird einer Vorbesichtigung zustimmen. Der Termin liegt günstig, und ich weiß, dass er diese Umgebung hier vor Augen hatte.«
Zähneknirschend hatte Jonathan eingewilligt. Voller Freude hatte sie ihm den Brief gezeigt, mit dem Daniel ihren Vorschlag annahm: eine einwöchige Vorbesichtigung, ehe die Ausstellung nach London ging. Aber selbst da war er noch seltsam zurückhaltend gewesen. »Mit dieser Geste scheint er sich seiner Wurzeln zu erinnern«, hatte er gemeint. Daniel Flynn war in Sheffield aufgewachsen.
Jonathan hatte Schwierigkeiten mit seiner eigenen Arbeit – eine Fotoserie, die sich dem Thema von sozialer Ausgrenzung widmete, Fotos von Kindern, deren Leben und Herkunft sie mehr oder weniger schon von Anfang an aus dem Rennen warf. Die Idee war gut, aber er arbeitete nunmehr bereits fünf Jahre daran und schien noch immer keinen Abschluss gefunden zu haben. Was seine ziemlich säuerliche Reaktion auf den Erfolg eines seiner Kommilitonen erklären würde.
Dann hatte er aber noch ergänzend hinzugefügt: »Da haben Sie gute Arbeit geleistet, vermute ich.« Sie hatte es unterlassen, ihm von ihrer persönlichen Beziehung zu Daniel Flynn zu berichten. Es war gute Arbeit. Glücklich nahm sie die Huldigung entgegen, so lau diese auch ausfiel. Sie warf einen kurzen Blick auf den Terminplan, um zu sehen, ob sich seit gestern etwas verändert hatte. »Ich mache mich jetzt daran, die Ausstellung zusammenzustellen.«
Jonathan murmelte etwas. Er war nicht richtig bei der Sache. Dann blickte er hoch. »Brauchen Sie mich noch? Ich möchte nämlich zeitig Schluss machen. Ich habe Karten für das Theater in Leeds.«
»Nein, das ist schon in Ordnung.« Verärgert kehrte Eliza zu Mel zurück, die, über eine Liste gebeugt, widerwillig Namen abhakte.
»Daniel Flynn hat sich gemeldet«, sagte sie. »Er hat gesagt, es täte ihm Leid, dass er sich nicht früher gemeldet hat, aber er sei in London aufgehalten worden. Aber morgen werde er vorbeikommen.«
»Okay«, erwiderte Eliza. Sie hatte nicht gewusst, dass Daniel wieder in England war. Woher sollte sie auch. Aber irgendwie war sie davon ausgegangen, dass er noch immer auf Reisen und, wie von ihnen gemeinsam geplant, nach Tansania gegangen war …
Mel sah sie an und hatte ein wissendes Glänzen in den Augen, das Eliza überhaupt nicht gefiel. Sie schüttelte sich. »Ja gut, dann gehe ich wohl lieber nach oben. Er hat noch nicht alles geschickt.«
»Morgen wird noch mehr kommen«, verkündete Mel. »Wussten Sie denn, dass er in London ist?« Sie hörte das Geräusch einer sich öffnenden Tür, setzte sich auf und konzentrierte sich demonstrativ auf ihre Arbeit.
Jonathan kam aus seinem Büro und zog sein Jackett an. »Ich bin dann weg«, sagte er zu Eliza.
»Tschüss, Jonathan«, sagte Mel fröhlich. Sie sahen zu, wie er ging.
Eliza zog einen Kittel an, um ihre Kleidung zu schützen. Sie lief rasch die Treppe hoch und versuchte, ihren Ärger auf Mel wegzuschieben und sich auf die Ausstellung zu konzentrieren, die Einzelinterpretationen von Brueghels Triumph des Todes, dieser Vision einer mittelalterlichen Apokalypse, die sich mit moderner Metaphorik und Zeichen
verband, denen sich das Publikum des einundzwanzigsten Jahrhunderts unmöglich entziehen konnte.
Die Fenster der Galerie führten hinaus auf den Kanal: niedrige Brückenbögen und düsteres Wasser an diesem verhangenen Nachmittag. Die Spiegelung des Wassers verlieh dem Licht eine ganz besondere Qualität, blass und klar, und die Lage des Gebäudes gewährleistete, dass es fast den ganzen Tag über so blieb.
Als sie sich in dem lang gestreckten Raum umsah, vergaß sie die Ereignisse des Vormittags, das Gefühl von Niedergeschlagenheit und Unvollkommenheit, das Maggies Beerdigung in ihr zurückgelassen hatte, und spürte, wie das Werk sie vereinnahmte.
Es war fast fünf Uhr, als Mel in den Raum kam, um Eliza mitzuteilen, dass sie gehen wolle. »Jonathan meinte, ich könnte heute ein bisschen früher gehen«, sagte sie.
Das gehörte zu Mels Angewohnheiten – sie trat mit ihren Bitten an Jonathan heran, ohne sie einzubeziehen. Eliza hatte an dem »Jonathan meint«-Satz meist hart zu schlucken, den Mel immer dann vorbrachte, wenn sie ihren Kopf durchsetzen wollte. Aber an diesem Abend wollte Eliza allein mit ihrer Arbeit sein, also nickte sie. »Das geht in Ordnung«, sagte sie. »Vor morgen früh brauche ich Sie nicht mehr.«
Mel schien noch etwas sagen zu wollen und blieb stehen. »Soll ich absperren?«, fragte sie.
»Schließen Sie den Vordereingang ab«, wies Eliza sie an. »Aber nicht die Galerieräume. Ich muss den Alarm einschalten.«
»Gut.« Eliza hörte Mels Schritte auf der Treppe und ein paar Minuten später das Geräusch der ins Schloss fallenden Außentür. Eliza zögerte, dann ging sie nach unten. Sie überprüfte die Türen – Mel hatte sie abgeschlossen. Da sie nun schon mal unten war, konnte sie ebenso gut die Alarmanlage
für den unteren Ausstellungsbereich einschalten. Sie tippte den Code ein, bis sie das piep piep piep und danach den Dauerton hörte, der ihr dreißig Sekunden Zeit gab, den Raum zu verlassen. Sie zog hinter sich die Türen zu, und die Alarmanlage schwieg. Gut, das war also erledigt. Sie ging wieder nach oben und verlor sich in ihren Notizen.
Als sie wieder daraus auftauchte, war es draußen dunkel, und der Wind frischte auf, zerrte an den Fenstern und gab seltsame Geräusche von sich, als er durch das halb verfallene Gebäude auf der anderen Kanalseite strich. Für Eliza, geschützt und im Warmen, klang es fast beruhigend. Sie streckte sich und stand auf. Um sie herum war alles still in der Galerie, die Bilder für die Ausstellung lehnten an den Wänden.
Sie nahm eine der Tafeln hoch und hielt sie an die Wand, um ein Gefühl für die Höhe und die Positionierung zu bekommen. Es war eine der Reproduktionen aus dem Brueghel-Gebäude. Im Original war dieser Ausschnitt ein Hintergrunddetail, Teil einer trostlosen Landschaft, in der die Kräfte des Todes über das Leben triumphierten. Vergrößert und hervorgehoben war es das freudlose Abbild eines isolierten Todes.
Ein kahler Baum ragte in den Himmel, daran hing eine Gestalt, deren Kopf man in eine Gabelung zwischen zwei Ästen gezwängt hatte, so dass die leeren Augenhöhlen ausdruckslos nach oben starrten und der Körper sich vom Baum wegbog. Ein Bolzen oder Nagel war durch die beiden Äste getrieben worden und bildete eine Garotte, die den Körper am Baum festhielt. Die Arme hatte man hinter dem Rücken zusammengebunden, so dass sie in einer unnatürlichen Verrenkung verharrten. Die Beine hingen nach unten, und der Körper wurde von seinem eigenen Gewicht gestreckt. Er war halb verrottet – beinahe schon ein Skelett, aber noch nicht ganz, nicht genug. Brueghels Gestalt
war von menschlichem Leid und einer träumerischen Einsamkeit durchdrungen, die keinen, der dies sah, mehr losließ.
Eliza dachte an Ellie, ein fröhliches, hübsches Kind, dessen Leben ein so brutales vorzeitiges Ende gefunden hatte. Sie dachte an Maggie, deren Jugend so plötzlich zu Ende war. Sie dachte an das dunkle Loch und den ins Grab gesenkten Sarg, die mit schweren dumpfen Schlägen auf den Deckel fallende Erde, die immer schwächer und schwächer wurden, je mehr sich die Dunkelheit schloss.
Madrid
Im Februar, als die Dunkelheit England fest umschloss, flüchtete Eliza nach Madrid. In diesem Jahr kam der Frühling zeitig nach Zentralspanien. Über den Pyrenäen fing das Flugzeug die Morgensonne auf und ließ die nächtlichen Schatten hinter sich zurück, als sie über die Braun- und Orangetöne des Zentralplateaus flogen und dann sacht nach unten sanken, sich der Stadt näherten, die sich Eliza entgegenstreckte.
Madrid bedeutete Licht und Raum. Der Himmel war von wolkenlosem Blau, als der Bus sie durch die Stadt fuhr, vorbei an den Baumalleen und den Wohnblocks, die sauber und hell, weit zurückversetzt die Straßen säumten.
Das hostal lag im Stadtzentrum, nah am Paseo del Prado, und selbst hier, im Herzen dieser europäischen Hauptstadt, verlor sich das Gefühl von Raum nicht. Die Straßen waren so breit, dass Eliza, die zum ersten Mal hier war, bei den Übergängen nicht mitkam, wenn die Madrileños sich durch den Verkehr drängten. Die genau festgelegten Regeln für das Verhalten von Autofahrern und Fußgängern, die für sie in London so einleuchtend waren, unterlagen hier einer seltsamen
Vieldeutigkeit. So teilte ihr etwa ein Licht mit, dass sie eine Straße überqueren konnte, aber wenn sie dann auf die Straße trat (den Kopf automatisch nach rechts gewendet), näherte sich ihr plötzlich ein Auto und brauste vorbei, schien dabei ihren Rock zu streifen, während sie auf den sicheren Gehweg zurücksprang, sein Hupen noch in ihren Ohren.
Die Cafés ergossen sich über die Gehwege, die Parks versorgten die Stadt mit Luft und Grünflächen. Und um sie herum summte und schwirrte das Stadtleben, das Straßenleben der Innenstadt von Madrid. Binnen einer Woche hatte sie das Gefühl, schon ein Jahr hier zu sein. Binnen vierzehn Tagen fragte sie sich, ob sie jemals wieder von hier weg wollte.
Und in ihrer Erinnerung blieb Madrid immer die Stadt der Großräumigkeit, obwohl sie schon bald die engen Gassen der Madrider Altstadt entdeckte, den erstickenden Katholizismus der Kirchen und die Staus des unerbittlichen Verkehrs. Das war Monate, ehe die Stadt eine verblasste Vertrautheit bekam und dann ihre Kraft der Illusion verlor. Aber selbst nach einem langen Wochenende mit Daniel in Sevilla, einer Reise an die Küste nach Barcelona, blieb Madrid ihre erste Liebe.
»Des Lichtes wegen«, erklärte sie Daniel, als er ihre sture Hartnäckigkeit mit einem Kopfschütteln quittierte. »Es ist wegen des Lichts.«
Eliza stellte die Tafel zurück an die Wand. Etwas hatte sie abgelenkt. Sie lauschte. Aber es gab nur das Schweigen der Galerie und das ferne Rauschen des Verkehrs. Draußen war es dunkel. Sie warf einen Blick auf die Uhr. Nach sieben. Sie brauchte eine Pause. Sie schaltete die Beleuchtung aus und lief der Länge nach durch die leere Galerie. Es war ein langer und hoher Raum mit Holzboden, die Wände weiß getüncht, die Decke von Säulen gestützt. Einzige Lichtquelle
war der Mond, der durch die Fenster hinter ihr hereinschien, deren Schatten auf dem Boden lag und an den Wänden tanzte, wenn sie sich bewegte. Schweigen. Das Tappen ihrer Füße hallte beim Gehen wider, Ferse und Zehe, tapp-tapp, tapp-tapp.
Einen Moment lang glaubte sie ein Echo zu hören. Das Geräusch ihrer Schritte schien noch eine Sekunde anzuhalten, nachdem sie stehen geblieben war. Sie stand und lauschte. Sie ging weiter, und ihre Schuhe setzten ihr leises Tapp-tapp auf dem Boden fort. Diesmal blieb alles still, dann hörte sie es wieder, wie ein Echo ihrer eigenen Bewegung, wie weiche Schuhe, die über den Boden schlichen. Verrückt. Das ist verrückt. Es schien aus den unteren Galerieräumen zu kommen. Leichtfüßig lief sie die Treppe hinunter.
»Hallo?«, sagte sie. Der leere Raum ließ ihre Stimme widerhallen. Die unteren Galerieräume lagen im Dunkeln. Sie sah sich um. Der Haupteingang war noch verschlossen, aber das Licht für die Alarmanlage brannte nicht mehr. Jemand hatte den Alarm ausgeschaltet. Sie merkte, wie sie sich entspannte. Jonathan. Offenbar war er wegen irgendwas zurückgekommen. Sie machte sich nicht die Mühe, die Beleuchtung einzuschalten, sondern ging durch die Türen und beobachtete das Spiel der Schatten, den Fensterrahmen, der wie ein Gitterwerk auf dem Boden lag. Er musste in seinem Büro sein.
Als sie an den Säulen vorbeikam, weckte etwas ihre Aufmerksamkeit. Ein Geräusch? Sie blickte sich um, aber die Galerie hinter ihr war leer. Dann sah sie jemanden vor einem der Fenster sitzen, halb verborgen hinter einer Säule, vorgebeugt, als würde er, wer immer es auch sein mochte, irgendetwas auf dem Kanal sehr genau beobachten. Ihr Herz klopfte heftig, beruhigte sich aber wieder, als sie erkannte, wer es war. Es war die junge Frau, die in der Wohnung neben der Elizas wohnte. »Cara?«
Die Frau schrak hoch, drehte sich rasch um und wäre beinahe vornüber gekippt. »Ich habe nicht … ich …« Ihre Augen konzentrierten sich auf die hinter ihr im Dunkeln stehende Eliza. »Eliza.« Sie richtete sich auf, behindert durch das Tuch, in dem sie für gewöhnlich ihr Baby trug, Briony Rose. In dem trüben Licht wirkten ihre Augen groß und erschrocken.
Sie schien die Innentreppe benutzt zu haben, die zur Galerie führte. Es gab Pläne, einen separaten Eingang am Ende dieser Treppe einzurichten, aber noch waren die Bewohner der Wohnungen angehalten, sie nur im Notfall zu benutzen. In der Praxis jedoch benutzte Eliza sie die meiste Zeit, und Cara hatte begonnen, ihrem Beispiel zu folgen.
Eliza sah Cara an. »Haben Sie den Alarm ausgeschaltet?«, fragte sie.
Cara nickte. »Ich habe Jonathan dabei zugesehen, und daher weiß ich, wie es funktioniert«, erklärte sie. »Aber ich wollte ihn gleich wieder einschalten, ehrlich. Ich habe das schon mal gemacht. Ich liebe die Galerie. Es ist so ein schöner Ort zum Verweilen. Ich wollte gleich wieder gehen.« Sie sprach schnell, nervös, und ihre Augen blickten an Eliza vorbei auf etwas im hinteren Teil der Galerie. Das Baby beschwerte sich mit einem kurzen Weinen.
Eliza verkniff sich den Kommentar, der ihr auf der Zunge lag. Das ließe sich später klären, wenn das Baby zur Ruhe gekommen war. »Ich muss abschließen«, sagte sie brüsk. »Kommen Sie.« Sie wartete, bis Cara nach ihrer Tasche getastet hatte. »Lassen Sie mich das tragen.« Sie nahm die Tragetasche, die die andere Frau überall mit sich herumschleppte, und hängte sie sich über die Schulter. »Kommen Sie«, sagte sie noch einmal.
Cara folgte ihr langsam, den Blick über die Schulter aufs Fenster gerichtet. Ein Rendezvous? Traf Cara sich etwa mit einem Freund auf dem Treidelpfad oder in der Galerie? Das
schien keinen Sinn zu machen, hatte sie doch oben eine wirklich schöne Wohnung.
Sie stieg die Treppe hoch, hielt jedoch inne, als sie merkte, dass Cara ihr nicht folgte. »Cara?«, rief sie.
»Ich komme.« Cara war stehen geblieben, um sich das Plakat von Daniels Ausstellung anzuschauen, die Reproduktion, die Eliza sich zuvor angesehen hatte, den hängenden Mann. Sie drückte das Baby fester an sich heran. »Es ist grausig«, sagte sie.
»Kann man wohl sagen«, erwiderte Eliza schroff. Cara schien zu zögern. »Haben Sie Lust auf einen Kaffee?« Eliza bedauerte ihren Impuls fast unmittelbar, nachdem sie ihn in Worte gefasst hatte. Sie war vorsichtig, was den Umgang mit Cara betraf. Eliza empfand Mitleid für sie, aber sie hatte nicht die Zeit für die Forderungen, die ein einsamer Teenager an sie stellen mochte.
»Ja.« Cara schien eine Entscheidung zu treffen. Sie warf noch einen Blick zurück in die Galerie und folgte Eliza dann die Treppe hinauf. Eliza schaltete die Alarmanlage ein und schloss die Tür zu. Sie glaubte, erneut das Echo zu hören, als sie und Cara dem Ausgang zusteuerten, der zu den Wohnungen führte, aber als sie stehen blieb und lauschte, war alles ruhig. Der Alarm ließ seinen einzelnen Ton hören, wurde dann einen Ton tiefer und brach dann ab. Eliza ertappte sich dabei, wie sie darauf wartete, dass der Alarm losging, weil ein Eindringling in der Galerie war, aber nichts geschah. Sie entspannte sich. »Dann finden Sie das Gemälde also wirklich schlecht?«, hakte Cara nach, als sie hinter Eliza die Treppe hochstieg. Sie sprach von Daniels Plakat.
»Nicht schlecht«, erwiderte Eliza knapp. »Verstörend.« Irgendetwas quälte Eliza, und sie hätte es gern dingfest gemacht, aber Caras Geschnatter lenkte sie ab.
»Warum möchte Jonathan ihn ausstellen?«, fuhr Cara
fort. Ihre Augen huschten unruhig über die Wände des Treppenhauses.
»Wen? Daniel Flynn? Diese Reproduktion ist nur ein Teil … Man muss die Ausstellung als Ganzes sehen.« Eliza versuchte, ihren Schlüssel in ihr Schloss zu schieben. Nie schaffte sie es, ihn richtig zu halten. Wenn Cara schon dieses kleine Detail aufregte, dann würde sie den Rest verheerend finden.
»Ich weiß. Ich dachte … es ist einfach gruselig, mehr nicht.« Cara folgte Eliza durch die Tür in ihre Wohnung.
»Gute Kunst muss irritieren. Aber die Bilder sind nur für eine Woche hier.« Eliza stellte ihre Arbeitstasche und Caras Reisetasche ab und schaltete dann die Beleuchtung ein.
»Hey, das ist aber hübsch!« Cara sah sich in dem Loft um.
Eliza freute sich. Dem Trust war das Geld ausgegangen, ehe der Umbau des Dachgeschosses vollständig abgeschlossen war. Man hatte ihr Loft so weit renoviert, dass es bewohnbar war, den Kamin und die Wände repariert, Leitungen gelegt, die Böden gelegt. Sie war in nackte Ziegel und rohe Balken eingezogen, denn sie hatte dringend eine Bleibe gebraucht. Es blieb keine Zeit – und kein Geld – für sorgfältige Planungen. Sie hatte alles weiß und schwarz gestrichen und war mit ihrem Bett, ihren Stühlen, ihren Lampen und ihrer Malausrüstung eingezogen. Dann hatte sie den Raum in einen Wohn-, einen Schlaf- und einen Arbeitsbereich unterteilt. Er wirkte weiträumig und einladend. Die Sessel waren Farbtupfer vor einem der Bogenfenster, die hinaus auf den Kanal führten. Am Ende des Raums hatte Eliza ihre Staffelei aufgestellt, und ihr Gemälde, ihr Madrid-Gemälde, strahlte mit seiner mediterranen Wärme gegen die Winternacht an. Hinter ihr lud die Küche mit roten Fliesen und glänzenden Töpfen ein.
Cara trat hinüber ans Fenster und verharrte dort unsicher,
wobei das Tragetuch für das Baby ihre Silhouette zu einer missgebildeten Schwangerschaft verzerrte. Eliza schob die Papiere beiseite, die auf den Stühlen lagen, Fotos, Dias, Notizen, ein Teil ihrer Ausstellungspläne. »Warum legen Sie es – ich meine sie – nicht hier ab?«, forderte sie Cara auf.
»Sie könnte aufwachen«, sagte Cara. »Sie weint viel.« Mit einem verdutzten Ausdruck im Gesicht betrachtete sie ihr Kind und trat dann vor die Sessel, während Eliza ging, um Kaffee zu kochen, und löste die Trageschlaufe. Das Baby rührte sich, als Cara es ablegte und den Schal feststeckte. »Ich bin so müde«, sagte sie. Sie sank auf den Sessel neben dem, auf den sie das Baby gelegt hatte. »Es ist anstrengend, wenn man ganz allein ist«, sagte sie.
»Es muss harte Arbeit sein«, meinte Eliza. Sie fragte sich, was Cara erwartet hatte. Sie schenkte den Kaffee ein und stellte ihn auf den Tisch. Ihr Blick fiel auf das schlafende Gesicht des Kindes. Über Babys wusste sie nicht viel.
»Wissen Sie«, fuhr Cara fort, »ich dachte, ein Baby zu haben, wäre … nun, es würde etwas Besonderes aus mir machen. Aber jetzt bin ich nur … ich weiß nicht.« Sie zuckte mit den Schultern.
Eliza sah Cara an und überlegte, was sie darauf antworten sollte. Cara steckte während des Redens den Schal fest, den sie über das Baby gebreitet hatte, ihre Augen waren schwer vor Müdigkeit. Unter dem theatralischen Make-up, das sie bevorzugte, wirkte ihr Gesicht schmal und erschöpft.
»Brauchen Sie ein Baby, damit Sie was Besonderes sind?«, wollte Eliza wissen.
»Ich weiß nicht.« Cara zog die Stirn kraus. Sie nahm ihre Tasse. »Die ist hübsch.« Sie lehnte sich im Sessel zurück. »Ich hätte meine Wohnung auch gern so schön wie diese. Das habe ich mir so vorgestellt, als ich mit ihr schwanger war.« Sie nickte in Richtung Baby. »Ich würde meine eigene
Wohnung haben und wirklich schön herrichten. Über den Fenstern wollte ich so was drapiert haben, Sie wissen schon, was man heute so hat, und ich dachte an Pflanzen und so. Und es gab so reizende Babysachen, ich wollte …« Caras Stimme verlor sich, als sie die Pläne Revue passieren ließ, die sie gehabt hatte. »Ich dachte immer, keiner könnte mehr sagen, man sei nutzlos, wenn man ein Baby hatte. Dann hatte man was zu tun. Ständig haben sie mich angemacht: ›Du wirst es nie zu was bringen. Du musst arbeiten, wenn du die Prüfungen bestehen willst …‹«
»Und das wollten Sie nicht?« Eliza war auf der Schule immer erfolgreich gewesen und hatte es genossen, in einem System zu glänzen, dessen Anforderungen sie nie als zu hoch betrachtet hatte. Ihr Abschluss hatte sie nach London geführt, dann nach Italien und Spanien. Bildung hatte ihr die Welt eröffnet.
Cara schüttelte den Kopf. »Ich weiß nicht«, sagte sie. »Ich mochte die Schule nicht. Ich war nicht klug, und ständig hat man an mir herumgenörgelt, wissen Sie …«
»Also haben Sie ein Baby bekommen?«, sagte Eliza.
Der Regen trommelte gegen die Fensterscheibe. Cara blickte hinaus auf den Kanal und seufzte. »Nein, so war es eigentlich nicht.« Eliza fragte sich, ob Cara jemanden zum Reden hatte. Sie war eine Einzelgängerin, die sich durch die Galerie treiben ließ, das Baby in seinem Tragetuch an sich gedrückt. »Aber als ich schwanger wurde, dachte ich, dass es schön wäre. Ein Baby zu haben.« Sie trank ihren Kaffee aus und lächelte Eliza an. Sie sah sich wieder im Raum um. »Hier ist es hübsch.« Sie saß zusammengesunken in dem großen Sessel, und der angespannte, verkniffene Ausdruck verschwand aus ihrem Gesicht. Sie war dünn wie ein Kind.
2
Die Straße, die vom Friedhof wegführte, war dunkel und nass gewesen. Kerry hatte sich verlaufen, eine falsche Abzweigung genommen und war dann durch dunkle Straßen geirrt, die fast ländlich wirkten, denn Gras schlug ihr gegen die Knöchel, und grüne Ranken hingen über Mauern und verfingen sich in ihrem Haar. Endlich hatte sie den Weg zurück auf die Hauptstraße gefunden, aber jetzt war es dunkel. Sie sah auf die Uhr.
Lyn würde in dem Café auf sie warten, wo sie sich immer trafen. Bestimmt war sie wütend, wenn Kerry sich verspätete. Lyn war ohnehin wütend auf Kerry. Bei ihrem letzten Treffen hatten sie sich wegen Kerrys Vater gestritten. Immer kam es wegen Papa zum Streit. Aber vielleicht tat es Lyn ja auch ein wenig Leid wegen ihrer Äußerungen. Kerry hielt das Handy umklammert und warf erneut einen Blick darauf, als sie die Tasten drückte. Die gespeicherte Nachricht lief über das Display: … wg.d1em Papa. CU Cafy 7 KONIZUSPÄ … Lyn entschuldigte sich nie, aber Kerry wusste, wenn ihr etwas Leid tat.
Vor ihr war eine Bushaltestelle, und sie humpelte darauf zu und ließ sich dankbar auf die Mauer fallen. Sie befreite ihren Fuß aus ihren Schuhen – es waren ihre besten – und rieb sich die Zehen. Ihre Füße waren nass und schmutzig. Mit zusammengekniffenen Augen in den Regen blinzelnd, der die Lichter verzerrte, schaute sie die Straße entlang. Und da kam auch schon der Bus, setzte sich von den Lichtern ab.
Sie stieg ein, froh um die Wärme. Der Fahrer war freundlich
und lächelte sie an. »Du bist ganz schön nass, meine Liebe«, meinte er fröhlich. Der Bus war fast leer. Kerry drückte ihr Gesicht an die beschlagene Scheibe. Ruckelnd und ratternd fuhr der Bus los, so dass ihr Kopf gegen das Glas schlug.
Sie sah auf die Uhr. Sie sollte längst da sein. Sie tippte Lyns Nummer ein, aber sie bekam nur den Auftragsdienst. Also schrieb sie eine neue Nachricht: Bitte warte. Bitte warte. Bitte, bitte warte auf mich!
Lyn tat nie etwas, wozu sie keine Lust hatte. Und genau das hatte sie Kerry auch beizubringen versucht. »Du musst nicht tun, was er sagt«, pflegte sie zu sagen, wenn Papa Kerry anwies, ins Bett zu gehen oder ihr Zimmer aufzuräumen oder ihre Hausaufgaben zu machen. Aber Papa war auch nicht Lyns Papa. Lyns Papa war abgehauen. »Sie ist eifersüchtig, Kizz«, erwiderte Papa darauf. »Sie wird darüber hinwegkommen.« Und er hatte sich um einen freundschaftlichen Umgang mit Lyn bemüht, aber Lyn wollte nichts davon wissen. Manchmal machte Kerry das wütend. So las Papa ihr etwa eine Gutenachtgeschichte vor, und dann kam Lyn hereingeschneit und tat so, als würde sie etwas suchen. »Du bist zu alt für Geschichten«, meinte sie. Oder Papa versprach, mit Kerry schwimmen zu gehen. »Ich gehe mit ihr«, mischte Lyn sich dann ein. »Sie ist meine Schwester.« Aber dann vergaß sie es für gewöhnlich, und Kerry kam überhaupt nicht zum Schwimmen.
Und dann war Lyn weggegangen.
Sie presste ihr Gesicht gegen die Scheibe. Sie waren fast da. Ungeduldig zappelnd stellte sie sich an die Tür. »Ich kann dich hier nicht rauslassen, meine Liebe«, sagte der Fahrer. »Ich muss warten, bis wir die Haltestelle erreicht haben.«
Und dann öffneten sich die Türen, und Kerry war schon draußen aus dem Bus und rannte los, als das »Pass auf dich auf, Kleine« des Fahrers ihr nachhallte. Es hatte zu regnen
aufgehört, aber ihre Kleider waren nass, und ihre Füße schmerzten. Sie rannte die Rampe hinauf, die zu den Straßenbahngeleisen führte, und dann über die Brücke hoch über der Straße. Hier ging es zur Straßenbahn und nach Meadowhall. Dort ging es zum alten Markt.
Die Stufen führten zu einer leeren Straße und einem Parkplatz, beides roch nach Pisse. Diese Stufen war sie immer mit Ellie hinuntergerannt, und beide hatten sich mit zugehaltenen Nasen lachend an den Leuten vorbeigedrängt, begeistert von all den Geschäften, den Lichtern und den Menschen. Und Papa kam hinterher gerannt, auch er lachend, und sagte Dinge wie: »Vorsicht, Kizz, mach langsam, denk dran, ihr habt einen alten Mann dabei.« Und dann kaufte er ihnen einen Burger – Ellies Mama sah es nicht gern, wenn Ellie Burger aß, also war es ein Geheimnis. Kerry und ihr Papa liebten Geheimnisse und … Darüber wollte Kerry nicht nachdenken.
Sie versuchte, auch nicht an den Nachmittag zurückzudenken, daran, wie der Nebel ihr fast die Sicht versperrt hatte, als sie den Pfad entlangging, an das schwarze Erdrechteck und all die Blumen, tot wie die Menschen in den Gräbern. Und die Namen. Es waren nur Namen, keine Menschen, bis sie den Stein mit den Goldlettern sah. Ellie … Ellie und Kerry.
Keine Ellie mehr. Ihr fielen die Kinder wieder ein, die an jenem letzten Morgen an ihrem Haus vorbeigelaufen waren, an dem Tag, als die Polizei gekommen war und Kerrys Papa weggebracht hatte. Sie mussten auf diesem Weg vorbeikommen, es gab keinen anderen Weg für sie, und Kerry wartete darauf, dass sie ihr zuriefen: »He, Kizz, kommst du?«, wartete und rannte nicht wie üblich hinaus, um sich der untergehakten Mädchen anzuschließen, die zur Schule unterwegs waren, aber keine rief und keine sah her, jedenfalls nicht wirklich, nur Seitenblicke, die Kerry, hinter den Tüllgardinen
versteckt, beobachten konnte, und ihre Gesichter waren angespannt und verängstigt, und sie flüsterten im Vorübergehen miteinander und ließen ihre Blicke wieder über das Haus schweifen, und dann rannten sie los, die Straße entlang.
Und sie hatte sich auf den Weg gemacht, Maggie zu besuchen. Maggie unterhielt sich immer mit Kerry, wenn Mama krank war. »Du bist in Ordnung, Kerry«, sagte sie dann. »Du bist ein großartiges Kind.« Und sie meinte es auch so. Jedenfalls war Kerry sich sicher gewesen, dass sie es so meinte. Aber dann war Kerry zu Maggie gegangen, und Maggies Gesicht war verzerrt und fleckig gewesen wie das von Mama, und sie hatte Kerry angesehen, als würde sie sie hassen. »Geh weg von mir«, hatte sie gesagt. Sie hatte es nicht geschrien, sondern auf kalte Weise gesagt, wie tot. »Geh weg von mir, du …« Aber da war jemand an die Tür gekommen und hatte Maggie ins Haus gezogen und Kerry auf dieselbe Weise angeblickt und die Tür zugeschlagen. Und Kerry hörte nur noch Weinen.
Und Papa war ins Gefängnis gekommen. Er schrieb Kerry. Einmal in der Woche kamen die Briefe, und Kerry schrieb zurück. Aber sie konnten einander nichts Wichtiges mitteilen. Kerry konnte nicht darüber schreiben, wie es mit Mama zu Hause war, oder was in ihrer letzten Schule und der Wohnung, in der sie gewohnt hatten, passiert war. Sie erinnerte sich noch immer an die Stimmen in der Nacht: Pädo! Pädo! Und an das Geräusch klirrenden Glases, als ein Ziegelstein durch das Vorderfenster flog. Davon konnte sie Papa nichts erzählen. Und er erzählte Kerry auch nichts. Er schrieb Dinge wie: Wenn man sich erst mal daran gewöhnt hat, ist es gar nicht mehr so schlimm und Keine Sorge, ich bin bald wieder zu Hause. Nur dass er das jetzt nicht mehr so häufig schrieb. In seinem letzten Brief hatte er geschrieben: Das Gefängnis verändert die Menschen, Kizz …
Sie schaute im Fernsehen keine Nachrichten, sie las keine
Zeitungen. Die Lehrer sagten, dass sie das tun sollten. Aber Kerry wollte nicht lesen, was sie über ihren Vater sagten: Perverser. Monster. Bösewicht …
Sie war angekommen – Victoria Quays, der Eingang zum Kanalbecken. Das Wasser war schwarz und spiegelte das Weiß des Mondes. Sie eilte über das Kopfsteinpflaster auf das Café zu, und ihre Füße knickten um auf dem holprigen Untergrund.
Sie presste ihre Nase ans Fenster. Lyn? Die Tür zum Café war aufgegangen, und einige Leute waren herausgekommen. Kerry knabberte an ihren Fingernägeln. Sie konnte durch die beschlagenen Fenster hineinsehen. Es waren nur ein paar Leute drin, und sie war sich sicher … Sie schaute angestrengt hinein. Lyn war nicht da.
Sie versuchte es unter Lyns Nummer, aber wieder landete sie beim Auftragsdienst. »Ich bin da«, sagte sie. »Ich hab sie bekommen.« Ich habe die Nachricht bekommen. So was Dummes. Natürlich hatte sie die Nachricht bekommen. Lyn wusste das. Es war spät, also war sie es leid gewesen, zu warten, und war gegangen.
Aber noch wollte Kerry nicht aufgeben. Sie könnte den Treidelpfad entlanglaufen, zur Galerie gehen. Vielleicht war Lyn dort. Sie sah den schwachen Schimmer des Wassers vor ihr. Die Lichter der Stadt glühten orange vor dem Himmel, aber der Pfad lag im Dunkeln. Sie zögerte einen Moment, dann trat sie in den Schatten der ersten Brücke. Die Luft war kalt und feucht, und der Boden fühlte sich unter ihren Füßen weich und glitschig an.
Von der Tunnelmündung her drang ein schwacher Schein zu ihr, und der muffige Geruch des Wassers umfing sie. Sie ertastete sich ihren Weg, die Hände gegen die geschwungene Steinmauer gepresst, die sich tief über sie wölbte, fast bis zu ihrem Kopf. Das Wasser klatschte plötzlich gegen das Gemäuer, als hätte etwas eine Störung verursacht.
Als sie aus dem Tunnel herauskam, zeichnete sich eine Form im Wasser ab, ein vertäutes Boot, dunkel und konturenlos, halb verborgen im Schatten der Brücke. Die Planken an Deck waren grau und uneben. Der Pfad schien hier zu Ende zu sein, die Gebäude reichten bis an den Uferrand. Vor ihr erhob sich eine Ziegelmauer. Sie befand sich auf der falschen Seite des Kanals. Sie musste zurück zum Kanalbecken.
Der Mond kam zwischen den Wolken hervor, und auf dem Wasser spiegelte sich das Kanalufer. Die Wasseroberfläche bewegte sich nicht. Sie konnte die Mauern erkennen, die den Pfad säumten, die im Spiegel des Kanals gerahmten Sträucher und den Pfad. Sie machte kehrt, und vor ihr lag Dunkelheit, das schwarze Maul des Tunnels, der Geruch des Kanals, dessen Oberfläche sich gekräuselt hatte, als hätte sich etwas durchs Wasser bewegt. Sie wollte diesen Weg nicht zurückgehen.
Ihre Kehle war wie zugeschnürt. Sie wandte sich noch mal um, das Boot lag neben ihr tief im Wasser, vor ihr ragte eine Ziegelmauer auf. Sie blickte zurück, aber der Tunnel wartete, lockte Kerry in die Falle zwischen Kanal und Mauer.
Eliza konnte nicht schlafen. Sie verhedderte sich in der Decke, als sie eine bequeme Stellung zu finden versuchte, und ihr war zu heiß, dann wieder zu kalt. Es regnete erneut, und aus dem stetigen Schlagen gegen das Fenster wurde ein unregelmäßiges Prasseln, da der Wind den Regen in Schauern dagegen peitschte. Das Dach knarrte. Sie drehte sich um und klopfte das Kissen in Form und legte ihren Arm abgewinkelt unter ihren Kopf. Tief und langsam atmen, lass dich ins Bett fallen, lass einfach los und schmilz weg … Von der anderen Wandseite drang ein Klappern zu ihr, als wäre etwas auf den Boden gefallen und drehte sich dort im Kreis, bis es zur Ruhe kam. Wieder war sie wach.
Sie dachte an Maggie und an Ellie. Der Anblick von Caras Baby hatte sie daran erinnert, wie sie Ellie das erste Mal gesehen hatte, ein winziges Bündel in Maggies Arm. Mit der älteren Ellie hatte Eliza mehr anzufangen gewusst, mit dem klugen Mädchen, das die Begabung ihrer Mutter für Kunst besaß und sich für Wörter begeisterte, die ihre eigenen zu sein schienen. Ebeil Azile …
Bilder der Ausstellung nahmen vor ihrem geistigen Auge Gestalt an. Sie wollte sie nicht sehen, nicht jetzt. Plötzlich war ihr dieser mittelalterliche Totentanz unheimlich. Sie drehte sich wieder um, brachte die Steppdecke in Unordnung. Ein kalter Luftzug traf sie. Sie sah auf die Uhr. Ein Uhr. Der morgige Tag würde hart werden. Sie brauchte dringend Schlaf. Wieder spürte sie den Luftzug. Sie wusste, was es war – es war schon öfter vorgekommen. Cara war offenbar über die Außentreppe heraufgekommen und hatte die Tür nicht richtig zugemacht, so dass der Wind sie aufgestoßen hatte.
Sie stand auf. Es war eiskalt. Vor Kälte zitternd, zog sie ihren Morgenmantel fest um sich, und warf einen Blick durch ihre Tür nach draußen. Der Flur lag im Dunkeln, aber die Tür stand offen und bewegte sich im Wind. Wo es hereingeregnet hatte, stand Wasser auf dem Boden. Mit einem kräftigen Schlag, damit sie auch ins Schloss fiel, zog sie die Tür zu und hoffte fast, Cara möge es hören und mitkriegen, was passiert war.
Sie kuschelte sich wieder ins Bett, doch die mühsam errungene Wärme war weg. Jemand lief auf der anderen Seite der Wand umher. Sie konnte weiche Schritte hören, die sich rückwärts und vorwärts, rückwärts und vorwärts bewegten. Seit Cara eingezogen war, hatte das Baby fast jede Nacht geschrien.
Es regnete jetzt heftiger, und sie konnte die von der Dachrinne auf die Feuerleiter platschenden Tropfen hören. Eliza
entglitt in jenen Schwebezustand, der weder Schlaf noch Wachen war. Gedankenfetzen formten sich zu Träumen. Dann war sie wieder wach. Im Halbschlaf ein plötzliches Geräusch. Sie lauschte. Nur der Regen und der peitschende Wind. Manchmal fegte er durch die kaputten Dächer und Fenster der Gebäude längs des Kanals und gab einen schrillen, klagenden Ton von sich. Von der anderen Seite der Wand hörte sie das Baby. Wieder schaute sie auf die Uhr. Zwei. Jetzt war sie hellwach. Vielleicht sollte sie sich einen Kakao machen.
Sie musste schlafen. Sie würde es mit heißer Milch versuchen. Sie stand auf und ging zum Kühlschrank. Es war nicht mehr viel Milch übrig, aber es reichte. Gerade so eben. Gähnend und vor Kälte zitternd, goss sie die Milch in einen Topf und zündete das Gas an. Vielleicht sollte sie sich vor dem Feuer in einen Sessel kuscheln, ihre Milch trinken und dort versuchen einzuschlafen.
Die Milch begann zu schäumen. Sie goss sie in ein Glas und streute etwas Schokolade obendrauf. Dann legte sie sich eine Decke um die Schultern und kuschelte sich auf den Sessel. Der Regen trommelte gegen das Oberlicht über ihrem Kopf. Der Wind wurde stärker, und das Fenster klapperte. Sie hörte die Treppe knarren, und einen Moment lang glaubte sie, es sei jemand draußen, aber es war nur der Wind, der das Gebäude zum Ächzen und Stöhnen brachte.
Das Weinen war einem schluckaufartigen Schluchzen gewichen. Eliza rutschte unruhig hin und her. Sie konnte nichts tun. Sie trank ihre Milch und versuchte, das Geräusch auszublenden. Die Milch war warm und tat gut, und der Sessel war weich und bequem, als sie zurück in die Polster sank. Ihr wurden die Augen schwer, und sie ließ das leere Glas zu Boden fallen. Weich und warm. Ein Schluchzen, dann Stille. Ein Schluchzen, und Stille. Sie sah nach dem Baby. Der Flur war lang, und es gab Türen, und hinter einer
davon war das Baby, dann war sie in der Galerie, und das Gemälde an der Wand war der Friedhof, und sie protestierte, weil sie dieses Gemälde nicht haben wollte. »Du musst.« Es war Maggies Stimme, und sie lachte. Sie wollte nach dem Gemälde greifen, aber als sie es berührte, zerfiel es ihr unter den Fingern, die Farbe blätterte ab, fiel von der Leinwand und verschwand, als ihre Hand sich tiefer und tiefer ins Dunkel grub, durch das Schwarz des Mutterbodens, das Gelb des Lehms, und dann war es der Kanal, und sie konnte die Gestalt erkennen, die immer wieder aus den Tiefen des Wassers herauskam, aus dem gemalten Grab.
Und dann war der Morgen da, öde und trostlos. Steif und kalt erwachte sie im Sessel. Es hatte zu regnen aufgehört, und auf der anderen Wandseite war alles still.
Die leeren Gebäude waren im Morgengrauen nur undeutlich zu erkennen, doch ihr Verfall wurde offenkundig, je höher die Sonne stieg. Das umgebaute Lagerhaus wirkte fehl am Platz, neu. Still lag das Wasser da und glänzte im Morgenlicht. Hier wurde der Kanal kaum genutzt. Weiter unten am Treidelpfad führte eine Brücke über den Kanal, der sich unter der Straße durch einen kurzen Bogentunnel schob. Als der Himmel heller wurde, zeichnete sich die Brücke als Silhouette ab, das Wasser im Tunnel darunter war von undurchsichtigem Schwarz. Der wolkenverhangene Himmel versprach noch mehr Regen. Frühmorgendlicher Autoverkehr störte die Stille, und der Geruch von Autoabgasen erfüllte die Luft. Das Licht kroch über das Wasser, über die Tunnelmündung und spiegelte sich oben am Mauerwerk. Farben wurden erkennbar, das stumpfe Grün des Unterholzes am Treidelpfad, das Schwarz der durchweichten Erde, das Rot, Gelb und Blau weggeworfener Chips-Tüten, Limodosen, Zigarettenpackungen. Das Licht streifte das bröckelnde Mauerwerk, das in den Fugen wuchernde
Unkraut. Der Schatten des Tunnels legte sich scharf auf das Wasser, das, vom Wind sacht bewegt, gegen die Uferböschung klatschte.