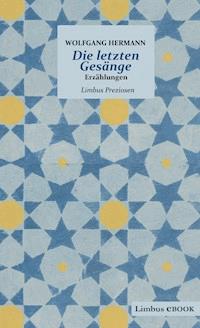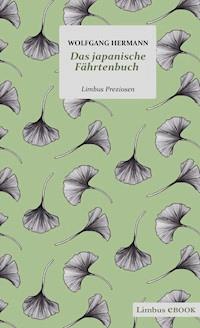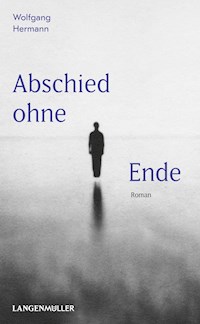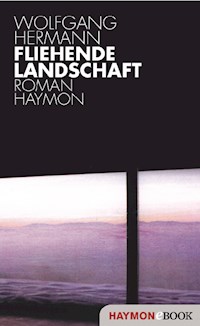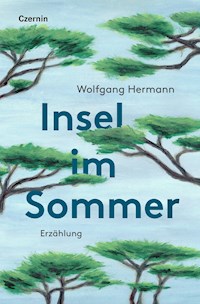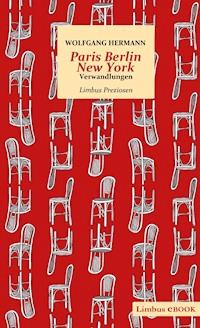14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Czernin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Seit ihrer Eheschließung mit meinem Vater kannte Mutter vor allem eins: den Verzicht.« Wolfgang Hermann skizziert in seiner neuen Prosa feinfühlig und einprägsam eine Frau, die ihr Leben nicht so gestalten konnte, wie sie es sich erhofft hatte: selbstbestimmt, frei und künstlerisch. Anneliese wächst im Vorarlberg der Zwischenkriegszeit auf. Sie will ihr eigenes Geld verdienen, mit ihrem eigenen Auto fahren und versucht, sich zu emanzipieren. Doch das ist nicht so einfach: Zunächst arbeitet sie unbezahlt für ihren Vater im Sägewerk, später im Büro ihres Mannes. Mit der Heirat scheint auch der Traum von Liebe und der Schauspielkarriere zu platzen. Kann sie sich von ihren gesellschaftlichen Fesseln befreien? Wird sie dem kalten, harten Ehemann entkommen? Wolfgang Hermann porträtiert in seiner Erzählung das Leben einer Bregenzer Tischlertochter, einer Frau und Mutter, die einer scheinbar unglücklichen Ehe zu entfliehen versucht. Gleichzeitig schafft er einfühlsam das Bild einer ganzen Generation aus einer Zeit, die uns staunen lässt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 91
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Wolfgang Hermann
BILDNIS MEINER MUTTER
Erzählung
Wolfgang Hermann
BILDNIS MEINER MUTTER
Erzählung
Czernin Verlag, Wien
Gedruckt mit Unterstützung der Stadt Wien, Kultur und des Landes Vorarlberg
Hermann, Wolfgang: Bildnis meiner Mutter / Wolfgang Hermann
Wien: Czernin Verlag 2023
ISBN: 978-3-7076-0788-8
© 2023 Czernin Verlags GmbH, Wien
Lektorat: Hannah Wustinger
Autorenfoto: Volker Derlath
Coverfoto: Privat
Umschlaggestaltung und Satz: Mirjam Riepl
Druck: Finidr
ISBN Print: 978-3-7076-0788-8
ISBN E-Book: 978-3-7076-0789-5
Alle Rechte vorbehalten, auch das der auszugsweisen Wiedergabe in Print- oder elektronischen Medien
Inhalt
Teil I (1994)
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Teil II (2022)
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
I
(1994)
1
Mit den längeren Schatten der Platanen auf dem Cours Mirabeau verblassen langsam die Farben und der kühlere Windhauch aus Nordwest, von den nach Arles reichenden Ebenen hinter Puyricard und weiter, von der Camargue und nordwärts, das Rhonetal herunter, löst da und dort vereinzelte welke Blätter aus den Kronen der Platanen, manche von ihnen trudeln, für einen Augenblick schwebend, wie Drachen an Schnüren auf die Promenade, wo die dicht an dicht Gehenden unachtsam über sie hinweggehen. Die Gehenden: Während die langsam herabsinkende Nacht mehr und mehr Raum einnimmt zwischen ihren Körpern, sehe ich ihre Augen steigen, aus der Nachmittagsmüdigkeit erwachen, dem lichterflutenden Abend entgegen mit der ohne Ende über den Cours, die Hauptstraße der kleinen Stadt Aix-en-Provence am Fuß der Sainte-Victoire, rollenden Wagenkette. Gut geschützt im Betrachten, will ich mit der Niederschrift über meine Mutter beginnen. Seit langem trage ich mich mit dem Gedanken, über sie zu schreiben, habe mir auch schon einen Ruck gegeben und begonnen, aber immer blieb es beim Angedeuteten. Heute, im sinkenden Winterlicht dieses Novembertags, will ich mit meiner Absicht ernst machen. Was weiß ich von meiner Mutter? Ich habe Bilder, Erinnerungen, Fantasien. Und ich habe mein Nichtwissen: Aus diesem Nichtwissen will ich meine Kraft schöpfen.
Ein erstes Bild: die Schreinerei meines Großvaters in Bregenz. Mutter wuchs mit dem Geruch von frischgesägtem Holz, mit dem trockenen Singen der Kreissäge auf. Der Holzgeruch, die Säge, das Versteckspiel hinter den Holzklaftern ist für sie zeitlebens ein Ort der Sehnsucht geblieben. Wieder und wieder erzählte sie meinen Geschwistern und mir dieselben Geschichten rund um die Schreinerei ihrer Kindheit. Die frühesten Bilder: Versteckspiele zwischen den Holzstapeln, große, starke Männer, die lange Balken über den Sägewerkshof schleppen. Einmal die Lustschreie eines Liebespaars, versteckt irgendwo im Holz.
Mehrmals am Tag dampfte die »Wälderbahn« vorbei, eine Schmalspurbahn, die Bregenz mit dem höhergelegenen Bregenzerwald verband, Endstation Bezau, nach etwa dreißig Kilometern abenteuerlicher Fahrt den Ufern der Bregenzerach entlang stromaufwärts. Das Zischen, Dampfen, Rauchen, Heulen dieser Eisenbahn prägte den Tagesablauf der Kinder im sogenannten Vorkloster, denn sooft das »Wälderbähnle«, wie man dort sagte, vorbeidampfte, rannte eine johlende Kinderschar los, darunter natürlich auch meine Mutter, die unmittelbar am Bahndamm wohnte, dem Zug hinterher, wie er langsam und beschwerlich die leichte Steigung hinaufschnaubte und rauchend, heulend, pfeifend im Tunnel verschwand, jenseits dessen es dann über Langen und Doren weiterging in den Vorderen Bregenzerwald. Ich selbst habe in meiner Kindheit einige seltene Male die Wälderbahn in diesem Tunnel verschwinden sehen, freilich nicht mehr dampfend, sondern von einer roten Diesellok gezogen. Und irgendwann in den ersten Gymnasialjahren sind wir mit unserem Lehrer von einem Schulausflug, nach einer langen Wanderung in Bezau angekommen, mit der Wälderbahn nach Bregenz herausgefahren, von wo uns dann ein gewöhnlicher Personenzug nach Dornbirn brachte. Diese Fahrt mit der Wälderbahn ist meine einzige geblieben. Ich sehe uns Halbwüchsige noch auf den Trittbrettern des fahrenden Zugs herumblödeln, den Mädchen im Wageninneren zuwinken, bis schließlich der erschreckte Lehrer uns in den Wagen zurück- und in die Ordnung hineinpfiff. Es war schon damals eine nostalgische Fahrt, und der umsichtige Lehrer hatte wohl mit uns einen Ausflug in die Geschichte machen wollen, wohl wissend, dass es die alte Schmalspurbahn nicht mehr lange geben würde.
Mutter hatte drei Schwestern und zwei Brüder. Sie war die Viertälteste, nach ihr kamen die beiden Brüder, Helmut und Reinhold. Reinhold hatte kein Glück: Er starb mit fünf Jahren an einem unerkannten Eiterzahn. Reinholds Geschichte hörte ich wieder und wieder aus Mutters Mund, von Seufzern des Bedauerns begleitet. Und manchmal war mir, als wäre er mein Bruder. Später allerdings, es ist noch nicht lange her, gestand mir Mutter einmal, sie wäre bei Reinholds Tod erleichtert gewesen, denn jetzt würde ihre Mutter ihn nicht mehr bevorzugen und verwöhnen können und für sie, die um zwei Jahre Ältere, falle wieder mehr Aufmerksamkeit ab. Der andere Bruder, Helmut, war der Jüngste in der Familie, und obwohl (oder weil?) Eltern und Schwestern sich besonders seiner annahmen, blieb er hinter allen Erwartungen zurück.
Fotografien zeigen die vier Schwestern immer vergnügt, hellwach, wie sie ihre Eltern umringen, der Vater herzlich und warm, die Mutter ein wenig ätherisch, ungreifbar dem Fotografen posierend, mit viel Sorge für Helmut, den Jüngsten, den man beim Betrachten leicht übersieht. Schon früh, wenn Mutter mir diese Fotografien zeigte, empfand ich Bedauern darüber, von dieser Zeit und dieser Familie ausgeschlossen und in die meine versetzt worden zu sein.
Ein Weihnachtsabend Mitte der Zwanzigerjahre: Meine Mutter war etwa drei Jahre alt. Ein Friseurmädchen aus der Nachbarschaft wird noch rasch zum Bäcker geschickt, die letzten fehlenden Kleinigkeiten für die Bescherung zu besorgen. Da sieht sie im Licht der Bäckerei gegenüber einen kleinen dunklen Körper am Zaun. Es ist ein kleines Mädchen, halberfroren, eingeschlafen im dichten Schneetreiben. Sie sieht in das Gesicht des Mädchens und erkennt die kleine Anneliese, der sie immer das Haar schneidet. Sie trägt die Halberfrorene nach Hause, wo man ihr Fehlen wegen der Festvorbereitungen noch gar nicht bemerkt hat.
Wer weiß, wer seine Mutter ist? Töchter und Söhne sehen ihre Eltern in Beziehung zu sich selbst, und, so ergeht es mir heute noch, bemerken mit Erstaunen, dass sie ein von ihren Kindern unabhängiges, ja ihnen bewusst verborgenes Leben führen. Meine Eltern lebten sosehr auf sich, auf ihr Haus, ihre Geschäfte bezogen und beschränkt, dass ich heute erstaune, wenn meine Mutter mir von einer guten Freundin erzählt, zu der sie über Jahrzehnte hinweg, seit ihrer Kindheit den Kontakt aufrecht erhielt. Mir erschienen meine Eltern immer so weit entfernt von der Welt, den anderen, dem Leben. Sie schienen, besonders mein Vater, keine Freunde zu haben und auch keiner solchen zu bedürfen, sodass es mir jetzt schwerfällt, mir die beiden in fröhlichem Gespräch mit Gleichgesinnten, Vertrauten, Freunden vorzustellen.
Als Kind glaubt man, das Leben seiner Mutter zu kennen, oder man glaubt, es zu ahnen. Später begreift man, dass man von einem geheimnisvollen Menschen großgezogen wurde, dessen Persönlichkeit sich in unzählige Facetten auffächert.
Ein Freund, dem ich von meinem Vorhaben erzählte, über meine Mutter zu schreiben, fragte mich, ob es nicht zu früh dafür wäre. Und richtig, ich nehme an, die meisten derer, die über ihre Mutter geschrieben haben, befanden sich in, wenn nicht vorgerücktem, so doch »stattlichem« Alter. Und sie taten es meist nach dem Tod ihrer Mutter, an Stelle eines nicht mehr zu führenden Gesprächs. Oder als Wiedergutmachung. Als Trauerarbeit. Als Ritus. Als Requiem.
Andere Zeichen stehen über meinem Vorhaben: Meine Mutter lebt, ich schreibe diese Zeilen also nicht für eine Tote. In einem halben Jahr feiert sie ihren 72. Geburtstag, während ich um fast vierzig Jahre jünger bin. Habe ich denn das Recht, über einen um fast vierzig Jahre älteren Menschen zu schreiben? Und habe ich es nicht jetzt, wann hätte ich es? Wenn ich selbst in ihrem Alter wäre? Aber die zu beschreibende Person altert ja mit mir, und galoppieren die Jahre nicht davon? Kann ich denn wissen, ob ich ein solches Alter erreichen werde? Nein, heute habe ich meine Spurensuche in Angriff genommen, und nichts soll mich von ihr abbringen.
Das Elternhaus meiner Mutter stand in der Mariahilfstraße 32. Sie erinnert sich noch an jedes Zimmer, und ihre Erzählungen ergeben ein anmutiges Bild: Im unteren Stock lagen die Wohnräume, das Wohnzimmer mit der schön gearbeiteten Kredenz aus hellem Nussholz, »der große Spiegel dazu passend, ebenfalls die Stühle und der Tisch«. In einer Ecke stand ein grüner Kachelofen »mit einer Eule aufgesetzt«, eine Nähmaschine mit großem Schwungrad, »das mit einem schwarzen Gummiband durch Fußbewegungen die Maschine in Schwung brachte«. (Wen zitiere ich? Die Stimme meiner Mutter, wie sie sich in ihren »Rückblick« betitelten Aufzeichnungen ausdrückt. Ich habe diese maschingeschriebenen Aufzeichnungen vor mir liegen und werfe von Zeit zu Zeit einen Blick hinein.) »In der Küche stand ein sehr schöner langer Küchenschrank mit weißem Oberteil, wo viel Geschirr drin Platz hatte. Dort drin hatte Papa auch seine dritten Zähne versteckt, weil er sich einfach nicht an sie gewöhnen konnte und auch nicht wollte. Mama kochte auf einem Holzherd, der ein Warmwasserschiff hatte. (…) An den Sonntagen gab es immer einen guten Kuchen oder eine Rahmtorte mit Schokolade … Mama hatte eigene Hühner, um deren Nachwuchs sie sich selbst kümmerte. Im Frühjahr piepsten die frisch geschlüpften Küken im Drahtgeflecht … Da war noch ein großes Wohnzimmer mit einem großen hellen Schrank und Tisch und Diwan. Von dort ging eine Tür in die Speis und von dort kam man über eine Holzstiege direkt in die Maschinenhalle unserer Schreinerei. (…) Eine steile Stiege führte in den ersten Stock, wo unser Bad und drei Schlafräume waren. Das Elternschlafzimmer mit einem wunderschönen Marmor-Doppelwaschbecken und einem langen Spiegel, dem Ehebett mit zwei Nachtkästchen, zwei Schränken und weichen Teppichen … Dieses Schlafzimmer hatte einen nur den Eltern eigenen Geruch, den ich sehr gerne mochte. Er strahlte Geborgenheit aus …«
Die Eltern meiner Mutter besaßen eines der ersten Autos in Bregenz. Man war jemand. Das Geschäft ging gut. An den Sonntagen fuhr die Familie mit dem offenen Steyr zu den Großeltern und Onkeln ins nahe Kennelbach. Die vier Mädchen trugen weiße Kleider, die beiden Brüder weiße Matrosenanzüge. (Beim Betrachten der vergilbten Fotografien überkommt mich Stolz auf die Familie meiner Mutter, und für einen Augenblick sitze ich im offenen Wagen, auf der staubigen Straße nach Kennelbach, von den johlenden Dorfkindern als Attraktion begrüßt.)
Jahre zuvor hatte sich mit diesem Auto folgendes ereignet: Die Eltern meiner Mutter waren zusammen mit dem Werkmeister ihres Sägewerks in Kennelbach, das der Vater meiner Mutter inzwischen aufgebaut hatte, im Wagen unterwegs nach Dornbirn. Da geschah es, dass sie auf einem beschrankten Bahnübergang zwischen den beiden Bahnschranken eingeschlossen wurden. Der Zug raste heran, und mein Großvater trat aufs Gas. Damals war ein Auto noch ein Automobil: starke, schwere Kühler, wuchtige Stoßstangen. Mühelos durchschlug der Wagen den Bahnschranken, und sowohl Großmutter als auch Großvater und der Werkmeister kamen mit leichten Verletzungen und einem großen Schrecken davon. Das geschah nicht lange vor Mutters Geburt. Wäre Großvater nicht aufs Gas getreten, meine Mutter wäre nie geboren worden. Und die kleine Geschichte vom Bahnübergang ist es wert, am Kamin erzählt zu werden.
Jahre später, meine Mutter war inzwischen eine Frau von zweiundzwanzig Jahren, beschlagnahmte die in Vorarlberg einrückende französische Armee (die Vorarlberger hatten Gelegenheit, zum ersten Mal in ihrem Leben Maghrebiner und Schwarzafrikaner aus den französischen Kolonien zu bestaunen) den fabriksneuen großen BMW meines Großvaters. Meine