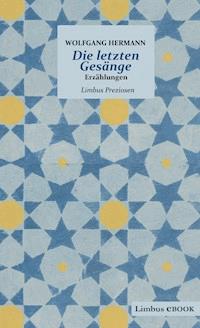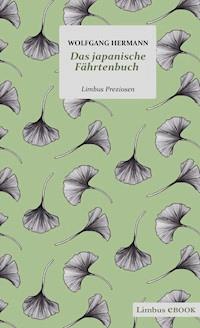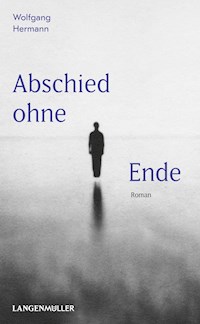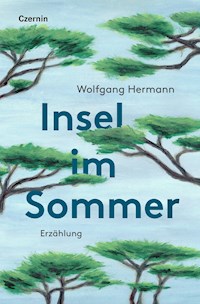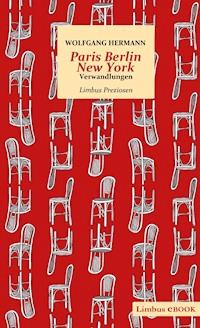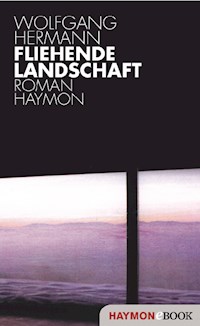
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sachte und konsequent erzählt Wolfgang Hermann in diesem knapp gehaltenen Roman die Geschichte eines Menschen, dem Flucht zum Stillstand wird, der von Ort zu Ort hastet und das Unstetsein dabei als Laster empfindet. Behutsam, wie es sein Zustand erfordert – er liegt nach einem Herzanfall im Krankenhaus –, nähert sich der Ich-Erzähler den vergangenen Jahren, die durch ständiges Unterwegssein gekennzeichnet waren. Die Orte, an denen er verweilt, bieten ihm die Möglichkeit, sich in die realen Landschaften und deren Beschreibung zu versenken, um so Abstand zu gewinnen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 105
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wolfgang Hermann
Fliehende Landschaft
Roman
für Daniela und Florian, der in mir immer leben wird
So gibt es nun gar viele andere große und verschiedene Ströme, unter diesen vielen aber gibt es vorzüglich vier, von denen der größe und der am äußersten rundherum fließende der sogenannte Okeanos ist; diesem gegenüber und in entgegengesetzter Richtung fließend, ist der Acheron, welcher durch viele andere wüste Gegenden flieg vorzüglich aber auch unter der Erde fortfließend in den Acherusischen See kommt, wohin auch der meisten Verstorbenen Seelen gelangen, und nachdem sie gewisse bestimmte Zeiten dort geblieben, einige länger, andere kürzer, dann wieder ausgesendet werden zu den Erzeugungen der Lebendigen. Der dritte Fluß strömt aus zwischen diesen beiden und ergießt sich unweit seiner Quelle in eine weite mit einem gewaltigen Feuer brennende Gegend, wo er einen See bildet, größer als unser Meer, und siedend von Wasser und Schlamm. Von hier aus bewegt er sich dann im Kreise herum trübe und schlammig, und indem er sich um die Erde herumwälzt, kommt er nächst andern Orten auch an die Grenze des Acherusischen Sees, jedoch ohne daß ihre Gewässer sich vermischten. Und nachdem er sich oftmals unter der Erde umhergewälzt, ergießt er sich zuallerunterst in den Tartaros. Dies ist der, den man Pyriphlegethon nennt, von welchem auch die feuerspeienden Berge, wo sich deren auf der Erde befinden, kleine Teilchen heraufblasen. Diesem wiederum gegenüber strömt der vierte aus, zuerst in eine furchtbare und wilde Gegend, wie man sagt, und die vonFarbe ganz und gar dunkelblau ist, welche sie die stygische nennen, und den See, welchen der Fluß bildet, den Styx. Nachdem sich dieser nun hier hineinbegeben und gewaltige Kräfte aufgenommen in sein Wasser, geht er unter die Erde, wälzt sich herum, kommt dem Pyriphlegethon gegenüber wieder hervor und trifft auf den Acherusischen See an der gegenüberliegenden Seite. Und auch dieser vermischt sein Wasser mit keinem andern, sondern geht ebenfalls im Kreis herum und ergießt sich wieder in den Tartaros gegenüber dem Pyrzlphlegethon. Sein Name aber heißt, wie die Dichter sagen, Kokytos. Da nun dieses so ist, so werden, sobald die Verstorbenen an dem Orte angelangt sind, wohin der Dämon jeden bringt, zuerst diejenigen ausgesondert, welche schön und heilig gelebt haben, und welche nicht. (Platon, Phaidon)
Und es kommt ja darauf an, daß man wie das Geschehen ist und nicht wie die Person, die handelt; man müßte jeder allein sein mit dem, was geschieht, und zugleich müßte man zusammen sein, stumm und geschlossen wie die Innenseite von vier fensterlosen Wänden, die einen Raum bilden, in dem alles wirklich geschehen kann und doch so ohne aus einem in den anderen zu dringen, wie wenn es nur in Gedanken geschähe. (Musil, Vereinigungen)
1
Der Krankenwagen hält auf meinen Wunsch bei einem Briefkasten, und der asiatische Pfleger wirft den Brief an Elena ein. Als ich den Pfleger im Scheinwerferlicht beim Briefkasten sehe, befällt mich Angst. Ich begreife, daß ich mit diesem Fremden in mir, den ich nicht verstehe, allein bin. Die beiden Männer im Krankenwagen nehmen meinen Zustand nicht ernst, das zeigt die Tatsache, daß sie auf dem Weg ins Krankenhaus anhalten, um einen Brief abzuschicken. Kälte steigt in mir auf. Meine Brust ist wie Blei, und von weit weg fragt mich der Pfleger nach meinem Beruf. Bei dem Wort Beruf sehe ich einen gelben Nachen, auf dem ein Mann mit bewegungslosem Gesicht einen Fluß hinabtreibt. Und mir wird bewußt, daß ich eine ähnliche Szene in einem chinesischen Film sah. Ein Mann und eine Frau werden beim Ehebruch ertappt und mit gefesselten Gliedern nachts im großen See ertränkt. Das ganze Dorf steht mit brennenden Fackeln am Ufer und hört die Schreie der beiden. Ich sehe dieses Bild wohl wegen der asiatischen Gesichtszüge des Pflegers. Dieser wildfremde Asiate ist also der Mensch, der in der Todesnähe bei mir ist. Und dieser eine glaubt nicht an meinen Tod, das fühle ich. Der Asiate mustert mich von Kopf bis Fuß, mich, der frierend im Morgenmantel auf dem Krankensessel sitzt. Warum fahren sie nicht mit Blaulicht? Warum geht alles so langsam?
Der Asiate fragt noch einmal: Beluf? Weit weg höre ich eine schwache Stimme antworten: Schriftsteller. Mit einem Mal zieht sich der Raum zusammen. Ich, spüre, wie eng es im Krankenwagen ist, nur ein winziger Raum bleibt neben dem Tragbrett und dem Sessel, auf dem der Asiate sitzt. Ich starre auf den Zeiger des Sauerstoffgeräts. Er steht auf Null. Ich sehe über die Schulter des Fahrers nach vorn. Die roten Hecklichter der Wagen leuchten auf, zucken. Die Kolonne der Scheinwerfer. Wer sind die da draußen? Warum fahren die alle durch die Nacht? Ich starre in die Scheinwerfer, ohne zu verstehen. Dann höre ich lautes Dröhnen, Motorengeräusch, und ich begreife, daß ich im Krankenwagen bin.
Der Asiate sagt: Ich bin gekommen mit Schiff … von Vietnam … viele Wochen …, ich habe alles gesehen … Hunger … Seuche … Tod …
Ich sage wieder leise Ja, und der Asiate nickt.
Ich gebe meine Telefonnummer, sagt der Asiate, rufen Sie an …
Ich halte den Zettel in meiner eiskalten Hand, ohne die Nummer zu lesen. Meine Brust ist taub, und dieses Ziehen im linken Arm. Zwischen den Schulterblättern ein Stechen, das den Atem abschnürt. Die Kälte nimmt immer mehr von meinem Körper Besitz. Ich fühle meine Beine nicht mehr. Ich kann mich kaum noch auf dem Sessel halten. Wäre es nicht besser zu liegen, soviel besser? Aber ich habe nicht die Kraft aufzustehen, mich aufs Bett zu rollen. Der Asiate wird mir helfen. Der Asiate … Er ist mit dem Boot gekommen. Mit einem Nachen. Auf welchem Fluß? Welcher Fluß fließt nach Europa? Welcher Fluß? Ich werde den Asiaten fragen. Ja, ich werde ihn fragen. Ich sehe Schuhe, Hosenbeine. Ich versuche, den Kopf zu heben, aber ich kann es nicht. Ich versuche zu sprechen, ich kann es nicht. Das sind die Schuhe des Asiaten. Frag ihn, auf welchem Fluß er gekommen ist.
Das Geräusch des Motors steigt an, wird immer lauter, ich trete ein in diesen Motor. Ich sitze in Elenas Wagen, wir fahren die Bucht von Noto entlang. Elena lacht. Die Palmen im Wind. Es ist Dezember, die Bucht ist verlassen. Sollen wir auf einen Kaffee in Emilios Bar gehen? Elena, du lachst. Ich fühle deine Hand auf meinem Knie. Vergiß nicht, Alfio anzurufen. Vergiß es nicht. Er wartet darauf. Es hat geregnet, vor einer Stunde, und die Straße ist schon trocken. Wir könnten zur Fonte Ciane fahren. Man hört die Vögel, dort in den Johannisbrotbäumen sind sie. Hast du meinen Brief bekommen? Wirst du ihn Marc vorlesen? Ich vergaß, er ist noch unterwegs. Wann ich ihn abgeschickt habe? Erinnerst du dich an den Barkeeper von Catania? Ja, du erinnerst dich, du bist manchmal dort. Was ist das für eine Sirene? Es ist ein Krankenwagen. Aber eure Krankenwagen haben ein anderes Signal. Nein, ich kenne diese Sirene von früher. Seit ich klein war, kenne ich diese Sirene. Sie ist so laut. Und sie geht nicht weg. Der Asiate, er ist mit dem Boot gekommen. Elena, hörst du, mit dem Boot! Nimm meine Hand, Elena, rasch, nimm meine Hand. Es ist so kalt. Warum darf ich nicht liegen. So kalt. Kann nicht jemand das Fenster schließen. Werden wir ankommen. Werden wir denn jemals ankommen.
2
Das kahle Behandlungszimmer. Ich liege unter einem Monitor, im Rücken die kalte Scheibe des Defibrillators. Über mir das milchweiße Gesicht des Oberarztes. Daneben sein Assistent, im Hintergrund ein Pfleger. Die schöne junge Ärztin, die etwas von Jeanne d’Arc hat, sie hält meine Hand. Zum Schutz gegen den Tod verliebe ich mich in sie. Sie fangen damit an, mir über den linken Arm eine Sonde ins Herz zu führen. Als sie die Herzklappe passieren, ist mir, als drücke man mir von innen auf den Adamsapfel. Atmen ist keine Selbstverständlichkeit mehr. Während der Assistenzarzt meine Herzfrequenz mittels der Sonde beschleunigt und Störsignale, künstliche Extrasystolen einbaut, sagt der Oberarzt monoton Ganz ruhig ganz ruhig! und Tut nicht weh ganz ruhig ganz ruhig! Der Assistenzarzt ruft dem Oberarzt aufgeregt Zahlen zu, etwa so wie ein Flugingenieur seinem Kapitän beim Auftreten von Turbulenzen Meldung erstattet. Der Oberarzt nickt, und der Assistenzarzt erhöht meine Herzfrequenz. Die künstlichen Extrasystolen kommen jetzt in so rascher Folge und sind so stark, daß ich kaum noch Luft bekomme. Atmen! schreit der Pfleger aus dem Hintergrund, Atmen! und kommt näher. Jeanne d’Arc hält meine Hand und sieht mich mit ihren großen Augen an. Der Motor beschleunigt mein Herz auf noch höhere Frequenz, und die Stöße der Extrasystolen schnüren mir die Luft ab. Ich stammle Aufhören!, aber der Oberarzt bleibt bei seinem monotonen Sermon: Ganz ruhig es ist alles normal ganz ruhig wir haben alles im Griff ganz ruhig ganz ruhig! Mein Herz in immer schwindelerregenderen Höhen. Ich bin dabei, den Höhentod zu sterben, ringsum ist alles gelb. Weit unter mir höre ich jemanden rufen: Kammerflimmern!, dann bricht der Funkkontakt ab. Blitzschnell – nein, die Zeit spielt keine Rolle mehr, ist nur noch eine einzige lange Dehnung – sinke ich ab in ein trübgelbes Schlammreich. Langsam steigen sie mir da entgegen, die kahlen Schädel aus tausend Alpträumen, und Stimmen dehnen sich dunkelgefärbt. Es ist ein Ausflug wie unter Drogen, nur heißt diesmal die Droge Tod. In diesem zähen Fließen suche ich nach Halt, aber der trübgelbe Schlamm erdrückt mich, stopft mir den Mund. Mir? Ich verlasse mich selbst, bin nicht mehr dabei. Es riecht nach verbranntem Fleisch, und in der Ferne höre ich schreckliche Schreie. Die Schreie kommen näher und näher, und mit einem Ruck schieße ich nach oben, ins grelle Licht. Die Schreie dröhnen in meinen Ohren, brechen aus meinen Lungen, sind ich, nichts als ich, der Schrei, das Bündel Fleisch, mein Herz. Jeanne d’Arc hält meine Hand fest, und mir laufen die Tränen über die Wangen.
Der Oberarzt nickt, und man schiebt mich in mein Zimmer. Ich lebe, irgendwie, aufgebrochen wie eine Muschel, die man ausschlürfen kann. Weit weg liege ich am Ende der Todesmilchstraße und bin zu schwach, mich zu wundern. Als mir die Augen zufallen, denke ich: Elena.
Im Traum liegt ein grüner Schuppenpanzer auf der Erde. Darauf gibt es Erhebungen und Senken, und auf den Erhebungen sind Hütchen angebracht wie beim Hütchenspiel. Lüpfe ich eins der Hütchen, so steht alles in seinem Zeichen. Ich bewege mich so lange in seiner Ordnung, bis ich das nächste Hütchen lüpfe und nun dessen Ordnung gehorchen muß. Diese Ordnungen schmecken nicht nach Leben, sie schmecken nach gar nichts. Besteht das Leben aus Plastik, frage ich mich im Traum und bin ratlos über diese Frage. Nicht mehr nachdenken! beschließe ich und nehme mir vor, einen anderen Traum zu träumen. Ich fliege wieder einmal auf einer endlos langen Schaukel über eine Schlucht, als etwas über meine Hand streicht. Das ist kein Traum, spricht’s in mir, jemand streichelt dir die Hand. Mach die Augen auf! Du hast gut reden, du mit deiner zähen Ziehharmonika! Zähe Ziehharmonika? Ich schlage die Augen auf. Jeanne d’Arc steht neben meinem Bett und hält meine Hand. Geht es Ihnen besser, fragt sie und sieht mich mit ihren schönen blauen Augen an. Oh ja, will ich antworten, sehen Sie her, bin wieder ganz neu!
Aber schon das Wort Oh bleibt mir im Hals stecken, und langsam und gequält schleicht es über meine Lippen. Ich versuche es mit dem Wort Ja, ich versuche es mit den Worten Sehen Sie her, dann gebe ich es auf und lächle wenigstens. Aufgebrochen wie eine Muschel und ausgeschlürft. Die Heine Maschine meines Herzens wurde so lange beschleunigt und gefoltert, bis sie ausfiel. Meine Brust brennt wie frisch gehäutet. Und der Geruch, der Geruch von verbranntem Fleisch. Ich hebe das hinten gebundene Hemd an, drücke das Kinn an die Brust und sehe den kreisrunden roten Brandfleck. Jeanne d’Arc nimmt meine Hand und sagt: Wir haben Ihre Hand von der meinen losreißen müssen, als wir Sie schockten. Sie haben nicht loslassen wollen. Nein, möchte ich sagen, ich habe nicht loslassen wollen. Aber ich sage nichts. Jetzt dürfen Sie meine Hand halten, sagt Jeanne d’Arc.