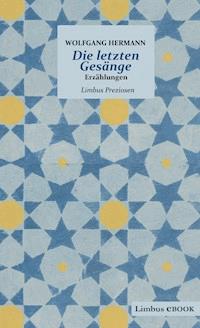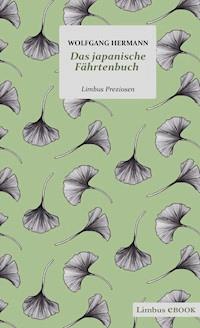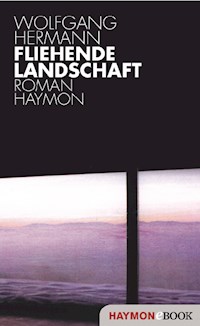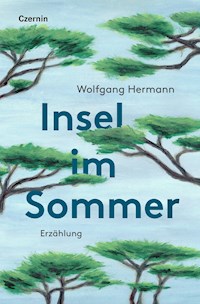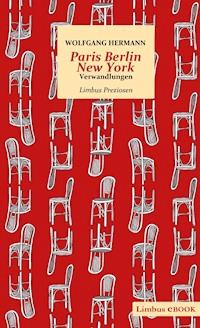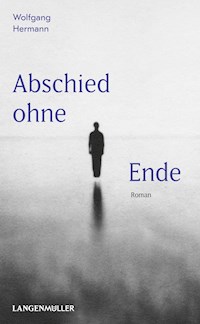
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Langen-Müller
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Morgen, kaltes Winterlicht. Ein Mann, alleinerziehender Vater, betritt das Zimmer seines 16-jährigen Sohnes und findet ihn tot im Bett liegend. Fassungslos irrt er fortan durch sein Leben, versucht die Ohnmacht und den Tod zu bewältigen. In seiner Erzählung spricht Wolfgang Hermann von der Wehmut, dem Schmerz und den Bemühungen, die gemeinsame Zeit erinnernd aus der Vergangenheit zu holen und im Jetzt spürbar werden zu lassen. Mit seiner filigranen, poetischen Erzählweise vermittelt der Autor Trost auch im Schrecken und lässt die Hoffnung aufleuchten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 82
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Wolfgang Hermann
Abschied ohne Ende
Ich danke Vera Blaha für wertvolle Hinweise.
© für die Originalausgabe und das E-Book: 2012, 2019 LangenMüller in der F.A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH Suttgart
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Sudio LZ, Stuttgart
Umschlagmotiv: Levitating Man, Wisconsin 1983,
von Ruth Thorne-Thomsen
Satz: Ina Hesse
E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering
ISBN 978-3-7844-3509-1
www.langen-mueller-verlag.de
Für Florian
Alle Erscheinungen der Wesen werden
dann als Brennstoff für das Feuer des
Bewusstseins betrachtet.
Sie werden befriedet, indem sie
im Licht wahren unterscheidenden
Erkennens verglühen.
NAGARJUNA
1
VOM GARTEN GING EIN EIGENES LICHT AUS, als leuchte jedes einzelne Blatt von innen. In den Baumkronen und Büschen öffneten sich Zwischenräume, die den Sommer über verborgen waren. Über allem lag ein Zögern, eine Langsamkeit, als wäre sich alles Leben seiner Schwäche bewusst. Wenn das Sommerlicht einmal gebrochen war, kehrte es nicht mehr zurück. Es erhöhte sich, stieg mehr und mehr auf, strahlte noch einmal in aller wie aus dem Hohen Norden kommenden Kraft, ehe es sich von der Erde zurückzog und dem Novembergrau Platz machte. Im Novemberlicht waren die Dinge stumpf, verloren ihre Konturen, bereiteten sich auf ein langes inneres Exil vor, das eine Zeitlang noch aus der Erinnerung an das Sommerlicht lebte.
Die Menschen hatten einen anderen Schritt, irgendwie wissender, vorsichtiger. Als wüssten ihre Körper mehr als sie.
Das schwindende Licht ließ auch das Leben in mir leiser werden. In den ersten Wochen, ehe ich mich an den heraufziehenden Winter gewöhnt hatte, ergriff mich Ratlosigkeit, ich wusste nicht, wohin mich wenden, was tun, um mich nicht selbst aus den Augen zu verlieren. Doch mit den grauschwarzen Novembertagen stieg auch etwas von der Kinderlust an den frühdunklen Winterabenden in mir auf.
Das war, bevor die Zeit starb. Es war wie das Fallen eines Blattes, nur dass weder das Blatt noch die Leere, in die es fiel, existierten.
Was in mir welkte, war mein Leben. Seit Fabius’ Tod hatte ich keinen tiefen Atemzug mehr getan. Die Tage waren ohne Licht, auch wenn irgendwo da draußen die Sonne scheinen mochte. Sie mochte scheinen, aber sie war von der Erde verschluckt.
Das Leben ist wie eine Flüssigkeit. Ohne Hoffnung stockt sie und verliert jedes Licht.
Eine große Dunkelheit legte sich um mich. Etwas Uraltes in mir wusste, dass mein Leben vorbei war, egal was ich auch sagte, um dieses Wissen zu entkräften.
Ich versuchte, an etwas zu denken, was nicht Dunkelheit war. Die Freuden des Lebens. Welches waren die Freuden des Lebens? Welchen Lebens?
Wir wussten nicht, was es bedeutet, wenn ein junger Mensch, eine junge Liebe, eine junge Hoffnung sterben muss. Wir ahnten den Krater nicht, den ein solcher Tod schlägt.
Das Leben ist eine Flüssigkeit. Man muss sie vorsichtig balancieren, denn wenn man sie verschüttet, versickert sie und ist fort.
Es war im letzten Winter. Ringsum war keine Wirklichkeit, ich ein leeres Gerippe, durch das der Wind pfiff. Jemand stellte Essen vor mich hin, hielt Anrufe von mir fern.
Ich hörte jemanden telefonieren. Die Lücken zwischen den Sätzen wurden größer. Jemand musste die Vorbereitungen für die Beerdigung treffen.
Überall im Haus brannten Kerzen. Die Spiegel waren verhüllt. Ich hätte meinen Anblick nicht ertragen. Nein: Ich hätte nicht verstanden, dass ich ich war. Anna saß an meiner Seite, wir starrten in die Flamme, aus der ich Fabius’ Gesicht erstehen sah. Er stieg vor mir auf, schwebte um mich als Wolke, nein: als ein Vibrieren. Er wusste vielleicht nicht, dass er tot war, zu schnell war alles gegangen, wortlos, unvorbereitet. Er war so jung gewesen, wie hätte er wissen sollen?
2
DIE ZEIT VERSCHWAND AN JENEM MORGEN. So still war es nie im Haus. Ich schlug die Augen auf und wusste es. Aber es konnte ja nicht sein, es durfte nicht sein. Es war doch nur eine Grippe. Es war nur Fieber. Daran stirbt ein junger Mensch nicht. Aber die Stille sagte es, es war die Stille, die nur die Anwesenheit des Todes bedeuten kann.
Ich stand vor Fabius’ halboffener Zimmertür und wagte nicht einzutreten. Ich sagte seinen Namen, doch meine Stimme war verdörrt. Ich berührte den Türrahmen, um mich zu vergewissern, dass ich noch hier war. Ich betrat das Zimmer und sah einen Fuß aus dem Bett hängen. Ich atmete nicht, als meine Hand diesen Fuß berührte. Er war wie aus Wachs. Meine Augen tasteten sich an der Bettdecke entlang höher. Meine Augen wollten dort nicht hin, sie wollten nicht sehen, was ins Hirn gebrannt war seit dem Augenblick des Erwachens. Aber Augen müssen ihren Dienst tun oder sie hören auf, Augen zu sein. Die Lider halb geschlossen, so sah Fabius mich an mit Augen so weit schon weg. Mich? Ich war nicht da, ich war nicht mehr. Ich war schon fortgerast hinauf mit einem grausamen Lichtstrahl, der mich aus den Schuhen nahm, hinauf in ein hohes atemloses ichloses Stockwerk. Es schrie mich weg vom Bett meines toten Fabius und hinauf ins Leere.
Es kann nicht sein, es ist nicht möglich, mein Leben lag vor mir mit toten Augen, mein Leben, mein Sohn, mein Fleisch und Blut, mein Leben, das mich überleben, in dem ich weiterleben hatte wollen, mein besseres Leben, mein kluger, mein lieber, mein von allen geliebter Sohn lag mit toten Augen. Ins helle Nichts fuhr ich hinauf, heraus aus diesem schwachen Körper, hinauf in höllenweißes ekelhaftes Nichts, das mich erstickte, ohne mich zu töten, das mich zu sich nahm, ohne mir das Mindeste zu lassen, nichts, nicht die Haut, die ich nicht mehr spürte, nicht meinen Körper, den ich verloren habe beim Blick in die toten Augen meines Sohnes.
Der Schrei, der ich war, war zu schwach, um zu bestehen, er erlosch, meine brennende Kehle hatte nicht die Kraft weiterzuschreien, nicht die Kraft, meinen Sohn zu mir zurückzuschreien. Es ist beschämend, so schwach zu sein, nicht die Kraft zu haben, irgendwo zu sein. Auch stehen konnte dieser Körper nicht mehr. Er sank in sich zusammen, krümmte sich. Es ist nicht wahr, das war es, was sich dieser Kehle entrang, es ist nicht wahr, bitte bitte bitte. Ja, er bat, dieser gekrümmte Körper, er bat, er flehte um Unwirklichkeit. Er krümmte sich neben dem Bett, in dem sein toter Sohn lag, und bat um Unwirklichkeit.
Die Oberfläche dieses Körpers war aufgelöst, verströmt ins Nirgendwo, von wo alles nun eindrang. Er krümmte sich, er winselte, er kroch zum Telefon und rief den Notarzt, was sagt er, er sagt: Mein Sohn ist tot. Er nannte den Namen der Straße, die Hausnummer, er nannte seinen Namen, etwas sagte seinen Namen, etwas nannte die Daten. Er rief Christian an und weinte ins Telefon, der versprach, sofort zu kommen. Er hockte neben dem Telefon, das Telefon war rot, der Flur war grau, seine Hand grau, es war Jetzt und das Jetzt war tot.
Blaues Licht zuckte im Nebel. Das Andreashorn kam näher, war in allen Räumen. Die Klingel. Der Notarzt mit zwei Sanitätern. Wo ist Ihr Sohn, fragte jemand. Jemand hörte und zeigte ins Zimmer. Sie standen an Fabius’ Bett. Der Notarzt berührte seine Hand.
Was hat Ihr Sohn zuletzt gegessen? Was haben Sie ihm gegeben? Hat Ihr Sohn Drogen genommen? Wann haben Sie ihn gefunden?
Seltsam, Worte waren Pfeile, Lichter im Raum, geschossen aus einem Mund. Worte waren Pfeile, Ohren waren Trichter. Worte, an jemanden gerichtet. Jemand war nicht da. Jemand saß auf dem Boden und zitterte. War es in der Welt je warm gewesen? Nebel lag um das Haus, dieser Nebel brachte den Tod. Wer hat den Nebel aus dem Sack gelassen? War dieser Tag wirklich angebrochen? War er nicht eine nie endende Nacht?
Sie sagten Worte. Es waren Fragen. Sie trugen rote Jacken. Einer schüttelte jemandes Schulter.
Was haben Sie Ihrem Sohn gegeben?
Was hatte jemand seinem Sohn gegeben? Essen, es war Essen gewesen.
Wann haben Sie zuletzt mit ihm gesprochen?
Bin ich ein Ich, ein Sie? Ich bin jemand, sie sagen es. Sie meinen jemanden. Sie schicken Pfeilworte zu mir.
Ja, ich habe mit meinem Sohn gesprochen. Bevor ich mit dem weißen Licht durch die Decke schoss. Ich bin da oben irgendwo an der Decke, mehr weiß ich nicht. Ja, ich habe ihm zu essen gegeben. Mehr weiß ich nicht. Da oben ist alles weiß. Seltsam, wo doch der Tag so dunkel ist. Wo doch der Nebel das Haus erdrückt.
Ich unterschreibe ein Stück Papier. Der Arzt telefoniert. Die Männer gehen. Ich bin allein mit der Totenstille. Fabius liegt noch immer in seinem Bett. Ich schaue durch die Tür, ich sehe sein wächsernes Gesicht, nein, zurück, ich sehe nichts, ich sehe nichts nichts nichts.
Die Türklingel. Christian umarmt mich weinend. Ich verstehe nicht, dass ich einen Körper habe.
Später läutet es noch einmal an der Tür. Zwei Männer tragen einen grauen Metallsarg in mein Haus. Sie tragen ihn in Fabius’ Zimmer. Es kann nicht sein. Ich darf es nicht sehen. Christian führt mich zum Sofa. Er spricht mit den Männern. Ich höre, wie sie den Metallsarg am Boden absetzen. Jetzt öffnen sie ihn. Stille. Sie heben meinen Sohn in den Sarg. Sie schließen ihn. Gemurmel. Christian öffnet die Tür. Sie tragen meinen Sohn aus dem Haus. Eine Autotür schlägt. Ein Motor startet mitten im Nebel. Christian sitzt neben mir. Wir treten nicht ans Fenster, als die Männer davonfahren.
3
ES WAREN TAGE OHNE LICHT. Die Luft war keine Luft, es gab keinen Atem, der den gefrorenen Stein in mir in Bewegung bringen konnte. Das Licht war ein Schleier über den Dingen, der alles, was sich noch regte, erstickte. Stille, die das Innere jeder Regung, jeden Schritts auf dem Flur erstickte.
Und doch: Ich war nicht allein. Sie waren gekommen. Christian, den ich anrief in der Minute, die nicht mehr vergehen mochte, in der Minute, da ich die toten Augen meines Sohnes sah. Christian war gekommen und hat mich umarmt, mit mir geweint.