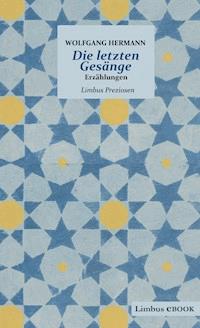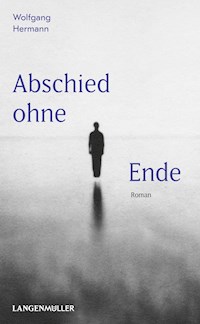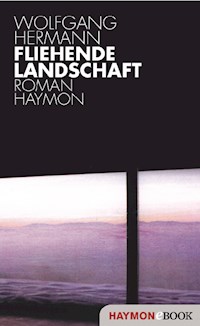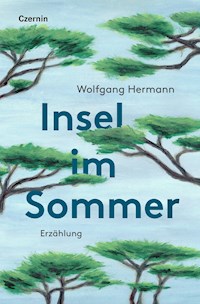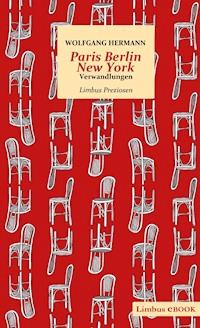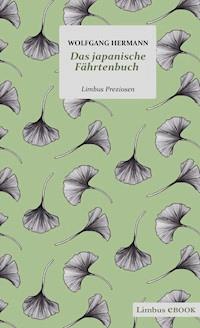
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Limbus Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Tokyo: Labyrinth aus Zeichen und Masken. Wolfgang Hermanns Aufzeichnungen aus der japanischen Hauptstadt tasten sich von Augenblick zu Augenblick, vorbei an blinden Spiegeln, und geben nicht vor, Bescheid zu wissen, sie bleiben im Staunen und Warten. Die Spannung im Nicht-Verstehen auszuhalten, sie mit Sprache zu erfüllen, in Neugierde und Faszination zu verharren – das alles steht hinter diesem Text, der in seiner offenen Form an Hermanns Paris Berlin New York anschließt. Wolfgang Hermann lehrte als Lektor an einer Tokyoter Privat-universität, widmete sich in seiner Freizeit dem japanischen Bogenschießen (Kyudo) und streifte durch die Stadt. Das japanische Fährtenbuch erschien erstmals 2003 als Jahresgabe des Franz-Michael-Felder-Vereins, war rasch vergriffen und wird hier in erweiterter Form dem Lesepublikum neu zugänglich gemacht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 71
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Wolfgang Hermann
Das japanische
Fährtenbuch
Roman
Mit gesenktem, starrem Blick erklärt der Grenzbeamte am Flughafen, meine Aufenthaltsbewilligung sei abgelaufen. Er erhebt sich und weist mir einen Warteraum zu. Jetzt zeigt sich, dass der Mann keine hundertsechzig Zentimeter groß ist.
Mit mir warten acht Bangladeshi auf ihre Einreiseerlaubnis. Zwei Frauen, eine davon in vorgerücktem Alter, ein rundlicher Mann in Mönchstracht, und fünf weitere Männer. Sie wollen zwölf Tage in Japan bleiben, und dafür müssen sie zwölf mal zwölf Minuten warten. Sie warten ergeben, geduldig, als wären sie an solche Stunden unterm Neonlicht gewöhnt.
Als ich nach zwei Stunden an die Tür des Grenzbeamten klopfe und frage, was geschehen soll, versteifen sich seine Arme, mit der Stimme eines Automaten weist er mich zurück auf meinen Platz.
Eine halbe Stunde später hat er mit meinem Arbeitgeber gesprochen. Mit weicherem Arm deutet er auf den Sessel vor seinem Schreibtisch. Er legt Papier um Papier vor, das ich auszufüllen habe. Gesuche an das Justizministerium, mich im Lande Japan zu dulden. Meine Universität hat ihm inzwischen meinen Arbeitsvertrag und andere Beglaubigungen gefaxt. In der Stimme des Grenzbeamten gibt es jetzt ein Modul, das deren metallische Schärfe abschwächt. Sein Blick ist – bei seinem Beruf landesüblich – noch immer starr gesenkt.
Wieder muss ich ins Wartezimmer. Irgendwann – nach meiner Uhr ist es fünf Uhr morgens – weist er mir den Weg nach draußen, wo mein Koffer auf mich wartet. Freundlich? Nein, grußlos mit den Augen auf seinen Schuhspitzen.
Als er das Flughafengebäude verließ, stand die feuchte Hitze wie eine Mauer vor ihm. Sein Arm, der die Reisetasche trug, hing wie ein Fremdkörper herab. Seine Augen waren zu schmalen Sehschlitzen verkleinert. Jeder Kontinent, ja jedes Land hatte sein eigenes Licht. Das Licht dieses Landes kannte er nicht. Ein eigener Schimmer umgab die Dinge hier, wie auf leicht überbelichteten Fotografien der Fünfzigerjahre. Ein Taxifahrer gestikulierte heftig, bedeutete ihm, in seinen Wagen zu steigen. Ein zweiter, ein dritter Taxifahrer machten durch Zischlaute auf sich aufmerksam. Er stieg in den Wagen dessen, der zumindest nicht mit Zungenlauten wie um ein exotisches Tier geworben hatte. Noch bevor er ein Wort gesagt hatte, fuhr der Fahrer los. Er würde ohnehin wissen, dass er in die Stadt wollte. Er überließ es dem Fahrer, das erste Wort zu sagen. Doch der schwieg. Im Wagen war es schneidend kalt. Ihm fielen die weißen Handschuhe des Fahrers auf. Ob er sie trug, um sich vor dem Schmutz des Fahrzeugs, oder um dieses vor seinem Handschweiß zu schützen? In seinem Kopf hörte er eine lange nicht mehr gehörte engelsgleiche Stimme, diesen Song hatte er seit Jahren vergessen. Es war wohl wegen der weißen Handschuhe, die etwas Prinzessinnenhaftes hatten und nicht zu dem Bild passten, das er sich von Taxifahrern gemacht hatte.
Das dumpfe Klopfen der einzelnen Betonstücke, über die der Wagen fuhr, bildete einen eigenen Rhythmus, nach dem er sich hob und senkte. Von der Höhe der Stelzenautobahn sah er weit übers Land, wo sich endlose Reisfelder dehnten, auf denen er Bauern mit schirmartigen Sonnenhüten sah, die hinter ihren Ochsengespannen hergingen. Einen Atemzug später fiel sein Blick auf ein Raffineriegelände, wo über einem Wald von Schornsteinen graue Rauchwolken standen. Die uniformen Fassaden der Wohnburgen der Vorstädte nahmen kein Ende. Im gelben Atem flimmerten die Wellblechdächer der Armenhütten bis an den Horizont. Er fühlte den Schleier der Müdigkeit, der ihn vor der Überschärfe der Bilder schützte.
Auf den Gehsteigen Skulpturen aus Menschen. In jedem Augenblick wechseln sie ihre Form. Sie bestehen aus Menschenflüssigkeit.
Am Ausgang des Supermarkts überreicht ein Mann mit Dreiecksmütze jedem, der den Supermarkt verlässt, ein Häppchen auf einem Zahnstocher. Dabei verbeugt er sich und verschwindet hinter seiner Dreiecksmütze.
Und der Verkehrspolizist an der Ampel nachmittags um fünf? Mit seinem Leuchtstab fuchtelt er, mit seiner Trillerpfeife trillert er. Und ein blinkender Lastzug sagt höflich: „Ich biege jetzt ab, bitte sehr.“
Erblickt mich Herr Fujita, mein Hausmeister, mit Gepäck oder Einkauf, springt er herbei, öffnet den Lift, in den er sich beugt, um den Knopf für mein Stockwerk zu drücken, hält die Türe auf, während er sich tief vor mir verbeugt. Ich trete in den Aufzug, und während sich die Türe schließt, dreht er sich nicht etwa um und geht seiner Wege und zieht eine Grimasse, nein, er verharrt in der Verbeugung und zieht seine Grimasse erst, wenn er vor Blicken sicher ist.
In den Bäumen in der Allee von Harajuku sitzen unzählige Zikaden, ihr Sermon steht, nein: vibriert, nein: fließt, nein: stockt zwischen den Fassaden, in deren Fenstern Schemen von Menschen defilieren. Es ist sieben Uhr freitagabends, und in der BrasserieAux Bacchanalesbereitet sich alles vor auf eine lange Tokyoter Nacht. Ehe ichs vergesse: Die junge Japanerin am Nebentisch macht mit flinker Hand Notizen auf ein langes Faxpapier, auf dem Grundrisse von Wohnungen zu sehen sind. Dann, auf einem anderen Papier, macht sie Kreise um Abbildungen von Möbeln. Schließlich blättert sie in einem Geschirr-Katalog.
Einen Häuserblock weiter höre ich noch immer das Zirpen der Zikaden, wenn die Ampel auf Rot steht. Halbmond. Gebimmel der Mobiltelefone in der Menge. Der Mann mit dem ungeschützten Kopf taucht auf aus dem Nichts, fasst mich kurz ins Auge und wird von einer unsichtbaren Keule hart von hinten getroffen. Sein Kopf schnellt nach vorn (sein Mund stößt dabei einen Schnalzlaut aus), er schlägt sich mit flacher Hand gegen die Stirn und geht unbeirrt weiter. Sein Blick zerbröselt irgendwo am Wegrand. Später, auf einer anderen Straße, treffe ich ihn wieder, und wieder trifft ihn die unsichtbare Keule.
Früher begab sich der Fürst verkleidet in die Kaschemmen, neugierig auf die Stimmung im Volk. Heute verkleiden sich Frau und Herr Niemand und suchen in der Maske nach dem Fürsten. Für eine Nacht.
Land der Verkleidungen. Land der Masken. Land des Geschlechtertauschs.
Im Bus steht ein Idiot, legt seine Hand auf die Hand einer Mutter mit Kind. Die Frau lächelt unsicher. Der Idiot legt seine Hand auf ihr Knie. Sie nimmt sie höflich von dort weg. Wieder drückt er ihre Hand. Das Lächeln der Frau mit Kind wird gequälter. Erst als seine Mutter, die schon am Ausgang steht, den Bus verlässt, lässt er von der Frau ab. Dort auf dem Gehsteig wankt er hinter seiner Mutter davon.
An meinem ersten Tag in Tokyo hörte ich rhythmisches Rufen, dann sah ich eine Karawane von schwarzgekleideten Frauen und Männern im Laufschritt. Der Erste hielt ein Banner mit Kanji hoch, deren Bedeutung ich nicht verstand. Hinten folgten Frauen und Männer, die Flugblätter verteilten. Auch mir drückte einer eines in die Hand. Eine Minute später hörte ich das Rufen der Truppe aus der Ferne. Später fragte ich jemanden nach dem Text des Flugblatts. Ich erfuhr, dass es von der Aum-Shinrikyo-Sekte kam, die wenige Tage davor bei einem Giftgasanschlag auf die U-Bahn Menschen getötet hatte.
Die kleinen Zwischenfälle beim Verbeugen. So verbeugen sich zwei Frauen auf dem Gehsteig voreinander, tiefer und tiefer, und beim Wiederaufrichten nimmt sie beinahe ein Fahrradfahrer mit, dessen Rad eine Schlangenlinie beschreibt. Das ereignet sich stündlich an allen Straßenecken.
Als ich eine zu große Münze auf das Laufband des Münzautomaten im Bus werfe, bespricht der Fahrer das Laufband und mich, den Unkundigen. Außerdem, sagt er, bin ich im falschen Bus. Gewöhnlich weiß ich, welche Münze ich im Bus einzuwerfen habe. Aber ich bin müde von der langen Reise, hungrig, und ich komme vom Bogenschießen. Der Fahrer klärt mich noch einmal über meinen Fehler auf. Da ich aber nicht verstehe, klärt er den Nächstbesten über meinen Fehler auf. Der nickt verständnisvoll, aber auch er hat kein Wechselgeld. Als er den Bus verlässt, entschuldigt sich der Fahrer. Wofür? Er hat den Fahrgast in sein Problem mit mir, dem Ausländer, eingeweiht. Eine Belastung also.
An der Endstation gibt er mir Zeichen sitzenzubleiben. Ich fahre mit ins Depot. Dort erklärt er im Kabuff seinem Vorgesetzten meinen Fall. Er kommt mit meinem erhöhten Fahrgeld und drückt es mir in die Hand. Er verschwindet in seinem Bus, den er parkt. Einer der Männer mit den rotblinkenden Leuchtstangen führt mich zur Bushaltestelle, deutet fuchtelnd auf genau die Stelle, an der ich am besten stehen soll. Schließlich kommt der Busfahrer zurück, zeigt mir, welchen Bus ich nehmen kann. Als ein Bus hält, gibt mein Begleiter aufgeregt Zeichen, und ich steige ein.
Auf dem flachen Hausdach gegenüber steht ein Käfig, in dem ein Mann am Wochenende Golf spielt. Er schlägt den Ball so hart, als gelte es, eine Distanz von hundert Metern zu überwinden.