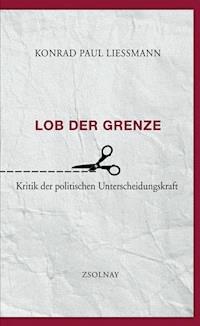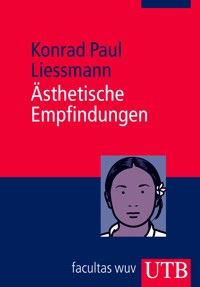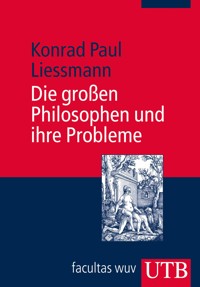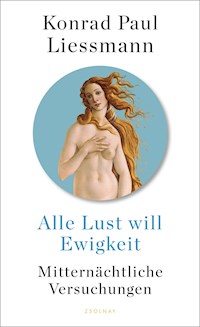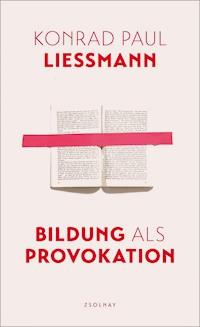
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Paul Zsolnay Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Alle reden von Bildung. Sie wurde zu einer säkularen Heilslehre für die Lösung aller Probleme – von der Bekämpfung der Armut bis zur Integration von Migranten, vom Klimawandel bis zum Kampf gegen den Terror. Während aber „Bildung“ als Schlagwort in unserer Gesellschaft omnipräsent geworden ist, ist der Gebildete, ja jeder ernsthafte Bildungsanspruch zur Provokation geworden. Die Gründe dafür nennt Konrad Paul Liessmann in seinem neuen Buch. Dafür begibt er sich sowohl in die Niederungen der Parteienlandschaft als auch in die Untiefen der sozialen Netzwerke, er denkt über den moralischen Diskurs des Zeitgeists nach und darüber, warum es so unangenehm ist, gebildeten Menschen zu begegnen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 260
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alle reden von Bildung. Sie wurde zu einer säkularen Heilslehre, von der wir uns die Lösung aller Probleme versprechen – von der Bekämpfung der Armut bis zur Integration von Migranten, vom Klimawandel bis zum Kampf gegen den Terror. Während aber »Bildung« als Schlagwort omnipräsent geworden ist, ist der Gebildete, das eigentliche Ziel all dieser Bildungsanstrengungen, nicht nur aus dem Wortschatz verschwunden, nein, jeder ernsthafte Bildungsanspruch ist zur Provokation geworden. Die Gründe dafür nennt Konrad Paul Liessmann in diesem Buch. Dafür begibt er sich sowohl in die Niederungen der Parteienlandschaft als auch in die Untiefen der sozialen Netzwerke, er denkt über den moralischen Diskurs des Zeitgeists nach und darüber, warum es so unangenehm ist, gebildeten Menschen zu begegnen.
Zsolnay E-Book
Konrad Paul Liessmann
BILDUNG ALS PROVOKATION
Paul Zsolnay Verlag
INHALT
Vorwort. Warum es so unangenehm ist, gebildeten Menschen zu begegnen
ZUR SACHE DER BILDUNG
Belesenheit. Literarische Bildung als Provokation
Das schlechte Gewissen. Über Muße und Bildung
Und erlöse uns von dem Übel. Bildung als säkularisierte Religion
Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen. Über den Widerspruch von Bildung und Wettbewerb
Professionalisierung des Lehrberufs? Anmerkungen zu einem Verhängnis
Veränderung durch Bildung? Über eine rhetorische Figur
Am Rand der Kultur
Europa als eine schöne Kunst betrachtet. Zur Ästhetik eines Kontinents
Nichts Neues unter der Sonne. Über innovative und andere Innovationen
Erkenne dein Selfie! Das Selbstporträt im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit
Tausend Hände. Über Fingerfertigkeiten aller Art
Wissenschaft ist keine Kunst! Eine Grenzziehung
Was von uns übrig bleibt. Über den Wert des Abfalls
In den Niederungen der Politik
Revolution und Grausamkeit. Zur Dynamik gesellschaftlicher Veränderungen
Die Zukunft der sozialen Demokratie. Ein Plädoyer für die Rückkehr der Politik in die Politik
Der Bürger und seine Partei. Über Freiheit, Leistung und Verantwortung
Unsere Grenzen. Zwischen hier und dort
Was heißt denken? Über Intellektuelle in dürftiger Zeit
Es ist so bequem, unmündig zu sein! Brauchen wir eine neue Aufklärung?
Anmerkungen
Drucknachweise
VORWORT
Warum es so unangenehm ist, gebildeten Menschen zu begegnen
Wer den aktuellen Bildungsdiskurs verfolgt, kann eine interessante Beobachtung machen. Die Karriere des Begriffs »Bildung« ist atemberaubend. »Bildung« ersetzt mittlerweile nicht nur Konzepte wie Pädagogik, Erziehung oder Unterricht, »Bildung« beschreibt nicht nur den Umgang mit Menschen von der Beschallung des Ungeborenen im Mutterleib über die Integration von Migranten bis zur Einweisung von Senioren in den Gebrauch des Internets, sondern »Bildung« kann mittlerweile als wohlfeiler Joker überall dort eingesetzt werden, wo andere Institutionen oder Praktiken versagen. Wer Bildung sagt, hat immer recht.
Während »Bildung« als universelles Problemlösungsversprechen omnipräsent geworden ist, ist der Gebildete, den wir ja eigentlich als Ziel all dieser Bildungsanstrengungen vermuten müssten, aus dem Wortschatz nahezu verschwunden. Nicht einmal mehr am Horizont der Bildungsplanung und der Bildungsbiografien, die nun untersucht und beschrieben werden, taucht der Gebildete auf, und wir wüssten auch nicht, an welcher Stelle der offiziellen Bildungskarrieren er in Erscheinung treten sollte. Die Absolvierung der Schulpflicht, eine moderne kompetenzorientierte Reifeprüfung, ein abgeschlossenes Bachelorstudium nach dem Bologna-Modell – nichts davon enthält den Gebildeten als Ziel- oder Leitvorstellung. Weder sollen sich Menschen bilden, noch sollen sie gebildet werden, gefordert ist heute der Erwerb von »Kompetenzen« wie Teamfähigkeit, Kommunikationsbereitschaft, Innovationsfreude und digitale Fitness.
Niemand wird bezweifeln, dass sich Menschen für unterschiedliche Tätigkeiten qualifizieren, dass sie vielfältige Fähigkeiten aufweisen und dass sie die aktuellen Kulturtechniken beherrschen sollen. Aber keine dieser Beschreibungen erfasst das, was man einmal mit Bildung gemeint hatte. Gesetzt den Fall, dass uns der in einem klassischen Sinne Gebildete tatsächlich noch einmal begegnete, wären wir wahrscheinlich ziemlich irritiert. Der Gebildete verkörperte all das, was der aktuelle Bildungsdiskurs gerade nicht mehr unter Bildung verstehen will. Dazu gehörten ein fundiertes Wissen, das es erlaubt, auch ohne Zensurbehörde die Fakten von den Fiktionen zu trennen, ästhetische und literarische Kenntnisse und Erfahrungen, ein differenziertes historisches und sprachliches Bewusstsein, ein kritisches Verhältnis zu sich selbst, eine auf all dem gründende abwägende Urteilskraft und eine gesteigerte Sensibilität gegenüber den Lügen, Übertreibungen, Hypes, Phrasen, Moralisierungen und Plattitüden der Gegenwart. Allerdings ließe sich nichts von dem vorschnell der Forderung nach Nützlichkeit, Anwendbarkeit und schneller Verwertbarkeit unterordnen.
Der Gebildete wäre heute eine eigentümliche Erscheinung – wie aus der Zeit gefallen. Weltfremd wäre der Gebildete aber nicht. Bildung stellte auch eine Form der Welthaltigkeit dar, die sich jedoch nicht nur aus den Blasen der sozialen Netzwerke, sondern auch aus anderen Quellen speist, zu denen nicht zuletzt jene Bücher gehören, deren Lektüre wir niemandem mehr zumuten wollen. Begegnete man solch einem Menschen, wir wären wahrscheinlich unangenehm berührt, vielleicht von Neid erfüllt, unter Umständen sogar ein wenig beschämt, weil er unser aktuelles Bildungsweltbild in Frage stellte.
Bildung, ernst gemeint, wäre heute eine Provokation. Ob die grassierende Kompetenzorientierungskompetenz wirklich die zeitgemäße Antwort auf diese Provokation darstellt, darf allerdings bezweifelt werden. Bildung, das macht ihren Stachel aus, lässt sich nicht auf formale Fähigkeiten und Anwendungsorientierungen reduzieren. Bildung hat immer auch mit konkreten Inhalten und – horribile dictu – abstraktem Wissen zu tun, damit auch mit Einsichten und Haltungen, die ihren Wert vorab in sich tragen und es den Menschen erlauben, zu sich und der Welt in einer Weise Stellung zu beziehen, die nicht nur dem Diktat der Zeit und ihrer Moden gehorcht.
Bei aller Kritik an den bildungsfeindlichen Bildungsreformen unserer Tage gibt es keinen Grund zu verzweifeln. Gerade die Schnelllebigkeit und Beliebigkeit der aktuellen Medienkultur lässt die Sehnsucht nach fundiertem Wissen, kritischer Reflexion, nach Begegnungen mit der eigenen Tradition und mit fremden Kulturen und nach einer geschärften Urteilskraft wachsen. Bildung hat auch mit dem Einüben einer Gelassenheit zu tun, die sich von überbordender Affirmation des Zeitgeistes ebenso frei halten möchte wie von einer wohlfeilen Empörung über medial hochgespielte Nichtigkeiten.
Bildung ist untrennbar mit der Einsicht in die eigene Unzulänglichkeit verbunden, mit dem Wissen des Nichtwissens. Diese Bescheidenheit macht sie erst zu jener Aufgabe und Haltung, die sich offen dem Anderen und seinen vielfältigen Erscheinungsformen zuwenden kann: ohne falsche und überzogene Ansprüche, aber auch ohne den Gestus einer moralischen oder intellektuellen Überlegenheit und ohne den Dünkel eines selbstgefälligen Elitenbewusstseins, das mittlerweile selbst zu einem Signum der Unbildung geworden ist.
Wien, im Mai 2017
Konrad Paul Liessmann
ZUR SACHE DER BILDUNG
BELESENHEIT
Literarische Bildung als Provokation
Anfang des Jahres 2015 sorgte die Twitter-Nachricht einer Gymnasiastin in Deutschland bundesweit für Aufregung, sogar die Bundesbildungsministerin Johanna Wanka sah sich zu einer zustimmenden Stellungnahme genötigt. Was hatte die junge Frau unter dem Decknamen Naina geschrieben: »Ich bin fast 18 und hab keine Ahnung von Steuern, Miete oder Versicherungen. Aber ich kann ’ne Gedichtsanalyse schreiben. In 4 Sprachen.«1 Die Debatten über die Sinnhaftigkeit klassischer und humanistischer Bildung angesichts der Notwendigkeiten des Lebens in einer modernen Gesellschaft flackern seitdem immer wieder auf. Dass an Schulen nicht das gelernt wird, was man zum Leben so braucht, ist allerdings ein Vorwurf, der pädagogische Einrichtungen seit der Antike begleitet. Nur lernen, was man auch sofort anwenden kann? Nur lernen, was nützt? Nur lernen, was der eigenen Situation und Bedürfnislage entspricht? Ist es das, was wir unter Bildung verstehen wollen? Und liegt das Problem nicht darin, dass Bildung ohnehin seit langem eher an den Erfordernissen der Märkte und den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen als an vermeintlich antiquierten Inhalten und angeblich unbrauchbaren Kenntnissen gemessen wird? Trug Naina mit ihrem Tweet nicht Eulen nach Athen? (Hoffentlich kennt sie diese Wendung und ihre Geschichte noch.)
Nutzloses Wissen. Ja, dieses kennzeichnet den Gebildeten, und dieses ist von Übel. Dass Schüler Gedichte interpretieren können, aber beim Ausfüllen der Steuererklärung versagen – das ist offenbar der Albtraum jeder modernen Bildungsministerin. In der Schule darf es deshalb keine kontextfreien Wissensfragen mehr geben, »Faktenwissen« ist zu einem – übrigens verräterischen – Unwort geworden, so, als sollten lieber Meinungen und Ideologien vermittelt werden. Situations- und intentionsadäquat müssen etwa die kompetenzorientierten Fragestellungen der Reifeprüfung sein, Kenntnisse, die nicht zur Lösung eines Problems beitragen, gelten als unangemessen und verzichtbar. Dass solch eine Entwertung des Wissens in einem Zusammenhang steht mit dem seit einiger Zeit gerne beklagten postfaktischen Zeitalter, fällt denjenigen, die bislang alles für eine soziale Konstruktion hielten und nun die empirische Wahrheit neu für sich entdecken, gar nicht mehr auf.
Aber auch kulturelle und ästhetische Traditionen dürfen nicht mehr gelehrt werden; jeder Kanon steht im Verdacht, die postulierte Gleichwertigkeit aller kulturellen Erzeugnisse in Frage zu stellen, die Lust an alten Sprachen und an der Schönheit der Mathematik wird durch Praxisorientierung gehörig sabotiert, und die Lektüre von Texten, die nicht dem Erwerb problemlösungsorientierter Kompetenzen untergeordnet werden können, ist verpönt.
Literarische Bildung, die einst im Zentrum der Curricula der höheren Schulen stand, ist – nicht nur dort – zu einem Fremdwort geworden. Dass aber nahezu jede Form vor allem ästhetischer, literarischer oder sprachlich-historischer Kenntnisse gerne als bildungsbürgerlich denunziert wird, gilt nicht nur der Kritik an einem sozialen Habitus, sondern auch einer bestimmten Idee von Bildung. Sofern sich diese – wenn auch nicht ausschließlich, so doch zentral – an kanonischen literarischen Texten orientierte, gilt sie als obsolet. Die schöne Literatur, wie avanciert auch immer, führt nur noch ein Schattendasein in den Curricula, in den Bildungsdiskursen, in denen es von Kompetenzen nur so wimmelt, spielt sie keine Rolle mehr.
Die Fraglichkeit literarischer Bildung im klassischen Sinn hatte allerdings schon die Debatten im Zuge der Lehrplanreformen der sechziger Jahre des vorigen Jahrhunderts bestimmt. Die Eliminierung der alten Sprachen aus den Curricula der Gymnasien wurde etwa damit begründet, dass diese zwar eine Quelle individueller Bereicherung sein können, dass daraus aber keine allgemeine bildungspolitische Funktion mehr abgeleitet werden kann: »Wer wollte bestreiten, daß das Studium der geistigen Quellen der Antike ebenso wie das ihrer sprachlichen Grundstrukturen lohnend und beglückend sein kann? Dies gilt nicht nur für den Gelehrten, sondern für einen jeden, der hier Inspiration zu suchen vermag. Eine zentrale Position im Curriculum der allgemeinbildenden Schule ist für diese Welt damit nicht nachgewiesen.«2 Was der Lehrplanreformer Saul B. Robinsohn hier in Hinblick auf Altgriechisch und Latein behauptet hatte, lässt sich mittlerweile für den Umgang mit Literatur überhaupt sagen. Fast niemand bestreitet, dass diese für denjenigen, der in ihr eine Inspiration zu sehen vermag, eine beglückende Erfahrung sein kann. Aber eine allgemeine und verbindliche Bedeutung wagt daraus schon lange kein Bildungsexperte mehr zu folgern. Und das hat weniger damit zu tun, dass der einstige Kanon längst mehrfach demontiert und fragwürdig geworden ist, sondern mit der neuen kompetenzorientierten Lernkultur, die prinzipiell die Auseinandersetzung mit Werken der Kunst und Literatur als ausreichende Zielvorstellung nicht mehr kennen darf.
Kompetenz zielt immer auf ein Können, eine Anwendung, die Lösung eines Problems. Was immer dazu auch eingesetzt wird, an welchen Inhalten dieses Können erworben wird – alles wird in Bezug auf dieses Können notwendigerweise als Mittel zu interpretieren sein, das durch andere, ähnlich funktionale Mittel auch substituiert werden kann. Die literaturbezogenen Kompetenzen des Deutschunterrichts etwa wie Textverständnis, Analysefähigkeiten, historisch-systematische Kontextualisierungen, Vergleich unterschiedlicher Schreibstrategien erscheinen als Ziele und Praktiken, die im Umgang mit mehr oder weniger beliebigen Texten erreicht und geübt werden können, und nicht als methodisches Rüstzeug, um jene Texte, die wir für unverzichtbar halten, zu lesen und zu verstehen. Die Frage, welche Bedeutung unter diesen Bedingungen eine literarische Bildung überhaupt noch spielen kann, stellt sich damit in verschärfter Weise.
Literarische Bildung war immer schon umstritten. Die Reduktion auf eine Literaturgeschichte, die sich damit begnügte, Epochen zu konstruieren und ihnen Autoren und Werke beizuordnen, vermochte ebenso wenig zu befriedigen wie das Lernen der Inhaltsangaben, wie sie sich in diversen Literaturlexika fanden. Andererseits war der literarisch versierte Mensch nicht nur einer, der in einem bestimmten Segment kultureller Produktion exzellente Kenntnisse aufwies, sondern er galt auch in einem exemplarischen Sinn als gebildet. Belesenheit war einmal nahezu ein Synonym für einen avancierten Bildungsanspruch, und dieser wiederum forderte geradezu ein Nahverhältnis zu ganz bestimmten Büchern und Texten. Belesenheit erschöpfte sich gerade nicht in einer wie immer ausgereiften und artikulierten Texterschließungskompetenz, sondern verblüffte immer wieder damit, was alles gelesen worden war.
Belesenheit war und ist deshalb eine Provokation. Sie verweist auf ein Privileg: dass es Menschen gibt, die die Zeit haben, sich intensiv mit literarischen Texten zu beschäftigen, ohne dass sie dadurch im Alltag oder in ihrem beruflichen Umfeld wesentlich gewönnen. Den Fall des Literaturwissenschaftlers, der Lesen zu seiner Profession gemacht hat, wollen wir dabei einmal ausklammern. Jenseits der wissenschaftlichen Beschäftigung mit Literatur aber besteht die Herausforderung der Belesenheit auch im Anspruch einer bestimmten Quantität. Nach der Lektüre von fünf Romanen und drei Kurzgeschichten ist noch niemand belesen. Natürlich wäre es müßig, darüber zu streiten, ab welcher Anzahl gelesener Bücher jemand als belesen gelten könnte, aber dass es nicht nur einige sind, steht ebenso fest wie die stillschweigende Annahme, dass es nicht beliebige, sondern bestimmte Texte sein müssen. Auch wer alle Romane von Karl May oder Joanne K. Rowling gelesen hat, wird nicht als belesen gelten, auch wenn Belesenheit die Lektüre dieser Autoren nicht ausschließt. Wer es versteht, Winnetou mit Hegel zu verbinden oder Harry Potter mit Martin Heidegger in eine kritische Beziehung zu setzen, kommt der Idee von Belesenheit vielleicht schon näher. Diese selbst aber zehrt von dem Gedanken, dass es Bücher gibt, ohne die die Welt und damit die auf ihr lebenden Menschen in jeder Hinsicht ärmer wären.
Eine Überlegung des Berliner Philosophen Peter Bieri, der unter dem Pseudonym Pascal Mercier auch einige erfolgreiche Romane wie »Nachtzug nach Lissabon« geschrieben hat, mag dies verdeutlichen. »Der Gebildete ist ein Leser. Doch es reicht nicht, ein Bücherwurm und Vielwisser zu sein. Es gibt – so paradox es klingt – den ungebildeten Gelehrten. Der Unterschied: Der Gebildete weiß Bücher so zu lesen, dass sie ihn verändern.«3 Lesen vermag deshalb zu einer konstitutiven und nicht nur möglichen Voraussetzung von Bildung zu werden, da die persönlichkeitsformende Kraft von Texten hier unterstellt wird. Und es geht dabei nicht nur um das Machen jener berühmten Erfahrungen, von denen auch manch kompetenzorientierter Lehrplan spricht; es geht darum, die Erfahrung zu machen, wie man Erfahrungen macht. Noch einmal Bieri: »Der Leser von Literatur lernt noch etwas anderes: Wie man über das Denken, Wollen und Fühlen von Menschen sprechen kann. Er lernt die Sprache der Seele. Er lernt, dass man derselben Sache gegenüber anders empfinden kann, als er es gewohnt ist. Andere Liebe, anderer Hass. Er lernt neue Wörter und neue Metaphern für seelisches Geschehen. Er kann, weil sein Wortschatz, sein begriffliches Repertoire, größer geworden ist, nun nuancierter über sein Erleben reden, und das wiederum ermöglicht ihm, differenzierter zu empfinden.«4 Das Wissen der Literatur enthält, so könnte man sagen, den Umschlag in bestimmte Kompetenzen schon in sich bereit. Fraglich aber, ob dieses Einfühlen in eine fremde Welt als operationalisierbarer Vorgang gefasst und exakt definiert werden kann. Die Aufforderung mancher Lehrpläne, dass Schüler angesichts der Texte, die sie lesen, ihre Gefühle zeigen sollen, ist vielleicht gut gemeint, verkennt aber, dass ästhetische Bildung überhaupt von Unwägbarkeiten lebt.
In dem Maße, in dem es nicht mehr darum geht, sich durch Literatur zu verändern, sondern Literatur nur als Vorwand zu benutzen, um Kompetenzen zu schulen, ist der literarisch gebildete Mensch ein Ärgernis. Er verweist uns immer darauf, was wir nicht gelesen haben, und er lässt uns, ohne dass er dies wollte, spüren, dass wir mit unseren Kompetenzen nicht weit kommen. Wer über menschliche Gefühle, über Liebe, Hass und Eifersucht differenzierter und nuancierter sprechen kann, weil er Fontane, Flaubert und Proust gelesen hat, widerlegt das Mantra der Kompetenzorientierung in actu. Man kann, hat man diese Bücher nicht gelesen, sich davon nicht dispensieren, dass man darauf verweist, problemorientiert Gebrauchstexte zum Thema Eifersucht – etwa von der Ratgeberseite einer Boulevardzeitung – analysiert und situationsspezifisch angewandt zu haben. Das, was an literarischer Bildung provoziert, ist die Tatsache, dass es dabei nicht darum geht, irgendwelche Kompetenzen an relativ beliebigen Texten geschult, sondern genau dieses Buch und kein anderes gelesen zu haben.
Einen Aspekt von Belesenheit unterschlägt Bieri allerdings: dass der literarisch Gebildete nicht nur genauer über Gefühle und Erfahrungen, sondern vor allem auch über das, was er gelesen hat, sprechen kann. Man untergräbt den Sinn von Literatur, wenn man nicht auch deren Eigensinn bedenkt. Man kann Bücher lesen wollen, weil man sie gelesen haben will. Ob und welche Wirkung diese Lektüren haben, ob und inwieweit man sich dabei verändert, muss letztlich dahingestellt bleiben. Jeder Kanon verwies auch implizit auf diesen Eigenwert eines literarischen Textes. Allein seine Gestalt, seine Besonderheit, seine ästhetische Qualität rechtfertigt seine Lektüre – dazu bedarf es weder der Aktualisierung noch bestimmter Einordnungs- und Verwertungsstrategien, noch der Perspektive, dass man nach dessen Lektüre sich und die Welt besser verstehen werde.
Das Werk – und dies gilt für ästhetische Objekte von Rang schlechthin – stellt durch seine pure Existenz den Grund für seine Rezeption dar. Dass man Goethes »Faust«, Musils »Mann ohne Eigenschaften« oder Thomas Manns »Zauberberg« gelesen haben muss, bedarf keiner weiteren Begründung mehr in Hinblick auf deren Funktionalität und Brauchbarkeit. Der verächtliche Hinweis, dass man sich solche Lektüren ersparen kann, handelt es sich dabei doch um leeres und totes Bildungsgut, verrät mehr über die Idee von Bildung, als deren Verächtern lieb sein kann. Wohl erschöpft sich diese nicht in der Hingabe an eine Sache um deren selbst willen, aber ohne eine solche Hingabe und der Fähigkeit dazu gäbe es keine Bildung. Keine Schule kann solch eine Hingabe erzwingen. Aber eine Schule, die deren Möglichkeit bestreitet und rigide blockiert, indem sie jedes Stück Literatur, das in ihr noch vorkommt, auf seine kompetenzstrategische Verwertbarkeit befragt, ist barbarisch.
Literarische Bildung lebt von der Fiktion, dass es Bücher gibt, deren Lektüre uns verändern kann, und dass dies nicht nur an uns, unserer Disposition und unserer Situation liegt, sondern auch an genau diesen Büchern. Nur solch ein Denken legitimiert einen Kanon, und nur ein Kanon, wie umstritten und veränderbar er auch immer sein mag, gibt eine Orientierung für das, was wir literarische Bildung nennen können. Allerdings gehört auch zu dieser Bildung: Je mehr ich gelesen habe, desto klarer wird das Wissen und Bewusstsein davon, was ich alles nicht gelesen habe und was ich vielleicht nie lesen werde. Der Habitus des Belesenen widerspricht so prinzipiell der Arroganz des vermeintlichen Bildungsbürgers, der mit aus den Zusammenhängen gerissenen Zitaten hausieren ging, ebenso wie dem auftrumpfenden Gebaren digitaler Omnipotenzphantasien, die suggerieren, alles im Griff zu haben und überall Bescheid zu wissen, weil ein Smartphone in der Nähe ist.
Die Provokation literarischer Bildung besteht nicht zuletzt in der persönlichkeitsverändernden Kraft der Literatur, die unmerklich vonstattengeht, keinen Zielvorstellungen folgt, nicht operationalisierbar und deshalb auch nicht kontrollierbar und prüfbar ist. Dass es eine Form der Bildung gibt, die sich dem Zugriff der qualitätssichernden Behörden entzieht, weil sie sich aus einer informellen Beziehung zwischen Schüler und Lehrer entspinnen mag, kratzt an all jenen Quantifizierungs- und Messbarkeitschimären, ohne die die gegenwärtige Bildungsforschung ebenso wenig auszukommen glaubt wie die Bildungsorganisation.
Der Anspruch literarischer Bildung ist auch aus einem anderen Grund eine Provokation: Er widerspricht einem Prinzip von Chancengerechtigkeit, das auf Erfolgsgleichheit abzielt. Literarische Erfahrungen können, wie jede authentische Form von Bildung, von Bildungseinrichtungen zwar ermöglicht und erleichtert, aber nicht erzwungen und auch nicht überprüft werden. Lesen ist ein einsames Geschäft, und welche formenden Auswirkungen eine Lektüre auf den Entwicklungs- und Bildungsprozess eines Menschen hat, welches Interesse dadurch angestachelt, welches vielleicht sabotiert werden kann, lässt sich weder planen noch prognostizieren. Literarische Bildung widerspricht auch deshalb dem pädagogischen Zeitgeist, weil der Anspruch, sie in Unterrichtsprozessen zu gestalten, stets klarmacht: Dieser Unterricht kann letztlich nur für Einzelne stattfinden. Man kann die Auseinandersetzung mit und die Aneignung von Literatur nicht erzwingen, man kann nur den Boden dafür bereiten. Allein die Verkaufszahlen von Büchern zeigen, dass Lesen, in all seinen Varianten, das geblieben ist, was es immer war: ein Minderheitenprogramm. Wie jede Minderheit verdiente aber auch die der Lesenden einen besonderen Schutz. Die Zeiten und die Milieus, in denen man durch das Aufzählen von Autorennamen und Buchtiteln einen sozialen Distinktionsgewinn verbuchen konnte, sind längst vorbei.
Tatsächlich aber vollzieht sich in der aktuellen Bildungsreform jene Tendenz, die Heinz-Joachim Heydorn schon vor Jahrzehnten einem reformorientierten Bildungsbegriff, der auf die Beseitigung sozialer Bildungsprivilegien abzielte, zum Vorwurf gemacht hatte: »So setzt sich diese Bildung auch von der Literatur ab, der Tradition folgend, daß die literarische Bildung bei den Massen nichts zu suchen hat; jetzt sind nur noch Massen übrig. War diese Bildung früher den herrschenden Klassen allein überlassen, so wird sie nunmehr zurückgewiesen, weil es sich bei ihr um die Bildung der früheren Oberklasse handelt, weil sie eine ›schichtenspezifisch beschränkte Auswahl der Inhalte‹ bietet. Ein demokratischer Vorgang; was früher nur die oberen Zehntausend lesen durften, darf jetzt niemand mehr lesen. Ungleichheit für alle.«5 Im Gegensatz zu einem Glaubenssatz aktueller Bildungspolitik, dass Bildung soziale Differenzen ausgleichen und damit verbundene Nachteile kompensieren sollte, verweist das Konzept der literarischen Bildung darauf, dass dies, wenn überhaupt, nicht als soziales Projekt, sondern nur als individueller Akt möglich ist. Dem zu entgehen, indem man die Literatur aus den Lehrplänen streicht, zeugt nicht nur von Unbildung, sondern zeigt auch, dass diese unmittelbar eine Konsequenz von Gerechtigkeitsvorstellungen sein kann, die bei aller verbalen Glorifizierung der Individualisierung des Unterrichts das Individuum und seinen Eigensinn am liebsten durchstreichen möchten.
Literatur aber hat eine Gestalt. Sie erscheint in der Form des Buches. Lesen als avancierte kulturelle Praxis ist ohne das Buch nicht denkbar. Die aktuell forciert betriebene Digitalisierung von Schulen und Universitäten, die sich alles Heil von Geräten und nicht von Ideen erwartet, verhindert in großem Maßstab die Entwicklung jedes Interesses für die Literatur. Denn um dieses zu wecken, bedarf es keiner digitalen Endgeräte, keiner Apps und schon gar keiner Programmierkenntnisse. Die Auseinandersetzung mit einem Buch lässt sich auch nicht durch eine rasche Internet-Recherche substituieren. Belesenheit ist auch deshalb eine Provokation, weil sie, letztlich als Summe vielfältiger Lektüreerfahrungen, die ihre Spuren im Leben eines Menschen hinterlassen haben, quer steht zur Ideologie der raschen Verfügbarkeit aller Informationen. Das Interesse für Literatur wird geweckt, wenn man im richtigen Moment das richtige Buch in die Hand gedrückt bekommt und sich dadurch die Chance eröffnet, zu einem Leser zu werden.
Solche Momente und solche Bücher böten durchaus Chancen für die Weiterentwicklung unserer Gesellschaft. Ein »Zurück zur Literatur« kann sich nicht in Nostalgie, Kulturpessimismus und Verlustanzeigen erschöpfen.6 Es gibt Bücher, die es sich zu lesen lohnt, weil sie, aus welcher Zeit sie auch stammen, wesentlich mit unserem Leben und unseren aktuellen politischen Fragen zu tun haben. So könnte man die These riskieren, dass eine fundierte literarische Bildung mehr zu einem europäischen Bewusstsein und zu einer europäischen Perspektive beitragen könnte als der Bologna-Prozess und seine überbordende Bürokratie. Europa war der Kontinent der großen Erzählungen, und nach dem Ende dieser Erzählungen ist Europa selbst zum letzten dieser Narrative geworden. Was spräche dagegen, einen Kanon der europäischen Literatur zu skizzieren und dessen Lektüre allen höheren Schulen in Europa zu empfehlen?
Wie könnte solch ein Kanon aussehen? Beginnen könnte man dabei mit dem Mythos selbst, mit der phönizischen Königstochter, die den Namen Europa trug und von Zeus in Gestalt eines Stieres verführt, entführt und auf Kreta vergewaltigt wird. Ein für alle Mal ist damit die These der nichteuropäischen Herkunft Europas gesetzt, die den Orient als Ursprung und Quelle des Okzidents festhält. Fortsetzen könnte man mit Homers »Ilias«, die ebenso paradigmatisch das Europäische in der schicksalhaften Auseinandersetzung mit dem Anderen sieht, eine Auseinandersetzung allerdings, die nicht aus einer Differenz, sondern aus einem ähnlichen Begehren geboren wurde: dem Verlangen nach Schönheit. Weiterführen könnte man diesen Reigen mit Vergils »Aeneis«, jenem Epos, das in einem wahrlich fundamentalen Sinn Europa als den Kontinent der Immigranten beschreibt. Und schließen könnte man diese Ur- und Vorgeschichten mit dem »Nibelungenlied«, das nicht nur Unschuld und Heldenmut, Treue und Verrat besingt, sondern Europas Schicksal an die kaum zu definierende kontinentale Grenze zum asiatischen Raum knüpft.
Motive, die sich durchziehen, Stoffe, die nicht vergessen werden können, Konstellationen, die immer wieder durchbrechen. Aber Europa ist weit darüber hinaus der Kontinent der Literaturen, der unzähligen Geschichten, der sich beeinflussenden, ergänzenden, widersprechenden, einander überbietenden Formen des Erzählens, Berichtens und Darstellens. Keine europäische Sprache, keine europäische Region, die nicht ihren Beitrag zu diesem Kontinent der Poesie geleistet hätte. Europa, seine Vielfalt und seine Einfalt, seine Menschen und seine Konflikte, seine Nöte und seine Freuden könnten im Wortsinn erlesen werden. Die Erfahrung des Europäischen als Leseerfahrung, der Lesende als Manifestation des Europäischen – was spräche dagegen? Denn wo wäre mehr Europa als in Dante und Shakespeare, Cervantes und Goethe, Flaubert und Ibsen, Dostojewski und Kazantzakis? Und wäre dies nicht eine reizvolle Vorstellung: junge Menschen, die sich, über welche Austauschprogramme auch immer vermittelt, irgendwo in Europa begegnen und ihre literarischen Erfahrungen teilen können, da sich diese auf jene Werke beziehen, die in all ihrer Ambivalenz und Widersprüchlichkeit einen entscheidenden Anteil an der Herausbildung eines europäischen Bewusstseins hatten und haben?
Doch Vorsicht. Noch die wohlmeinendste politische Indienstnahme von Literatur verkennt deren Sinn und Möglichkeiten. Literatur ist nie auf ein Ende, einen Zweck zu reduzieren. Literarische Bildung bedeutet, einen geistigen Kontinent zu betreten, der voll ist von Überraschungen, Unwägbarkeiten, Enttäuschungen, Begegnungen und Erfahrungen, auch voll von Mühen und Plagen, und der gerade deshalb immer wieder aufs Neue lockt und verlockt, aber auch verstört und abstößt. Auf diesem Kontinent gibt es weder Erfolgs- noch Glücksgarantien. Und niemand soll gewaltsam gezwungen werden, diesen Kontinent zu betreten. Durch eine kompetenzversessene und technikgläubige Bildungspolitik jungen Menschen aber systematisch den Zugang zum Kontinent Literatur zu verbauen, kann nur als ein Akt der Barbarei gewertet werden.
DAS SCHLECHTE GEWISSEN
Über Muße und Bildung
Es ist paradox: Obwohl der moderne Mensch aufgrund seiner hohen Produktivität, durch unzählige raffinierte und zunehmend intelligente Technologien unterstützt, mehr Zeit frei von den Zwängen unmittelbarer Erwerbstätigkeit verbringen könnte, macht er den Eindruck eines gehetzten Tieres, das ständig in Bewegung sein muss, nie innehalten darf, keinen Stillstand dulden kann, hilflos dem Beschleunigungstaumel einer Entwicklung ausgesetzt ist, die es weder kontrolliert noch wirklich versteht. Das ständig präsente Gefühl, von Märkten, Innovationen, dem Wettbewerb und der Konkurrenz getrieben zu sein, die Angst, sofort zurückzubleiben und alles zu verlieren, gönnte man sich nur eine Pause, die fatalistische Vorstellung, dass man nicht der Gestalter der Zukunft sei, sondern nur auf deren Herausforderungen reagieren könne, die Zustimmung zu einer Welt, in der angeblich die Sachzwänge und der stets drohende Mitbewerber kaum noch Besinnung und Alternativen zuließen – all dies sabotiert jeden Gedanken an Phasen der Ruhe und der Besinnung.
Wohl kennt auch der moderne Mensch die eine oder andere Unterbrechung dieser Dynamik, die Freizeit und den Urlaub, aber auch diese Zeit muss analog der Arbeitszeit effizient genutzt, verplant, mit möglichst vielen Events gefüllt und am besten mit Aktivitäten kombiniert werden, die seine Arbeitskraft stärken und seine individuelle Wettbewerbsfähigkeit erhöhen. Wer in einem Sommer weder seine Fitness noch seine interkulturelle Kompetenz oder seine Fremdsprachenkenntnisse verbessern, sondern einfach nur einmal nichts tun wollte, machte sich höchst verdächtig. Er versündigte sich gleichsam an dem Imperativ unserer Tage, jederzeit all seine Ressourcen auszuschöpfen und seine Fähigkeiten zu optimieren. Uns mangelt es weniger an Zeiten, über die wir souverän verfügen könnten, uns mangelt es an der Fähigkeit, diese Zeiten anders zu strukturieren als nach jenen Parametern, die auch unser Berufsleben und die Wettbewerbsgesellschaft insgesamt steuern. Es fehlt uns an dem, was die Alten Muße genannt hatten.
Das altgriechische Wort für Muße war scholé, von dem sich auch unsere Schule ableitet. Es bezeichnete ursprünglich die Stätte, an der man sich aufhielt, wenn man nicht arbeiten musste. Die Antike sah in dieser Muße die entscheidende und erstrebenswerte Weise des Daseins überhaupt, die Arbeit hingegen als das, was eigentlich vermieden werden sollte. Arbeit war definiert als Negation der Muße: ascholia. Diese Muße war allerdings alles andere als ein Nichtstun. Sie war keine leere Zeit, die mit Unterhaltungen und Zerstreuungen aller Art gefüllt werden musste, kein faules Nichtstun, sondern die Zeit, über die man frei verfügte und die man konzentriert den Dingen des Lebens widmen konnte, die ihren Wert in sich trugen und nicht Mittel für einen Zweck waren: Schönheit, Erkennen, Freundschaft, Erotik. Erst die Moderne machte aus der Arbeit eine Tugend und aus dem Müßiggang den Anfang aller Laster.
Friedrich Nietzsche hatte dies als einer der Ersten erkannt und präzise beschrieben. Im 329. Aphorismus der »Fröhlichen Wissenschaft« notierte er unter dem Stichwort »Muße und Müßiggang«: »Man schämt sich jetzt schon der Ruhe; das lange Nachsinnen macht beinahe Gewissensbisse. Man denkt mit der Uhr in der Hand, wie man zu Mittag isst, das Auge auf das Börsenblatt gerichtet, – man lebt, wie Einer, der fortwährend Etwas ›versäumen könnte‹. […] Das Leben auf der Jagd nach Gewinn zwingt fortwährend dazu, seinen Geist bis zur Erschöpfung auszugeben, im beständigen Sich-Verstellen oder Ueberlisten oder Zuvorkommen: die eigentliche Tugend ist jetzt, Etwas in weniger Zeit zu thun, als ein Anderer. Und so giebt es nur selten Stunden der erlaubten Redlichkeit: in diesen aber ist man müde und möchte sich nicht nur ›gehen lassen‹, sondern lang und breit und plump sich hinstrecken. […] Die Arbeit bekommt immer mehr alles gute Gewissen auf ihre Seite: der Hang zur Freude nennt sich bereits ›Bedürfniss der Erholung‹ und fängt an, sich vor sich selber zu schämen. ›Man ist es seiner Gesundheit schuldig‹ – so redet man, wenn man auf einer Landpartie ertappt wird. Ja, es könnte bald so weit kommen, dass man einem Hange zur vita contemplativa (das heisst zum Spazierengehen mit Gedanken und Freunden) nicht ohne Selbstverachtung und schlechtes Gewissen nachgäbe. – Nun! Ehedem war es umgekehrt: die Arbeit hatte das schlechte Gewissen auf sich.«1
Die Zeiten, in denen man ein schlechtes Gewissen hatte, weil man arbeitete und die Muße vernachlässigte, sind wahrlich vorbei. Im Gegenteil: Wir fürchten uns vor der Muße, bekommen ein schlechtes Gewissen, wenn wir nicht ständig dynamisch, in Bewegung und produktiv sind. Ein voller Terminkalender ist ein Statussymbol, und das Burnout eine ehrenhafte Krankheit: Nur wer sich verausgabt, kann ausbrennen. Und wenn wir uns einmal zurücklehnen und durchatmen wollen, nennen wir dies nicht mehr Muße, sondern Regenerationsarbeit. Noch in der Untätigkeit müssen wir tätig sein, auch der Schlaf will mittlerweile effizient organisiert sein, überwacht von einer Uhr, die Herzfrequenz, Schlafphasen und Schlafintensität misst und uns signalisiert, wo auch hier noch Einsparungs- und Optimierungspotenziale im wahrsten Sinn des Wortes schlummern.
Diese Rastlosigkeit kennzeichnet auch unser Bildungswesen, in dem doch die Muße nicht nur etymologisch beheimatet sein sollte. Die Klage, dass der Output unserer Bildungsinstitutionen nicht den dafür aufgewendeten Mitteln entspräche, die Forderung, doch alle Talente und Begabungen der Kinder und Jugendlichen besser zu nutzen, die Hektik, die alle einander überbietenden Reformvorhaben kennzeichnet, die methodische und didaktische Innovationssucht in einem Feld, das vielleicht am besten bestellt ist, wenn es von Innovationen verschont wird, die in rascher Folge einander ablösenden wechselnden Tests für alle möglichen Kompetenzen und die daran anschließenden medialen Erregungskurven, die Programme zur Studienzeitverkürzung und der Aufschrei, wenn einmal jemand mehr Zeit an einer Universität verbringt, als die knapp kalkulierenden Bildungsökonomen vorgesehen haben – all das demonstriert, wie sehr wir unter Bildung und Lernen nur noch ein Ausbildungs- und Qualifizierungsprogramm mit knappem Zeitmanagement verstehen und jede Form einer frei flottierenden Neugier, jede Lust am Erkennen, jede Freude am Schönen als unnütz, als Verschwendung von Zeit und Geld denunzieren.