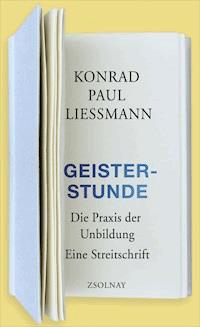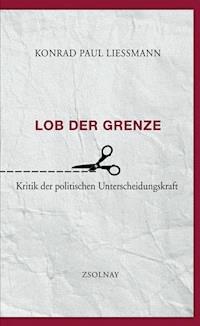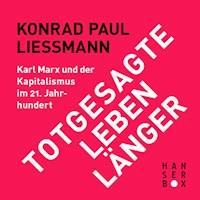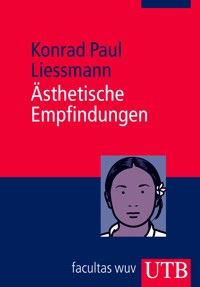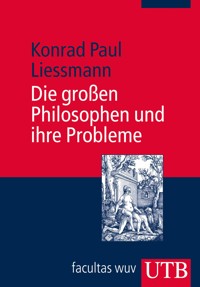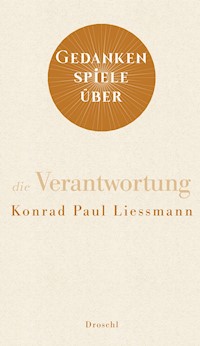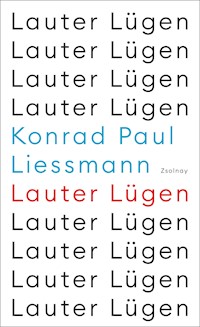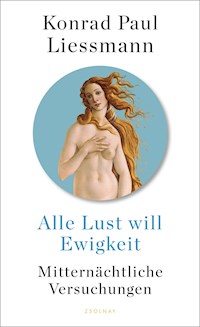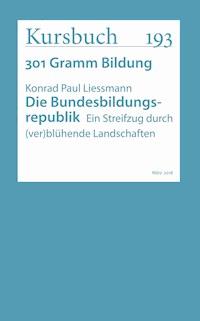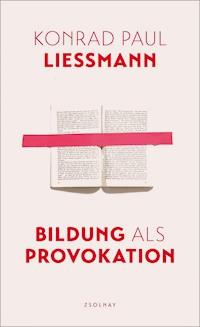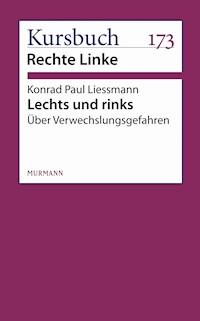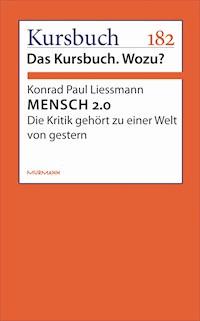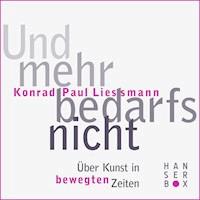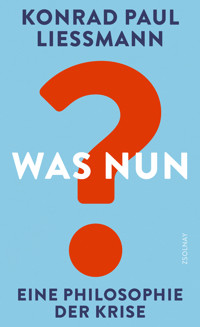
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Paul Zsolnay Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Eine Philosophie der Krise: Konrad Paul Liessmann liefert eine lebensrettende Lektüre in schwierigen Zeiten Wir leben in einer Zeit der Krisen. So weit, so schlecht. Aber wie zeigen sich diese Krisen? Welche Bereiche unseres Lebens, Denkens und Handelns sind davon betroffen? Und stecken in den Krisen auch tatsächlich die viel beschworenen Chancen? Eines ist klar: Krise bedeutet kein »Weiter wie bisher«. Konrad Paul Liessmann entfaltet ein Panorama unserer krisengeschüttelten Welt und wirft einen unbestechlichen Blick auf Einrichtungen, Vorstellungen, Überzeugungen, Emotionen und Denkweisen, die nun zur Disposition stehen. Von der Krise der Freiheit bis zur Krise der Moral reichen seine Themen, beunruhigend und aufregend zugleich – denn in jeder Krise geht es zentral um eine Frage: Wird über uns entschieden, oder entscheiden wir selbst?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 282
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Eine Philosophie der Krise: Konrad Paul Liessmann liefert eine lebensrettende Lektüre in schwierigen ZeitenWir leben in einer Zeit der Krisen. So weit, so schlecht. Aber wie zeigen sich diese Krisen? Welche Bereiche unseres Lebens, Denkens und Handelns sind davon betroffen? Und stecken in den Krisen auch tatsächlich die viel beschworenen Chancen? Eines ist klar: Krise bedeutet kein »Weiter wie bisher«.Konrad Paul Liessmann entfaltet ein Panorama unserer krisengeschüttelten Welt und wirft einen unbestechlichen Blick auf Einrichtungen, Vorstellungen, Überzeugungen, Emotionen und Denkweisen, die nun zur Disposition stehen. Von der Krise der Freiheit bis zur Krise der Moral reichen seine Themen, beunruhigend und aufregend zugleich — denn in jeder Krise geht es zentral um eine Frage: Wird über uns entschieden, oder entscheiden wir selbst?
Konrad Paul Liessmann
Was nun?
Eine Philosophie der Krise
Paul Zsolnay Verlag
Übersicht
Cover
Über das Buch
Titel
Über Konrad Paul Liessmann
Impressum
Inhalt
Was nun? — Die Krise und ihre Chance
Falsch gewählt — Die Krise der parlamentarischen Demokratie
Triumph des Duldens — Die Krise der Toleranz
Kein Wille zur Macht — Die Krise des Begehrens
Schmutzige Hände — Die Krise der Wissenschaft im Zeitalter des Aktionismus
Der befleckte Geist — Cancel Culture und die Krise der Sprache
Der Schrei des bösen Gewissens — Die Krise der Meinungsfreiheit
Face-ID — Die Krise des Gesichts im Zeitalter seiner technischen Produzierbarkeit
Auf Rädern — Die Krise der Mobilität
Ohne uns? — Der Traum der Maschinen und die Krise des Menschen
Form gewordene Verantwortungslosigkeit — Die Krise der Kunst im Zeitalter der Hypermoral
Widerstand ist keine Kunst — Antigone und die Krise der Auflehnung
Hass und Hetze — Die Krise der großen Gefühle
In frommer Erwartung — Die Krise der Hoffnung im Angesicht der Apokalypse
Nichts zu lachen — Die Krise des Humors
Anmerkungen
Drucknachweise
Was nun?
Die Krise und ihre Chance
Wir leben in einem Zeitalter der multiplen Krisen: Pandemie, Krieg, Inflation, Korruption, Klimawandel, Populismus, Migration, Kapitalismus, künstliche Intelligenz. Damit sind nur die großen Krisenherde benannt, die uns seit einigen Jahren beschäftigen, kleinere Krisen wie der Verfall des Gesundheitswesens, bröckelnde Brandmauern oder endlose Regierungsverhandlungen zählen wir dabei gar nicht mit. Und bei all dem war noch nicht von den vielen persönlichen Krisen die Rede, die einerseits als Folge der großen Krisen den Einzelnen treffen können, andererseits diesen auch nicht verschonten, wäre die Welt in Ordnung. Die Omnipräsenz der Krise, die zu einem Merkmal unseres Lebens geworden ist, stellt uns jedoch vor ein großes Problem: Die Krise ist die Unterbrechung des Alltags, nicht dessen Fortsetzung mit anderen Mitteln. Die Krise ist kein Dauerzustand. Wer das Gefühl hat, ständig mit und in Krisen zu leben, hat im strengen Sinn keine Krise. Es lohnt sich also, etwas schärfer über den Begriff der Krise nachzudenken.
Eine Krise ist eine plötzliche Veränderung, ein dramatischer Einschnitt, das Ende einer gewohnten Lebensform, ein Wendepunkt in einem Prozess, ohne dass klar würde, was nun kommen wird. Eine Krise, so legt es die Etymologie nahe, ist eine Phase, in der sich die Dinge scheiden. Die Krisis leitet sich von dem griechischen krínein ab, das so viel wie trennen oder unterscheiden bedeutet. Das Wort »Kritik« geht auf dieselbe Wurzel zurück. Nur während wir in der Kritik selbst Unterscheidungen vornehmen — etwa zwischen gelungen oder weniger gelungen, gut oder schlecht, angemessen oder unangemessen —, werden wir in der Krise von Unterscheidungen getroffen. Es geht darum, diese zu erkennen, zu beurteilen und dann, wenn möglich, zu handeln.
Krise ist vorab ein Synonym für Differenzerfahrungen. Es ändert sich etwas, und es steht zu erwarten, dass nachher fast nichts mehr so sein wird wie vorher. Die Krise selbst ereignet sich in der Zeit. Sie markiert eine dramatische Unterscheidung zwischen einem Davor und Danach. In der antiken Medizin verstand Hippokrates unter Krise eine kurze Phase im Krankheitsverlauf, jene »entscheidenden Tage«, in denen sich herausstellt, ob zum Beispiel eine Infektion überwunden werden kann oder nicht. Eine Krise kann man, muss man aber nicht überstehen. Die Krise ist in diesem Sinne auch ein Urteil, das über gesund oder krank, Genesung oder Verfall, Tod oder Leben entscheidet.
Dass es in jeder Krise zentral um ein Urteil geht, ist bisher vielleicht unterschätzt worden. Damit ist die juristische Sphäre des Krisenbegriffs berührt. In jeder Krise geht es auch um Recht und Unrecht, Schuld und Unschuld. Das trifft auf Beziehungskrisen ebenso zu wie auf politische oder ökonomische Zusammenbrüche. Der Philosoph Gunnar Hindrichs hat darauf aufmerksam gemacht, dass theologisch gesprochen das »alles entscheidende Urteil das Urteil des Jüngsten Gerichts ist«.1 In diesem werden nach einer letzten, apokalyptischen Schlacht die Guten von den Bösen geschieden und ein endgültiges Urteil gefällt, das die zerrissene Welt wieder ordnet.
Nach Hindrichs lassen sich am Krisenbegriff drei Bedeutungen unterscheiden: das Urteil über Richtig und Falsch, die Entscheidung über Leben und Tod und die Apokalypse und deren Verinnerlichung.2 Naheliegend, dass diese Bedeutung bei der aktuellen Krisenrhetorik mitschwingt: Es droht stets ein Untergang, der nur unter Aufbietung aller Kräfte abgewehrt werden kann.
Das Jüngste Gericht als innere Konsequenz eines dramatischen Krisenbewusstseins spiegelt sich womöglich auch in der Erwartung, die zunehmend in die Verrechtlichung des Politischen gesetzt wird. Ob nun Gerichte über die Klimapolitik befinden oder der Internationale Gerichtshof ein Land, das um seine Existenz kämpft, des Völkermordes bezichtigt und seine gewählten Repräsentanten zur Verhaftung ausschreibt, ob oppositionelle Parteien durch einen Gerichtsbeschluss verboten werden sollen oder Politiker sich nicht mehr ihren Kritikern stellen, sondern diese wegen Beleidigung anklagen lassen — meistens steht dahinter die Vorstellung, dass die ungelösten Konflikte einer Gesellschaft durch ein Urteil, das von einer höheren Instanz gefällt wird, bereinigt werden können. Mit diesem Urteil ist stets darüber befunden, wer in einem moralischen Sinn verworfen und wer erhöht wird. Eine Gesellschaft im Krisenmodus kann deshalb gar nicht anders, als von der Beurteilung einer Lage rasch in ein Verurteilen zu verfallen.
Im ökonomischen, politischen und sozialen Bereich stellen Krisen die kurzfristige Störung oder den Zusammenbruch bisher funktionierender Ordnungen dar, aus denen nach einer mitunter chaotischen Phase eine neue, im Idealfall stabilere Ordnung entsteht. In der Nachfolge einer marxistisch inspirierten Geschichtsphilosophie war dies eine gängige Lesart der Krise. Bei Antonio Gramsci heißt es: »Die Krise besteht gerade in der Tatsache, dass das Alte stirbt und das Neue nicht zur Welt kommen kann: in diesem Interregnum kommt es zu den unterschiedlichsten Krankheitserscheinungen.«3 Im Gegensatz zu Hippokrates bedingt in dieser Deutung nicht die Krankheit die Krise, sondern die Krise führt zu einer Phase der Unsicherheit, einer politischen, sozialen und ökonomischen Zwischenzeit, aus der sich allerdings das Neue, das Bessere, wenn auch unter Schmerzen, herausbilden wird. Die Vorstellung, dass zwar das Alte in eine Krise geraten kann, das Neue aber ausbleibt oder sich als nicht tragfähig erweist, war in diesem Konzept nicht vorgesehen. Im Falle der kommunistischen Gesellschaften Osteuropas hat die Geschichte selbst Gramscis optimistische Annahme widerlegt.
Erfolgsgarantie gibt es also keine, und wir taumeln von einer Krise in die nächste. Wie in einem individuellen Leben können im Extremfall sogar Institutionen an einer Krise scheitern und diese nicht überleben. Das wird als besonders prekär erlebt, da Institutionen erfunden worden sind, um den Einzelnen und Gemeinschaften vor Krisen zu schützen. In Zeiten der Krise gewinnen deshalb Konzepte an Attraktivität, die ein radikales und sofortiges Eingreifen ankündigen.
Wann jedoch ist die Differenz zwischen einem Davor und Danach so signifikant, dass man von einer Krise sprechen kann? Denn Leben bedeutet in all seinen individuellen und sozialen Formen stete Veränderung. Nicht jede dieser Veränderungen, die wir etwa im normalen Prozess des Älterwerdens und Alterns, in einer Karriere, im Laufe einer Beziehung erleben, verstehen wir als Krise. Und selbst wenn Veränderungen plötzlich auftreten, muss das nicht mit einem Krisenbewusstsein verbunden sein. Werden diese Veränderungen positiv konnotiert — man denke an einen Glücksfall, eine aufregende Begegnung mit einem Menschen oder eine hilfreiche Erfindung —, erleben wir diese eher als Stimulus, als Bereicherung, als neue Option und weniger als Krise. Am Beispiel einer in ihrer frühen Jugend gefeierten Schauspielerin, die später von der Kritik verhöhnt wird, aber in ihrem dreißigsten Lebensjahr noch einmal eine bezaubernde und tief empfundene Julia gibt, hatte der Philosoph Sören Kierkegaard die Krise als »Metamorphose«4 beschrieben, einen Wandel der Gestalt, der durch eine existenzielle Verunsicherung und eigentümliche Dialektik gekennzeichnet ist: Zur Krise gehört die Erfahrung der Negativität.
In einer Krise bricht etwas zusammen, von dem man nicht wollte, dass es zusammenbricht. Solche Verwerfungen zeitigen sowohl für den Einzelnen als auch für Kollektive wie Institutionen oder Systeme negative Folgen. Wir erleben Krisen in erster Linie als Ausbruch von Dysfunktionalitäten. Die gewohnte Anerkennung — im Falle von Kierkegaards Schauspielerin — bleibt aus. Dinge, deren Ablauf geregelt schien, geraten außer Tritt: Der Körper funktioniert nicht mehr, das Bildungssystem funktioniert nicht mehr, die Wirtschaft funktioniert nicht mehr, der Staat funktioniert nicht mehr. Wer sich wegen einer Erkrankung vor Schmerzen krümmt, nach einer Trennung dem Alkohol verfällt, als Lehrperson angesichts chaotischer Zustände nicht mehr unterrichten kann, wer glaubt, nur noch durch Korruption bei Behörden Gehör zu finden, und zusehen muss, wie die Inflation seine Ersparnisse auffrisst, erlebt sich in einem Krisenmodus. Die Krise ist unerwünscht, sie schmerzt, und sie erzeugt das Gefühl der Ohnmacht.
Zu einer signifikanten Krisenerfahrung gehört deshalb eine momentane Rat- und Orientierungslosigkeit, die sich dramatisch auswirkt. Die Frage, die sich in jeder Krise stellt, lautet: Was nun? Wenn sich diese Frage in all ihrer schmerzhaften Bedeutung aufdrängt, handelt es sich um eine Krise. Dieses unerbittliche »Was nun?« markiert den innersten Kern jeder Krisenerfahrung, von den alltäglichen Verunsicherungen bis zu den globalen Verwerfungen. Wer sich ohne Navigationsgerät in einer fremden Stadt verfahren oder verlaufen hat, wird sich diese Frage ebenso stellen wie der Politiker, der keine Ahnung hat, wie man explodierende Energiepreise in den Griff bekommt. Menschen, die angesichts unvorhergesehener Ereignisse sofort wissen, was zu tun ist, empfinden die Krise nicht als Krise. Das führt uns zu einem seltsamen Paradoxon: Nicht selten sind diejenigen, die eine Krise diagnostizieren — man denke an Oppositionspolitiker —, die Gleichen, die vorgeben, genau zu wissen, was zu tun wäre. Wer heute die Klimakrise oder eine Krise der Demokratie verkündet, hat meist genaue Vorstellungen davon, wie diese Krise bewältigt werden könnte, ihm fehlen — so wird gerne suggeriert — lediglich die Mittel und Möglichkeiten dazu.
Es gehört zum Begriff der Krise als eines Wendepunktes, einer entscheidenden und scheidenden Zäsur, dass sie zeitlich limitiert ist. Eine Krise erfordert irgendwann eine Intervention, ein Handeln, einen Eingriff, einen Versuch. Im Diagnostizieren einer Krise steckt schon die implizite Aufforderung zum Handeln. Die Zeiten der Krise sind oft Zeiten der autoritären Versuchung. Diese Interventionen können erfolgreich oder erfolglos sein, sie können ein System nach einer chaotischen Phase wieder stabilisieren, vielleicht verbessern, auf neue Fundamente stellen, durch etwas anderes ablösen, eine Transformation einleiten und eine Metamorphose ermöglichen, oder sie können scheitern und sowohl für Individuen als auch für soziale Systeme ein Ende bedeuten. Ob eine krisengeschüttelte Partei zu neuen Ufern aufbrechen kann oder sich auflöst, wird sich weisen — beides ist am Höhepunkt der Krise noch denkbar. Sich passiv in das Unvermeidliche zu fügen und einfach zu warten, was geschieht, ist durchaus eine Möglichkeit, auf Krisenerfahrungen zu reagieren. Mitunter lassen sich dadurch manche Probleme besser lösen als durch hektischen Aktivismus oder undemokratische Anordnungen.
Folgt man diesen Überlegungen, wird deutlich, warum es nicht wirklich sinnvoll ist, von einer Klimakrise zu sprechen. Das mag überraschen. Abgesehen davon, dass das Klima an sich in keiner Krise sein kann, sondern die vom Klima betroffenen Menschen Probleme bekommen, bricht im Falle des Klimawandels nicht plötzlich ein funktionierendes System zusammen, das dann durch einige Interventionen rasch stabilisiert werden könnte. Die Rede von der Klimakrise weckt aber genau diese Erwartungen. Man müsse nur — wie bei der Stabilisierung von Finanz- oder Immobilienmärkten — rasch das Richtige tun, und alles kommt wieder ins rechte Lot. Das kann in Klimafragen weder die Politik noch der Bürger oder der Konsument leisten. Selbst wenn sich Klimaveränderungen beschleunigen, ist Plötzlichkeit kein Aspekt derselben. Ob es die berühmten Kipppunkte tatsächlich gibt, die ein Umschlagen klimatischer Bedingungen in irreversible, für uns Menschen höchst negative Prozesse darstellen, ist deshalb unter Klimawissenschaftlern durchaus umstritten. Aber sogar diese stellten keine Krise dar, sondern einen Point of no Return. Dass Klimaveränderungen lange ignoriert oder halbherzig wahrgenommen wurden, hängt wesentlich damit zusammen, dass es sich um keine abrupte Unterscheidung zwischen einem Davor und Danach handelt, sondern um sich allmählich beschleunigende Veränderungen. Schneearme Winter hat es in den Alpen immer schon gegeben. Erst ihre Häufung macht sie zu einem Merkmal einer nachhaltigen Klimaveränderung.
Noch ein Einschub: Eine Krise ist (noch) keine Katastrophe. Das altgriechische katastrophé bezeichnet eine dramatische Wendung. Ursprünglich ist dies ein Begriff aus dem Theater, in der antiken Tragödie wird damit der Umschlag bezeichnet, der Menschen in eine Situation stürzt, aus der sie keinen widerspruchsfreien Ausweg mehr finden können. Das Tragische besteht dabei darin, dass es die Möglichkeiten richtigen Handelns nicht mehr gibt. Im gegenwärtigen Sprachgebrauch stellen Katastrophen Unglücksfälle mit verheerenden Folgen dar, die Menschen punktuell und für einen begrenzten Zeitraum treffen. Ein Lawinenabgang, der ein Dorf verschüttet, ein Erdbeben, das eine Stadt in Schutt und Asche legt, eine Flut, die sich nach einigen Tagen wieder zurückzieht, wären Beispiele für solche Katastrophen. Und auch dieser Begriff trifft auf den Klimawandel kaum, vielleicht überhaupt nicht zu. Nach allem, was wir wissen — und natürlich ist dieses Wissen wie alles Wissen vorläufig —, wird es die eine große globale Klimakatastrophe nicht geben. Sie ist ein Schreckbild, oft angereichert mit religiösen Bildern — wenn man etwa von der Klimaapokalypse oder dem Weltuntergang spricht —, das gezeichnet wird, um gegenwärtiges Handeln zu motivieren. Die Vorstellung, wir hätten nur mehr die Wahl zwischen Umkehr oder Untergang, entspricht dieser Katastrophenrhetorik, die, nun auch moralisch aufgeladen, alles zitiert, was im Gefolge solcher Prophezeiungen sich einzustellen pflegt: Die Schuldigen und Bösen werden namhaft gemacht und verurteilt (die Klimasünder, die Industrialisierung, der globale Norden), die Aufforderung, Reue zu zeigen und Buße zu tun, folgt dem auf dem Fuß (Schuldeingeständnisse, Flugscham, das Versprechen, sein Leben zu ändern und sich in Askese zu üben: keine Urlaubsreisen nach Thailand!). Die Natur tritt als säkularisierter Gott auf, der im Jüngsten Klimagericht sein Urteil sprechen wird. Diese Alles-oder-nichts-Rhetorik enthält eine große Gefahr: Sie verleitet dazu, sich entweder resignativ zu verhalten und einem Weiter-so zu frönen oder in ein panisches Handeln zu verfallen, das angesichts einer drohenden Katastrophe alle, auch undemokratische und gewaltsame Mittel für geboten hält, um diese aufzuhalten.
Solche Überzeichnungen sind bedenklich, da sie sich auf eine imaginierte große Klimakatastrophe beziehen und dabei die Realität des Klimawandels aus den Augen verlieren. Denn dieser führt zunehmend zu vielen kleinen Katastrophen. Unwetter, Dürren und Hitzeperioden sind zwar nicht so spektakulär wie das Weltende, aber man kann diese Ereignisse lokalisieren und versuchen, ihnen auf mehreren Ebenen zu begegnen: Von langfristigen Vorhaben wie der CO2-Reduktion bis zum Bau von Dämmen und der Renaturierung von Flusslandschaften steht dafür eine breite Palette von Maßnahmen zur Verfügung. Entscheidend ist nicht ein einmaliges katastrophales Ereignis, der große Zusammenbruch, sondern die zahlreichen, auf unterschiedlichen Ebenen und in unterschiedlichen Formen stattfindenden Auswirkungen eines sich rapide wandelnden Klimas.
Diese zu bekämpfen, wird für die nächste Zeit zu einer zentralen Aufgabe der Gesellschaften werden: ein Dauerzustand, der selbst von Systembrüchen, individuellen Krisen und immer wieder auftauchenden Katastrophen begleitet sein wird, aber nicht mit diesen deckungsgleich ist.
Der vermeintlich schwache und beschönigende Begriff des Klimawandels erweist sich bei genauerer Betrachtung als der realistische und damit eigentlich starke Terminus. Im Begriff des Wandels steckt eine Unerbittlichkeit, die ziemlich präzise beschreibt, was in Klimafragen auf uns zukommt. Selbst wenn es gelingen sollte, die CO2-Emissionen in den nächsten Jahrzehnten radikal zu senken, selbst wenn, was in den Sternen steht, die Energiewende in einem globalen Maßstab angesichts einer weiter wachsenden Erdbevölkerung durchgesetzt werden könnte, werden die Folgen der Industrialisierung für viele Generationen den Umgang mit Natur und Klima weiterhin bestimmen. Wir werden uns in mannigfacher Weise an den Klimawandel anpassen müssen: technisch, ökonomisch, sozial, kognitiv. Das wird der Zustand unserer Welt sein.
Zu einer Krise gehört jedoch ihr Ende; gehört das Wissen, dass etwas überstanden wurde, dass man, wie man es etwa von Krankheitsverläufen kennt, über das Ärgste hinweg oder über den Berg ist. Dass man eine Krise durchgemacht hat, zeigt sich an der bewusst erlebten, neuartigen Form eines Danach. Manche Krisen — denken wir an die Pandemie — müssen durch politische Signale beendet werden, um allen klarzumachen, dass wir jetzt in einem Danach leben. Ob dieses nichts anderes sein konnte als das alte Davor, ist ein Streitpunkt, der — noch — nicht zu entscheiden ist. Aber Krisen, und auch dies ist ein unterschätzter Aspekt, zeitigen prinzipiell ein regressives Moment: Wir möchten oft zu dem Zustand zurückkehren, aus dem uns die Krise schmerzhaft gerissen hat. Krisenbewältigungsrhetorik ist deshalb fast notwendigerweise mit nostalgischen Rückblicken verbunden, mit der Sehnsucht nach einer Zeit, in der die Welt vermeintlich noch in Ordnung war. Man achte einmal darauf, mit welch einer verklärenden Inbrunst Klimaaktivisten die Formulierung »vorindustrielles Zeitalter« verwenden: Der Spätfeudalismus, in dem neunzig Prozent der Menschen mühselig von einer kargen Landwirtschaft lebten und in jedem Winter Unzählige erfroren, wird zu einem Idealzustand erklärt, in dem bei allem Elend und aller Not das Allerwichtigste gestimmt hat: Der CO2-Gehalt war niedrig, und die Temperaturen lagen deutlich unter den heutigen Werten.
Wann aber weiß man genau, dass man von einer Krise betroffen ist, eine Krise erlebt, durch eine Krise durchmuss? Vom deutschen Philosophen Georg Wilhelm Friedrich Hegel stammt die sinnige Bemerkung, dass man erst dann weiß, wann etwas begonnen hat, wenn es zu Ende ist. Die Menschen, die den »schwarzen Freitag« des Jahres 1929 erlebten, wussten nicht, dass dies der Beginn eines der furchtbarsten Kapitel der neueren Geschichte war. Die Menschen, die im Jahr 2022 den Überfall einer atomaren Großmacht auf ihr europäisches Nachbarland erlebten, wissen noch immer nicht, welche Seite im Buch der Geschichte damit aufgeschlagen wurde. Erst im Rückblick werden wir erkennen, ob überhaupt und in welcher Krise wir uns in den zwanziger Jahren des 21. Jahrhunderts befunden haben.
Diese Überlegung ist keine unnötige geschichtsphilosophische Spekulation, denn sie zeigt, dass die Einschätzung der Lage und, davon abhängig, die Frage, was zu tun sei, selbst in hohem Maß Spekulation ist. Wann ist eine gesellschaftliche oder politische Verwerfung oder Turbulenz eine Krise? Wenn die Börsenkurse abstürzen? Wenn das Wirtschaftswachstum zurückgeht? Wenn die Inflation steigt? Wenn die Arbeitslosenrate zunimmt? Wenn in Umfragen Angst und Zorn bekundet werden? Wenn Populisten Wahlen gewinnen? Oder ist eine Krise erst eine Krise, wenn es politische Radikalisierung, Gewaltrhetorik, ständige Massendemonstrationen, Barrikaden, Streiks, Plünderungen, geschlossene Geschäfte und Banken, brennende Stadtviertel, Bürgerkriege und Kriege gibt? Weil wir keine verlässlichen Indikatoren haben, um das Ausmaß und den Charakter der Krise festzustellen, haben wir keine wirklich plausiblen Theorien über die Ursachen dieser Krise. Das eröffnet viel Raum für politische, aber auch psychologische Scharlatanerie. Jeder kann die Ursache einer Krise dort sehen, wo es ihm gerade beliebt, und danach seine Therapievorschläge ausrichten. Denken wir an die Finanzkrise des Jahres 2008, von der manche befürchten, dass sie sich jederzeit wiederholen kann, und die dafür angeführten Ursachen: der unregulierte Finanzsektor, die Gier der Manager, die Gier der kleinen Anleger, die faulen Kredite der Amerikaner, der Kasinokapitalismus, eine falsche Industriepolitik, zu viel oder zu wenig Staat, zu viel oder zu wenig privat, das Versagen der Märkte oder der Eingriff in diese. Die Liste ließe sich fortsetzen und spiegelte doch nur die Interessen derjenigen wider, die sich mit der einen oder anderen Vermutung dazu äußern. Ähnliches gilt für die Wirtschafts- und Energiekrise unserer Tage: Sollte diese tatsächlich gravierende soziale und politische Folgen haben, wird man noch in Jahrzehnten darüber streiten, was nun die tieferen Ursachen und die eigentlichen Auslöser waren; sollte diese Krise nach einer kurzen Rezession wieder zu einer Erholung der Wirtschaft und zur Fortsetzung des Üblichen führen, wird sie nicht viel mehr als eine Fußnote für die Diskurse der Zukunft abgeben.
Bleiben wir kurz bei der Wirtschaft: Was muss sich so verändern, dass wir von einer Krise sprechen können? Konjunkturzyklen und damit verbundene steigende oder sinkende Zahlen von Arbeitslosen, platzende Spekulationsblasen, das Auf und Ab an den Börsen, Insolvenzen und Neugründungen von Unternehmen, stagnierende oder sinkende Wachstumsraten: All das gehört zum Alltag des Kapitalismus. Früher sagte man, dass der Kapitalismus nicht nur krisenanfällig ist, sondern geradezu von krisenhaften Zyklen lebt — von der Tulpenmanie der 1630er Jahre bis zu den Krisen des 21. Jahrhunderts. So gesehen wäre die Krise des Kapitalismus keine Krise, sondern seine Normalität. In den vergangenen Jahren haben wir uns aber gerne einreden lassen, dass es gelungen sei, dieser Krisenanfälligkeit Herr zu werden, und dass die Normalität des Kapitalismus ein ständiges Wachstum sei, von dem alle, die einen mehr und schneller, die anderen langsamer und weniger profitieren. Kaum einer der renommierten Wirtschafts-, Trend- und Zukunftsforscher hatte deshalb die aktuellen Krisen kommen sehen, sie gehörten nicht mehr zum Bild unserer Welt. Man könnte etwa zugespitzt formulieren: Was jetzt geschieht, ist die Rückkehr zu einer vergessenen Normalität, die von großen sozialen, ökonomischen und energietechnischen Unsicherheiten geprägt war. Und diese Normalität erleben wir paradoxerweise als Krise.
Diese paradoxe Rückkehr zur »Normalität« zeigt sich in vielen Bereichen der Gesellschaft. Es gibt nicht wenige Beobachter, die den Ausbruch der Pandemie und den Krieg Russlands gegen die Ukraine nicht als den großen Zusammenbruch funktionierender Ordnungen, als schrecklichen Ausnahmezustand diagnostizieren, sondern als Rückkehr zu einer Verfasstheit, die wir in einer verwöhnten Epoche vergessen hatten: Krieg gehörte in Europa bis 1945 zum Alltag, und Pandemien waren seit der Antike periodisch auftretende Begleiterscheinungen des Lebens. Krisen, wenn es welche sind, holen auch die Fiktionen und Illusionen einer Gesellschaft zurück auf den Boden der Realität. Dafür muss man allerdings den Blick schärfen.
Die Unsicherheit, wie wir die Gegenwart verstehen sollen, drückt sich in letzter Instanz in unserem Verhalten aus. Würden Krisen an die Wurzeln unseres Systems reichen — was nicht ausgeschlossen werden kann —, müssten wir versuchen, mit einer prinzipiellen Kritik des Kapitalismus darauf zu reagieren. Vor allem in der radikalen Klimabewegung ist dieser Gedanke weit verbreitet: Der Klimawandel kann nur aufgehalten werden, wenn es zu einem Systemwechsel kommt und eine Ökonomie des Verzichts auf Wachstum sowie eine staatlich kontrollierte Verteilungsgerechtigkeit an die Stelle der Marktwirtschaft tritt.5 Die Geschichte hat uns aber in dieser Hinsicht die Hände gebunden. Die furchtbaren Erfahrungen, die die Menschheit mit allen Versuchen, den Kapitalismus zu überwinden, gemacht hat, erlauben es uns nicht mehr, blauäugig an einer großen Alternative zu basteln, obwohl sie natürlich denkmöglich wäre. Der Kapitalismus ist kein Naturgesetz, auch wenn das manche seiner Apologeten gerne so sähen, und sich wegen des Scheiterns realsozialistischer Experimente die Lektüre von Marx zu ersparen, ist nicht besonders klug. Aber am historischen Horizont zeichnet sich keine Perspektive einer Überwindung des Kapitalismus ab. Realistischer wäre wohl der Versuch, jene Balancen zwischen privaten Interessen und öffentlichem Wohl, zwischen Markt und Staat, zwischen individueller Freiheit und sozialer Sicherheit, zwischen schrankenloser Gier und verantwortungsbewusster Mäßigung, zwischen Naturbeherrschung und ökologischer Sensibilität, an denen es offenbar mangelt, wiederzufinden oder überhaupt erst herzustellen. Dazu aber gehört auch ein Bewusstsein von Grenzen und von Differenzen, von Unterschieden und ihrer Bedeutung jenseits aller wohlfeilen Moral.
Systeme gelangen nicht nur durch ihre immanente Widersprüchlichkeit in eine Krise, wie es die klassische Kapitalismustheorie marxistischer Provenienz vermeinte, sondern durch das Auftauchen neuer, bisher unbekannter oder vernachlässigter Faktoren. Private Systeme, etwa eine Paarbeziehung, können durch die Erscheinung eines Dritten in eine Krise geraten, die keinen Beteiligten verschont. Goethes Erfolgsroman Die Leiden des jungen Werthers hat dies paradigmatisch vorgeführt. Der Dritte als entscheidender Krisenfaktor wurde bislang unterschätzt. Das Gleichgewicht in einem System, das einer binären Logik gehorcht, wird durch den Einbruch eines Dritten empfindlich gestört. Der manchmal wohl zutreffende Hinweis, dass an einer Beziehung schon etwas defekt gewesen sein muss, damit sie durch einen Dritten aus dem Gleichgewicht gebracht werden kann, verkennt die Kraft, die vom Neuen, Unerwarteten, Ungewohnten ausgehen kann. Das Coronavirus etwa brachte die empfindliche Balance zwischen den Bedürfnissen von Patienten und den Möglichkeiten des Gesundheitssystems an den Rand des Zusammenbruchs und provozierte so erst ein Krisenbewusstsein als gesellschaftliche Dimension — und dies gilt selbst dann, wenn man im Nachhinein klüger geworden ist und die Maßnahmenkataloge der Regierungen einer berechtigten Kritik unterziehen kann.
Disruptive Entwicklungen sozialer Systeme oder technische Innovationen zählen ebenfalls zu den Irritationen, die Krisen aufbrechen lassen. Das jüngste Beispiel wäre der Siegeszug der künstlichen Intelligenz, der an mehreren Stellen gesellschaftliche Funktionsweisen in Frage stellt. Im Bildungsbereich etwa wird das Verhältnis zwischen Lehrer und Schüler dadurch empfindlich gestört, denn nun geht es nicht mehr um den Schwindel oder Betrug als unzulässiges und sanktionierbares Manöver etwa bei Prüfungen, sondern um die technisch induzierte systematische Substitution einer individuellen Leistung durch eine billige, automatisierte Alternative. Die Formen schulischer Leistungen und ihrer Kontrolle, wie sie sich in den letzten Jahrzehnten entwickelt haben — eigenständige Haus- und Projektarbeiten, vorwissenschaftliche Arbeiten, kompetenzorientierte Abarbeitung von Arbeitsaufträgen —, werden mit einem Schlag obsolet. Damit aber wird ein bei allen Wandlungen tradierter Bildungsbegriff zur Disposition gestellt.
Krise bedeutet, und damit schließt sich der Kreis, den Zusammenbruch einer etablierten Ordnung zu erfahren und nicht zu wissen, wie es im Moment weitergehen kann.
Was nun? Das ist die Frage, die sich auch angesichts der Erfolgsmeldungen der KI stellt. Ein Moratorium fordern die einen, strenge Regeln die anderen, stürmischen Fortschritt die Dritten. Und wie bei jeder Krise stehen dystopische Ängste in Konkurrenz zu den Hoffnungen derjenigen, die auch in dieser Krise ihre Chance auf neue Märkte und einen Wettbewerbsvorteil wittern. Und darin zeigt sich die letzte Paradoxie der Krise. Der Satz, dass in jeder Krise eine Chance läge, stimmt zwar, er ist aber unpräzise formuliert. Eigentlich müsste es heißen: Die Krise der einen ist immer die Chance der anderen.
Falsch gewählt
Die Krise der parlamentarischen Demokratie
In seiner umstrittenen Rede im Rahmen der Münchener Sicherheitskonferenz im Februar 2025 sagte der amerikanische Vizepräsident J. D. Vance unter anderem Folgendes: »Und das ist für mich die große Magie der Demokratie. Sie liegt nicht in diesen steinernen Gebäuden oder schönen Hotels. Sie liegt nicht einmal in den großartigen Institutionen, die wir als gemeinsame Gesellschaft aufgebaut haben. An die Demokratie zu glauben bedeutet zu verstehen, dass jeder unserer Bürger Weisheit besitzt und eine Stimme hat. Und wenn wir uns weigern, diese Stimme zu hören, werden selbst unsere größten Erfolge nur wenig Bestand haben.«1 Die Empörung, die diese Ansprache ausgelöst hat, mag man für berechtigt halten, der Vorwurf, dass Vance einen Respekt vor der Demokratie einfordert, den sein Präsident nach den verlorenen Wahlen des Jahres 2020 schmerzlich vermissen ließ, trifft allemal. Dennoch berührte Vance mit diesen Sätzen einen heiklen Punkt: Der Begriff der Demokratie unterliegt seit geraumer Zeit einem Erosionsprozess, der vermeintliche Gewissheiten in Frage stellt und es zunehmend schwieriger macht, die Grundlagen, Verfahren und Konsequenzen einer demokratischen Ordnung zu bestimmen.
In Deutschland und in Österreich hat es sich in Qualitätsmedien und im öffentlich-rechtlichen Rundfunk eingebürgert, zwischen »demokratischen« und »nichtdemokratischen« Parteien zu unterscheiden, wobei betont werden muss, dass Letztere aufgrund von freien und geheimen Wahlen in den Parlamenten vertreten sind und zwischen zwanzig und dreißig Prozent der Wähler hinter sich versammeln. Bei aller berechtigten Besorgnis über radikale und extremistische Tendenzen in diesen Parteien — sie sind, weil sie bisher offenbar im Rahmen von Verfassung und Grundgesetz agieren, nicht verboten, also legitimer Bestandteil des demokratischen Spektrums. Bis zu einem Drittel einer Wählerschaft diese Legitimation abzusprechen und damit indirekt zu signalisieren, dass sie falsch, weil undemokratisch gewählt hätte und ihre Stimme deshalb keine Berücksichtigung finden darf, mag aus einer ehrlichen Besorgnis um das Wohl der Demokratie gespeist sein, vielleicht aber auch nur die Angst vor einem möglichen Machtverlust zum Ausdruck bringen — bei beiden Motiven steht ein Eckpfeiler der modernen Demokratie zur Disposition: das Parlament. Dessen Zusammensetzung verdankt sich einem einzigen Akt: einer Wahl. In einer Demokratie kann man aus diesem Grund nicht falsch wählen, man kann immer nur anders wählen. Dem Wähler die Wahl zu erleichtern, indem Parteien, die nicht erwünscht sind, verboten werden, sollte in einer Demokratie eine Ultima Ratio sein. Polemische, zugespitzte und fragwürdige Äußerungen einzelner Funktionäre geben dafür noch keine Grundlage ab.
Zeit, wieder einmal über die zugrunde liegenden Prinzipien des Parlamentarismus nachzudenken. Diese erscheinen zunehmend interpretationsbedürftig, auch jenseits aktueller Krisen. Wir dürfen nicht vergessen: Idee und Wirklichkeit der Demokratie gibt es seit 2500 Jahren. Die Gestalt dieser Regierungsform hat sich jedoch vielfach gewandelt. Von der selbstbewussten Herrschaft der Bürger, wie sie die antike Polis zeitweilig bestimmte, über die römische Res publica bis zu den neuzeitlichen Formen der repräsentativen Demokratie reichen die Varianten einer Konzeption, die, und das scheint entscheidend, Politik als eine öffentliche Angelegenheit und Herrschaft als eine vom Volk legitimierte und kontrollierte Form der begrenzten Machtausübung verstanden haben wollte. Was zur Debatte steht, ist die Frage, ob die Form der Demokratie, wie sie sich seit 1945 durchsetzen konnte, nicht angesichts fundamentaler gesellschaftlicher, sozialer, technologischer und politischer Veränderungsprozesse grundsätzlich in Bedrängnis und in eine Krise geraten muss — jenseits des zeitweiligen Aufstiegs von populistischen Parteien.
Es geht dabei nicht darum, die Funktionsunfähigkeit oder gar das Ende der Demokratie zu beschwören, sondern darum, die Gründe für einen Transformationsprozess zu benennen, dem sich die Demokratie ausgesetzt sieht und der ihre Gestalt verändern könnte. Zumindest scheint es Indizien dafür zu geben, dass der modernen Demokratie in ihrer repräsentativ-parlamentarischen Gestalt einige — nicht alle — Bedingungen abhandenkommen, die ihren Erfolg und ihre Attraktivität ausmachten.
Historisch gesehen sind die westlichen Demokratien und ihre Instrumentarien aus der Defensive entwickelt worden, um die Ansprüche des feudalen Herrschers einzuschränken und zu kontrollieren. Die Geschichte des europäischen Parlamentarismus reicht bis ins englische Mittelalter zurück. Der Begriff »Parlament«, der sich vom altfranzösischen »Parlement«, von der Unterredung ableitet, beschreibt gut die damit verbundene ursprüngliche Aufgabe: Die Vertreter der sozialen Stände, später des Volkes beziehungsweise der politischen Parteien sollen im Gefüge der Macht zuerst eine beratende, dann kontrollierende, schließlich aktive politische Rolle spielen. Das Gespräch, die abwägende Besinnung, das deliberative Element gehören zum Wesen dieser Einrichtung, nicht der Streit, der Disput oder gar der physische Kampf. Im Parlament realisiert sich eine diskursive Vernunft, die sich als Verwalterin der allgemeinen Interessen und des Interesses des Allgemeinen versteht. Darin liegt auch die Würde des in Österreich mit Recht so genannten Hohen Hauses: dass es eben keine Arena ist, in der die Machtansprüche partikularer Interessen ausgefochten werden, sondern ein Raum, in dem sich eine Gemeinschaft bei allen Unterschieden und divergierenden Interessen als ein Ganzes artikulieren kann.
Reden aber ist nicht gleichbedeutend mit Handeln. Der defensive, kritische, kontrollierende Charakter des Parlaments passt nicht zum modernen Anspruch der Legislative, selbst ins Zentrum der Macht zu rücken. Das Telos der Demokratie, so könnte man überspitzt formulieren, war nicht die Revolution, sondern die Konstitution, war nicht die Macht, sondern die Rahmung der Macht. Das bedeutet aber, anders formuliert: Der parlamentarische Apparat ist strukturell entscheidungsverzögernd und machtblockierend, nicht von sich aus aktiv und entscheidungsfreudig. Das war in konstitutionellen Monarchien lange ein Vorteil, der in starken Präsidialdemokratien wie den USA noch immer zu spüren ist. Es fragt sich aber, ob in Zeiten der Krise, in denen rasche und vor allem für große Bevölkerungsteile unangenehme, gar schmerzhafte Entscheidungen getroffen werden müssen, dies nicht kontraproduktiv wird und zu Lähmungserscheinungen führt, über die heute allenthalben geklagt wird.
Parlamentarische Demokratien gelangen in solchen Situationen in ein veritables Dilemma: Wird von der Regierung ohne Zustimmung des Parlaments entschieden, gilt dies als Abgleiten in autoritäre Verhältnisse; wird das Parlament beigezogen und verzettelt es sich in kleinlichen Debatten, gilt es als gefährlicher Bremser angesichts einer bedrohlichen Situation. Gerade die Ereignisse der Jahre 2020 und 2021, die von der Coronapandemie beherrscht waren, zeigten, dass Demokratien, wenn auch in unterschiedlicher Art und Weise, mit komplexen parlamentarischen Verfahren sehr wohl in der Lage waren, rasche Entscheidungen zu treffen, ohne ihre Grundsätze zu verraten und den Boden der Rechtsstaatlichkeit zu verlassen. Dass angesichts großer Unsicherheiten schwere Fehler gemacht werden, dass das Abwägen unterschiedlicher Interessen alles andere als einfach ist, dass parteipolitische Rücksichtnahmen mitunter den Blick auf das Gemeinwohl empfindlich trüben können, dass die Rolle von Experten, Wissenschaftlern, Beratern und Lobbys alles andere als eindeutig ist, gehört zu den Unzulänglichkeiten demokratischer Prozesse, die man nicht beschönigen sollte. Perfektion zählt nicht zu den Eigenschaften der Demokratie. Das bedeutet nicht, solchen Defiziten gegenüber nachlässig zu werden, sondern im Gegenteil, das kritische Sensorium für diese zu schärfen.
Der klassische Parlamentarismus gerät auch aus anderen Gründen unter Druck. Mit der zunehmenden sozialen Mobilität geht ein gravierender Wandel der politischen Öffentlichkeit einher. Diese war bisher von einer Parteienlandschaft geprägt, die ihre Grundstruktur ebenfalls aus dem 19. Jahrhundert bezog und an die Trennung der Gesellschaft in deutlich abgrenzbare soziale Klassen und Schichten anknüpfte. Die Partei, die Sitz und Stimme in einem Parlament hat, sollte aber wissen, dass sie als Partei — wie der Name sagt — Teil eines Ganzen ist, nicht dieses selbst. Diese sozial- und weltanschaulich gebundenen Parteigängerschaften lösen sich in dem Maße auf, in dem moderne Menschen in entwickelten Gesellschaften nicht mehr auf eine eindeutige Interessenlage festgelegt werden können. Der Verlust dieser Bindungen führt nicht nur zur Bildung wechselnder Identitäten, sondern auch zur Suche nach anderen, oft reaktivierten alten Bindungen und freiwilligen oder auferlegten neuen Identitätszuschreibungen. Die heute forcierte Identitätspolitik stärkt auf der einen Seite ethnische, soziale und andere Minderheiten, beschleunigt aber auf der anderen Seite die Fragmentierung der Gesellschaft, die sich zunehmend angestrengter darüber verständigen muss, was das allen Gemeinsame nun eigentlich sei.
Die Idee der repräsentativen Demokratie besagte, dass, weil alle Menschen gleich sind, sie von einem Parlament repräsentiert werden können: Einer kann den anderen vertreten, weil Menschen bei allen Unterschieden sich in den politisch entscheidenden Belangen nicht voneinander unterscheiden. Es sind vernunftbegabte Wesen, die sich über die Art und Weise ihres Zusammenlebens in einer von allen gewollten Gemeinschaft verständigen können. Diese Idee setzt einen Universalismus voraus, der in einer von Immanuel Kant prägnant formulierten Einsicht wurzelt: Das Wesen der menschlichen Vernunft besteht darin, sich an die Stelle eines jeden anderen denken zu können. Die Würde und Größe eines Parlaments bestünde in der täglichen Einlösung dieser Ansprüche.