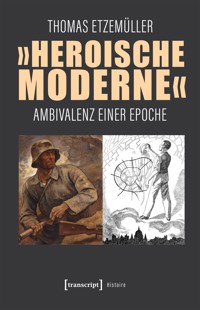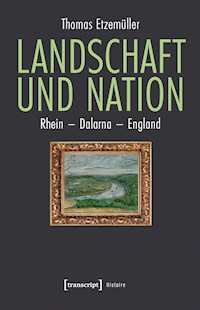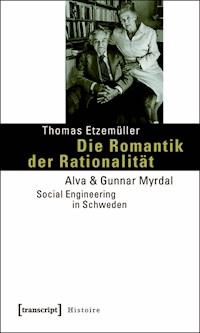Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Campus Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Historische Einführungen
- Sprache: Deutsch
Biographien werden von Historikern erforscht, geschrieben oder als Quellen benutzt. Thomas Etzemüller unternimmt einen Streifzug durch die historische, soziologische und literaturwissenschaftliche Biographieforschung. Dabei macht er deutlich, dass die Lebensgeschichte eines Menschen ein komplexes Konstrukt ist. Hinzu kommt ein »biographisches Paradox«: Philosophen und Soziologen beschreiben den Menschen als fragmentiertes Wesen, das Genre der Biographie aber erfordert die narrative Einheit eines Lebenslaufs von der Geburt bis zum Tod. Wie Historiker mit diesem Widerspruch umgehen können, ist ein zentrales Thema dieser Einführung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 282
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Thomas Etzemüller
Biographien
Lesen – erforschen – erzählen
Campus VerlagFrankfurt/New York
Über das Buch
Biographien werden von Historikern erforscht, geschrieben oder als Quellen benutzt. Thomas Etzemüller unternimmt einen Streifzug durch die historische, soziologische und literaturwissenschaftliche Biographieforschung. Dabei macht er deutlich, dass die Lebensgeschichte eines Menschen ein komplexes Konstrukt ist. Hinzu kommt ein "biographisches Paradox": Philosophen und Soziologen beschreiben den Menschen als fragmentiertes Wesen, das Genre der Biographie aber erfordert die narrative Einheit eines Lebenslaufs von der Geburt bis zum Tod. Wie Historiker mit diesem Widerspruch umgehen können, ist ein zentrales Thema dieser Einführung.
Historische Einführungen
Herausgegeben von Frank Bösch, Angelika Epple, Andreas Gestrich, Inge Marszolek, Barbara Potthast, Susanne Rau, Hedwig Röckelein, Gerd Schwerhoff und Beate Wagner-Hasel
Band 12
Über den Autor
Thomas Etzemüller, Dr. phil., ist außerplanmäßiger Professor für Neuere und Neueste Geschichte an der Universität Oldenburg.
Inhalt
1.Einleitung
1.1. Ein überraschend komplexes Genre
1.2. Die Popularität der Biographie
1.3. Was ist eine Biographie?
2. Sechs Beispiele
2.1. Julia Scialpi: Der Kulturhistoriker Richard Benz (2010)
2.2. Alain Corbin: Auf den Spuren eines Unbekannten (1999)
2.3. Peter Gathmann/Martina Paul: Narziss Goebbels (2009)
2.4. Wolfgang Weber: Priester der Clio (1984)
2.5. Yvonne Hirdman: Alva Myrdal (2008)
2.6. Alain Boureau: Kantorowicz (1992)
3. »Biographiegeneratoren«
3.1. Das Selbst
3.2. Der Lebenslauf
3.3. Ego-Dokumente
3.4. Die »Sonde«
4. Die Performanz der Quellen
4.1. Quellen lesen
4.2. Nachlässe
4.3. Selbstzeugnisse
4.4. Bilder
5. Konstruktionen der Biographie
5.1. Perspektiven
5.2. Auslassungen
5.3. Narrative
5.4. Paratexte
6. Biographien und die Ordnung der Gesellschaft
6.1. Funktionen
6.2. Effekte
6.3. Biographien als Quellen lesen
7. Das biographische Paradox
7.1. Anti-Biographien
7.2. Fragmentierung des Subjekts, Einheit des Genres?
8. Schluss: Konsequenzen für Biographen
Dank
Literatur
Register
Kapitel 1Einleitung
1.1. Ein überraschend komplexes Genre
Es gibt eine eigene Wissenschaft, die sich mit Biographien beschäftigt, die Biographieforschung. Sie ist mittlerweile derart ausdifferenziert, dass es unmöglich ist, einen auch nur halbwegs umfassenden Überblick über diesen Forschungszweig zu geben. Um das zu begreifen, reicht ein Blick in das Inhaltsverzeichnis einer der jüngsten Publikationen zu diesem Thema, das 2009 erschienene Handbuch Biographie (Klein 2009). Auf knapp 500 zweispaltigen Seiten werden 59 Themenfelder in knappen Artikeln skizziert, etwa die Begriffsbestimmung, die Frage, ob die Biographie eine Gattung sei, das Problem der Fiktionalität, die Biographiewürdigkeit oder gar Rechtsfragen der biographischen Arbeit. Das Handbuch macht deutlich, dass sich Biographien in der Antike, im Mittelalter oder der Neuzeit signifikant unterscheiden, dass es unterschiedliche nationale Traditionen biographischen Schreibens gibt, dass die wissenschaftlichen Disziplinen ihre eigenen biographischen Methoden und Fragestellungen entwickelt haben, dass Institutionen ihre ganz eigentümlichen biographischen Texte generieren oder dass schließlich biographisches Erzählen in Medien, Kunst, Alltag, Wissenschaft oder Literatur unterschiedliche Formen annimmt und verschiedenen Zwecken dient. Spätestens nach der Lektüre dieses Standardwerkes macht es keinen Sinn mehr, von der Biographie zu sprechen. Die Biographie gibt es nicht – doch ist sie ein jahrhundertealtes Genre, das sich hinreichend scharf gegen andere Textgattungen abgrenzen lässt. Und dieses Genre zeichnet sich durch Eigentümlichkeiten und bestimmte Probleme aus. Ich werde mit dieser Einführung nicht versuchen, das Handbuch Biographie (und die übrige Forschungsliteratur) zusammenzufassen oder gar zu ersetzen. Vielmehr werde ich aus der Perspektive des Historikers und gestützt auf die jüngere Biographieforschung einen Einblick in die Vielfalt und Charakteristika des Genres geben.1
Ich selber habe nie eine Biographie geschrieben. Aber ich habe in mehreren Forschungsprojekten die biographische Methode genutzt, sei es, um wissenschaftssoziologisch und mikrohistorisch, wie in einer Laborstudie, den Arbeitsprozess von Historikern zu beschreiben, sei es, um das social engineering im europäischen 20. Jahrhundert zu untersuchen. Der biographische Zugriff dient mir als »Sonde«, um das Funktionieren der Gesellschaft zu verstehen. Dabei ist mir immer deutlicher geworden, dass Biographien erstaunlich komplexe Textformen sein können. Sie informieren nicht einfach möglichst vollständig und wahrhaftig über das Leben einer Person – auch wenn das viele Biographen und Leser glauben mögen –, sondern sie werden durch ihre Autoren und deren Leser gestaltet. Sie basieren zwar auf Quellen, können Historikern aber selbst als Quelle dienen. Sie sollen nicht immer die Neugierde von Lesern befriedigen, sondern oft nur persönlichen oder administrativen Zwecken dienen. Sie beschreiben nicht allein einen Ausschnitt der Welt, sondern können durchaus eine prägende Wirkung auf die Welt ausüben. Außerdem vermögen sie es, allzu einfache Vorstellungen von der Realität infrage zu stellen.
In dieser Einleitung umreiße ich den Gegenstand und seine fortdauernde Attraktivität und nehme eine provisorische Begriffsklärung vor. Dann soll die Problematik in sechs Kapiteln aufgefächert werden. In Kapitel 2 werden sechs Biographien beispielhaft vorgestellt, die narrativ unterschiedlich aufgebaut sind und den Lesern ihren Gegenstand auf divergierende Weise und mit unterschiedlichen Absichten präsentieren. Kapitel 3 behandelt die Frage, welche gesellschaftlichen Institutionen als »Biographiegeneratoren« wirken und wie die von ihnen produzierten biographischen Texte mit ihren Objekten, den Menschen, umgehen. Im Mittelpunkt werden der Unterschied zwischen »Lebenslauf« und »Biographie« sowie Subjektivierungsprozesse stehen. In Kapitel 4 wird es dann um die »Performanz« der Quellenproduktion gehen, durch die Lebensläufe in Biographien transformiert werden. Die Quellen werden nicht einfach in der Realität vorgefunden, sondern, beispielsweise im Falle der Nachlassbildung, von Zeitzeugeninterviews, Bildern oder Ego-Dokumenten, in sozialen Prozessen produziert; die Art ihrer Entstehung hat Einfluss darauf, wie eine Biographie geschrieben wird. Im Anschluss daran führt Kapitel 5 aus, warum man die durchaus verbreitete Annahme aufgeben sollte, man müsse nur Quellen auswerten, Fakten erheben und könne dann das Leben eines Menschen nachzeichnen. Auch biographische Texte werden konstruiert, und zwar durch biographische Modelle und Traditionen, spezifische Narrative sowie Leerstellen. Es wird deutlich werden, dass weder Leben sich einfach vollziehen noch Texte diese Leben bloß abbilden, dass vielmehr die Genese eines Subjekts sich in Leben und Text parallel vollzieht. Zwischen Lebenslauf und Biographie besteht ein zirkulärer Konnex. Kapitel 6 spürt deshalb den Wirkungen nach, die Biographien auf die soziale Ordnung der Gesellschaft haben können. Über den Unterhaltungswert hinaus haben sie beispielsweise das Potenzial, Hierarchien und Geschlechterverhältnisse festzuschreiben. Damit ist zugleich ein zentrales Problem der Biographie berührt, das in Kapitel 7 schließlich untersucht wird, nämlich das der Einheit eines Genres und der Differenz ihres Objektes: Wie passen eine Textform, die auf die unhinterfragbare Einheit eines Individuums setzen muss, und aktuelle Theorieansätze, die gerade von einer weitgehenden Fragmentierung aller Individuen ausgehen, zusammen? Wenn Subjektivität und Körper im Extremfall künftig aus frei wählbaren Versatzstücken und gar technischen Ersatzteilen bestehen sollten, wäre das nicht das Ende eines Genres, das seit dem 18. Jahrhundert prinzipiell darauf angewiesen ist, kohärente Lebenswege von Individuen nachzuzeichnen, die von der Geburt bis zum Tod psychisch und physisch eine Einheit bilden? Lässt sich eine mögliche Fragmentierung des Menschen durch ein auf die Konstruktion von Kohärenz angelegtes Medium erfassen?
Ich werde also nicht die vielfältigen bisherigen Ergebnisse der Biographieforschung referieren, sondern diese durch eine Problematisierung des Genres Biographie veranschaulichen, indem ich an konkreten Beispielen zentrale Fragen plastisch mache, die die Biographieforschung bislang herausgearbeitet hat beziehungsweise noch herausarbeiten muss. Die einzelnen Beispiele kann ich zwar nicht erschöpfend behandeln, sie dienen aber dazu, Differenzen, Spannbreiten und Möglichkeiten sichtbar zu machen. Mit diesem Vorgehen möchte ich dreierlei erreichen. Die verborgenen Bedingungen, die Biographien entstehen lassen, sollen sichtbar werden. Das Buch soll dadurch eine Anleitung bieten, dieses Genre kritisch zu lesen. Und im Idealfall wird es Biographen Anregungen bieten, mit ihm zu experimentieren. Der Schwerpunkt wird dabei auf biographischen Texten liegen, vor allem auf Monographien, die im 20. Jahrhundert verfasst worden sind. Er wird zudem auf Mechanismen der Konstruktion liegen, da diese Perspektive meine Arbeit als Historiker am stärksten prägt. Aus diesen beiden Gründen werde ich die Historizität des Genres Biographie vernachlässigen, also die Veränderungen, die diese Textform im Laufe von Jahrhunderten erfahren hat, und die man historisch nachzeichnen kann. Dieser Blick macht biographische Texte dann selbst zu Quellen, die die Frage zu beantworten helfen, wie in unterschiedlichen Epochen Menschen sprachlich porträtiert wurden, und wie das zur Subjektbildung von Menschen beitrug. Auch wenn ich einiges also nur anzureißen vermag, so soll es immerhin als Ausgangspunkt dienen, sich tiefergehend mit diesen Fragen zu beschäftigen.
1.2. Die Popularität der Biographie
Besucht man die Filialen größerer Buchhandelsketten, so findet sich in jeder eine mehr oder weniger große Regalwand, die ausschließlich Biographien und Autobiographien enthält, oft davor ein Podest, auf dem die Bestseller des Genres gleich stapelweise präsentiert werden. Schaut man sich dagegen die Geschichte der deutschen Geisteswissenschaften an, stellt man fest, dass Biographien in den 1960er- und 1970er-Jahren für viele Wissenschaftler als überholt oder gar als reaktionär galten (vgl. z. B. Dahlhaus 1975; Schulze 1978; vgl. Quelle Nr. 1 unter www.historische-einfuehrungen.de).
Der Historiker Hans-Ulrich Wehler etwa störte sich an einer Geschichtsschreibung, die Anekdoten chronologisch aneinanderreihe statt überindividuelle strukturelle Entwicklungen zu erklären. »Vorausdenkende Unternehmer, rauchende Schlote, schweißglänzende Arbeiterrücken – derartige Bilder erfassen nicht den Wechsel von Leitsektoren, die Bedeutung von Nettoinvestitionsraten, die Entstehung von Klassenstrukturen, die Härte von Konfliktlagen, die Folgen von Interessenhomogenität« (Wehler 1979b: 58). In technizistischer Manier sprach er von Prüfständen, Kontrollinstanzen, höherer Zuverlässigkeit, bestandenen Tests und den Kontrollchancen des Experiments, also einer Art TÜV, der sich die Geschichte durch Historiker zu unterziehen habe (Wehler 1979a: 37). Sein Kollege Jürgen Kocka wiederum reduzierte das Handeln einzelner Individuen auf einen bloßen »Rest, der sich nicht aus den vorher explizierten Strukturen mit Notwendigkeit ergibt«. Diesen Rest könne man, wenn man denn wolle, beschreiben oder erzählen, verstehen oder »in seiner Faktizität einfach« feststellen – nicht mehr als ein »Akt notwendiger Resignation« (Kocka 1977: 167 f.). Diese Abwertung von Biographien resultiert aus einem geschichtspolitischen Projekt der späten 1960er-Jahre, dem Versuch, die Gesellschaft über ihre strukturhistorischen Voraussetzungen aufzuklären, um zur Emanzipation der Menschen beizutragen – die in der Forschung aber nicht weiter interessierten, im Gegenteil: Der biographisierende Blick – sei es auf »Große Männer« oder »kleine Leute« – behinderte angeblich bloß die Analyse der »wahren« Triebkräfte der Geschichte.
Die Krise der Biographie
Natürlich gab es Widerspruch, und zwar einmal von Publizisten, die sich erfolgreich außerhalb der Fachwissenschaft etabliert und populäre Biographien publiziert hatten: Golo Mann mit seinem Wallenstein (Mann 1971) oder Joachim Fest mit Hitler (Fest 1973). Selbst Universitätshistoriker, dem Hang zur Popularisierung unverdächtig, waren anderer Meinung. Christian Meier legte 1982 eine Lebensgeschichte Julius Cäsars vor, die bis heute als Meilenstein fachwissenschaftlicher Biographik gilt und sich zudem auf dem Markt gut verkauft hat (Meier 1982). Meier ging davon aus, dass das Handeln und Erleben von Menschen von Situation zu Situation erzählend rekonstruiert, das komplexe gesellschaftliche Umfeld dagegen strukturanalytisch erklärt werden müsse (Meier 1979). Jürgen Oelkers hatte dieses Verhältnis so auf den Punkt gebracht: »Gegenstand von Biographien sind Personen in Handlungskontexten, weder nur Personen noch nur Handlungskontexte. Es ist sinnlos, die Dialektik von Individuum und Gesellschaft zu einer Alternative von Individuum und Gesellschaft zu machen«. Aufgabe sei »die Rekonstruktion von historischen Figuren im Verhältnis von Interaktions- und Systemebene mit den je gegenwärtigen Mitteln der historischen Arbeit« (Oelkers 1974: 309).
In der Wissenschaft ist die Biographie mittlerweile auch bei Historikern »rehabilitiert«, ihre Renaissance begann mit Lothar Galls imponierender Bismarck-Studie (Gall 1980), und seither gehört es zum guten Ton, sich über diejenigen zu mokieren, die voreilig den Tod dieses Genres ausgerufen hätten (z. B. Winstel 2009: 9); stattdessen wird sie zur »Königsdisziplin« erklärt (Ullrich 2007). Sie hat ja unbestreitbare Vorzüge. Zuerst entspricht sie der Alltagserfahrung der Leser, dass es handelnde und fühlende Subjekte gibt, die sich in der Welt orientieren müssen. Biographien bieten beispielhafte Lebensläufe, sie können als Maßstab für das eigene Leben dienen oder aber die Vielfalt möglicher Lebensformen auffächern. Zum Zweiten lässt sich die Vergangenheit realer Menschen überaus plastisch darstellen, und sie lädt, analog zu Filmen oder Romanen, zur Identifikation ein – das passiert oft bereits den Biographen selbst, die eine Art persönliches Verhältnis zu den (oft lange verstorbenen) Protagonisten ihrer Forschungsarbeit entwickeln. Drittens, so wurde vermutet, erwächst in den immer unübersichtlicheren und rapideren Umbrüchen der postindustriellen Gesellschaften fast zwangsläufig »eine, vielleicht für immer nostalgische, Sehnsucht nach prägnanten Lebensbildern und Lebensmustern« (Hans Ulrich Gumbrecht, zit. nach Winstel 2009: 10), also eine Sehnsucht nach dem Versprechen, dass individuelles Handeln noch etwas bewirken könne.
Vorzüge und Schwächen der Biographie
Analytisch bietet die Biographie ebenfalls Vorteile. Sie erlaubt es, alle Epochen und alle sozialen Felder – wie etwa Politik, Kunst, Wirtschaft, Wissenschaft, die Geschlechterverhältnisse – zu untersuchen, Längsschnitte durch Epochen zu ziehen, individuelle Kontinuitäten mit strukturellen Veränderungen zu kontrastieren oder aber die Untersuchung von Individuen auf Kollektive auszudehnen, ohne dass Tiefenschärfe verloren geht. Außerdem lassen sich gewisse Grundbedingungen politischer, wissenschaftlicher, künstlerischer oder intellektueller Arbeit ergründen: Wie prägen persönliche Lebenserfahrungen einen wissenschaftlichen oder literarischen Text oder ein politisches Programm? Inwieweit erhöhen traditionale Geschlechterbeziehungen die Produktivität von Männern, weil deren Ehefrauen ihnen den Rücken freihalten, Schreib- und Korrekturtätigkeiten ausführen oder ihre Männer als Musen inspirieren (vgl. Jahn 1996)? Zwar gilt es einigen Wissenschaftshistorikern und Publizisten als irreführend, öffentliches Wirken und bleibende Leistungen durch die alltäglichen Querelen des privaten Lebens erklären zu wollen. »Fragt man«, um einen Rezensenten zu zitieren, »nach der Gewichtung von Politischem und Privatem in den Tagebüchern [Carl Schmitts], so überwiegt eindeutig das Private. Schmitts verquere Liebesgeschichten und seine seltsamen Liebesbedürfnisse sind aus der Warte des historischen Interesses nicht lesenswert. […] Ein tragfähiger Zugriff auf die Lebensgeschichte Carl Schmitts müsste eine Blickachse wählen, die seine Tagebücher als ›Material‹ für die Stufungen in der Werkbiographie dieses bedeutenden Gelehrten nutzt« (Blasius 2011). Doch nicht allein Psychologen werden dieser apodiktischen Abwertung des »Privaten« zugunsten einer Hypostasierung des »Werks« widersprechen. Es gibt hinreichend Biographien, die anschaulich machen, wie sehr die Praktiken des Alltags wissenschaftliche Arbeit und politisches Programm durchdringen können, wie wenig man ein Werk auf reine Manifestationen des Willens oder Intellekts zurückführen kann, welche prägende Rolle vielmehr unbewusste soziale Dispositionen spielen: Selbstbilder, Habitus, Diskurse oder Denkstile. Wer das »Private« als kuriose oder gar eine Art pornographische, für Genese und Verständnis des »Werks« aber bedeutungslose Äußerlichkeit abspaltet, verschenkt analytisches Potenzial – und produziert letztlich Ideologie, indem nämlich ein spezifisches Weltbild festgeschrieben wird: Die Leistungen »Großer Männer« dürfen durch ihren manchmal verqueren Alltag nicht befleckt werden.
Gerade wenn es darum geht, die Gesellschaft über sich selbst, über ihr Funktionieren aufzuklären, haben biographische Studien etwas zu bieten. Ihre Schwächen dagegen liegen im Genre begründet. Wer will, kann es sich einfach machen, als Laie wie als Wissenschaftler. Man braucht ja scheinbar nur Dokumente ausfindig zu machen, sie dem entsprechenden Eigennamen zuzuordnen, sie chronologisch zu ordnen und nachzuerzählen. Selbst erzählerisches Talent, wie es Volker Ullrich für unabdingbar hält (Ullrich 2007), ist beispielsweise für Wissenschaftler, die keine Markterfolge generieren müssen, kaum vonnöten, eher schon reiner Fleiß. Oder es ist, wenn der Markt die rasche Publikation zu einem nächsten Jahrestag einfordert, die Fähigkeit gefragt, unter Zeitdruck flott zu recherchieren und rasch zu schreiben, weniger aber intellektueller Tiefgang. Und so sind zahllose Biographien denn auch aufgebaut, als methodisch unreflektierte Aneinanderreihung sogenannter »Fakten«, die umstandslos dem Eigennamen einer vermeintlich biologisch-psychologisch kohärenten Entität zugeordnet werden. Die Biographie wird leicht zum Gegenteil einer Königsdisziplin. Wer mit relativ wenig intellektuellem Aufwand ein Buch verfassen will, der schreibt eine schlichte Biographie.
Die Macht der Biographie
Dass man es sich nicht einfach machen sollte, deutet Tobias Winstel in einem »Dekalog der biographischen Moral« launig an, besonders in den Geboten VI – »Du sollst im Blick behalten die Überlieferungs- und Rezeptionsgeschichte sowie das wandelbare Bild einer historischen Figur, sie gleichsam als Projektionsfläche erkennen und auf Ablösungen und Aneignungen aufmerksam machen« – und VIII: »Du sollst stets offenlegen, ob die Briefe, Tagebücher oder Testamente, aus denen du dein Wissen hast, womöglich ein inszeniertes und nachgelassenes Selbstbild der biographierten Person transportieren« (Winstel 2009: 16). Damit sind Probleme angerissen, über die sich viele Biographen und vor allem deren Leser kaum Rechenschaft ablegen. Biographien sind nämlich so interessant wie heikel, weil sie einen direkten Einblick in die intimen Seiten eines Menschen verheißen. Deshalb sehen selbst Teenager, die außer ein paar Konzert- und Filmerfolgen noch kaum etwas erlebt haben können, ihre kurze Vergangenheit bereits als Lebensbilanz aufbereitet (z. B. Fuchs-Gamböck/Schatz 2009; Baldwin 2010). Und das Genre ist durch seine vermeintliche Rückbindung an vermeintlich reale Personen derart mit dem Odium der Wahrheit besetzt, dass selbst durch und durch gefälschte Lebensberichte zum Renner werden. Es gibt Phantome, die als Narren einer Institution den Spiegel vorhalten, beispielsweise den SPD-Hinterbänkler Jakob Maria Mierscheid aus dem Hunsrück, Nachfolger Carlo Schmids, den im Bundestag noch niemand gesehen hat, der aber von jungen Kollegen für real gehalten wird, und der die Medien immer wieder mit Falschmeldungen hereinlegt (Müntefering 2010),2 oder aber dramatische Opfergeschichten wie die des drogensüchtigen Gewalttäters James Frey, der Kindersoldatin Senait Mehari oder des Auschwitzüberlebenden Benjamin Wilkomirski, die von der ersten Zeile an erfunden sind – die freilich derart erfolgreich »ein Bedürfnis nach Entsühnung« bedienten, dass bei Aufdeckung des Betrugs »[n]icht nur die Verfasser, auch ihre Leser […] nur zäh, schrittweise und ausgesprochen widerwillig vom Wahrheitsanspruch dieser Fiktionen zurück[wichen]; sie mussten etwas hergeben, was sie ganz offenbar als ihr Eigentum ansahen.« Denn das Opfer stellt »in Aussicht, es könnte, wenn wir das Buch kaufen und lesen, alles wieder gut werden, für ihn wie für uns« (Müller 2008). Der Blick durchs Schlüsselloch oder die therapeutische Funktion: Aus dem ihr zugeschriebenen Abbildcharakter können Biographien eine immense Kraft und sogar irritierende Macht über Menschen beziehen. Gerade deshalb lohnt es sich, über die realitätsstiftende Macht dieses Genres nachzudenken.
1.3. Was ist eine Biographie?
Eine Definition könnte so lauten: »Im Zentrum einer Biographie – hier verstanden als textuelle Repräsentation eines Lebens – steht immer eine reale Person (eher ausnahmsweise auch mehrere). Indem Biographien die Ereignisse aus dem Leben der biographierten Person(en) als eine zusammenhängende Ereignisfolge präsentieren, sind sie Erzählungen […]. Zwar finden sich vereinzelt auch fingierte Biographien, die das Leben einer fiktiven Person zum Gegenstand haben, diese sind aber keine Biographien im engeren Sinne. Biographien zählen mithin zu den faktualen Texten oder auch ›Wirklichkeitserzählungen‹, die eine ganz besondere Rezeptionshaltung evozieren« (Klein 2009: 199). Textform, reale Person, chronologische Erzählung sowie Handlungen (und das Privatleben) eines Individuums kennzeichnen eine Biographie. Das entspricht durchaus der populären Annahme, die Biographie bilde das individuelle Leben ab. Sie ist jedoch nicht tragfähig. Denn der Mensch, wie wir ihn aus unserer eigenen Lebenserfahrung her kennen, und der Text, der dieses Individuum abbilden soll, erweisen sich bei näherem Hinsehen als eher heterogene Dinge. Und um es noch komplizierter zu machen: Es gibt einen engen und einen weiten Biographiebegriff; außerdem bezeichnet der Begriff »Biographie« zugleich ein reales Leben wie die Darstellung dieses Lebens. Um mit der Vielfalt des Genres zu beginnen:
Ein heterogenes Genre
Es gibt unterschiedliche Biographieformen, Helden- und Opferbiographien, die Biographien von Männern oder Frauen, die von Eliten oder »kleinen Leuten«, von Angehörigen unterschiedlicher Professionen, von Migranten, Konvertiten, Aufsteigern oder sich emanzipierenden Individuen, um nur einige wenige zu nennen. Jeder dieser Berichte bedient bestimmte Erwartungen und folgt deshalb narrativ unterschiedlichen Traditionen. Künstlerbiographien beispielsweise stellen tendenziell die Frage von persönlicher Genialität in den Vordergrund, Wissenschaftlerbiographien die Aufopferung im Dienste einer überindividuellen Wahrheit, Lebensgeschichten von Frauen deren zu Unrecht vergessene Leistungen. Natürlich werden Biographien auch geschrieben, um gerade diese Topoi infrage zu stellen, grundsätzlich aber spiegeln sich soziale Differenzen der Gesellschaft in inhaltlichen Differenzen der Texte.
Außerdem muss man unterscheiden, wie viele Personen biographiert werden: ein Individuum, ein (Ehe-)Paar oder eine Gruppe? Die Spannbreite reicht hier von einem detaillierten Lebensbericht über eine Beziehungsanalyse bis hin zu einem dürren Gerüst biographischer Daten Hunderter Personen, die in ihrer Gesamtheit das biographische Muster eines Kollektivs erkennen lassen. Ganz unterschiedlich fallen dementsprechend die biographischen Texte aus, es kann sich um tausendseitige Monographien handeln oder aber um lexikalische Einträge von wenigen Zeilen.
Weiterhin existiert eine ganze Reihe narrativer Formen, etwa (so Hemecker 2009b: 2) der biographische Torso, das essayistische Porträt, die psychoanalytische Fallgeschichte, die Mythographie, die explizit literarische Biographie, die autobiographisch verfahrende biographische Erzählung, polyphone Texte, außerdem die spezifischen Erzählweisen in Internetauftritten, biographischen Spielfilmen (Biopics), Hörspielen, Theaterstücken oder Opern. Ein Essayist präsentiert seinen Gegenstand mit anderen stilistischen Mitteln und aus einer anderen Perspektive als ein Psychoanalytiker seine Fallgeschichte und bereits rein materiell können wir es im einen Fall mit einem Artikel in einer Zeitschrift auf Hochglanzpapier zu tun haben, im anderen mit einem Aktendeckel, gefüllt mit handschriftlichen Notizen auf Umweltpapier. Diese materiellen Formen lesen sich ganz unterschiedlich und zielen auf verschiedene Rezipienten; die narrative Form kann nicht ohne ihre materielle Präsentation gedacht werden.
Die Ziele, denen Biographien dienen können, zeichnen sich ebenfalls durch eine große Spannbreite aus. Sie reicht von der wissenschaftlichen Biographik, die auf Erkenntnisgewinn zielt, über die literarische Biographik, die das Verhältnis von Leben und Schreiben experimentell reflektieren darf, oder die populäre Biographik, die auf Personalisierung, Intimität, Dramatisierung und Anekdoten setzt, sowie fiktionale Metabiographien, die das Bewusstsein schärfen wollen, dass Lebensläufe nur sprachlich/textlich vermittelt zugänglich sind, bis hin zu biographischen Kleinformen wie Lexikonartikeln, Gutachten, Nachrufen, den biographischen Angaben auf einer Homepage oder im Curriculum Vitae eines Bewerbers, dessen Aufgabe es zumeist ist, Erfolge herauszustellen und Lücken zu retuschieren (vgl. Quellen Nr. 2 bis 4 unter www.historische-einfuehrungen.de). Mittelalterliche Heldenviten wollten tugendhafte Leben herausstreichen, die kritische »New Biography« des 20. Jahrhunderts eine unreflektierte Heldenverehrung zerstören. Jenseits dieser Texte gibt es biographische Projekte im Schauspiel oder in der Oper sowie in audiovisuellen Medien, etwa dokumentarische Langzeitbeobachtungen oder Hörspiele. Das ist eine Vielfalt von Medien, die sich biographischer Techniken bedienen; die Skala reicht zudem von einem postulierten strikten Realitätsbezug (Wissenschaft) über Konventionen der akzeptierten Retusche (Curriculum Vitae) bis hin zur reinen Fiktion (Kunst); und es gibt zugleich die Spanne zwischen bewusst auf Homogenität polierten biographischen Gebrauchstexten (in Bewerbungssituationen) und betont fragmentierter Polyphonie (in Hörspielen).
Erschwerend kommt schließlich hinzu, dass auch Geschichten als Biographie firmieren, die definitiv nichts mit lebenden Organismen zu tun haben. Für Jack Miles beispielsweise entstand durch eine sequenzielle, chronologische, explizit literaturkritische Lektüre der Bibel ein Gott, der ausschließlich im Text Handlungen vollbrachte, und der sich dort in einer weit ausgreifenden Bewegung vom Handeln über das Reden zum Schweigen entwickelte. So schrieb Miles die »Biographie Gottes«, um eine historisierende Lesart der Bibel wiederzugewinnen (Miles 1996). Peter Ackroyd wiederum entdeckte ein London, das seit jeher in menschlichen Bildern beschrieben wurde: »Whether we consider London as a young man refreshed and risen from sleep, therefore, or whether we lament its condition as a deformed giant, we must regard it as a human shape with its own laws of life and growth« (Ackroyd 2000: 2). So verfasste er die »Biographie« einer Stadt. Aber sind das noch Biographien? Werden hier Gegenstände in ein erprobtes Narrativ wie in ein Korsett gezwängt, das ihnen nicht passt? Oder firmieren sie nur noch unter einem Begriff, der die Aufmerksamkeitsmechanismen des Marktes bedient?
Das Genre Biographie ist also sehr heterogen. Grundsätzlich geht man jedoch davon aus, dass dem Text (oder Hörspiel etc.) eine eindeutige Entität zugrunde liegt, zumeist ein Mensch, manchmal eben auch Gott oder eine Stadt, aber immer eine vorstellbare, umgrenzte Einheit, die mit einem eindeutigen Eigennamen versehen ist. Gibt es diese Einheit?
Was ist ein Individuum?
Zuerst einmal fällt rasch auf, dass das, was als ein und dasselbe Individuum gilt, in verschiedenen Biographieformen völlig unterschiedliche Gestalt annehmen kann: Von Historikern, Richtern oder Ärzten dürfen wir über ein und dasselbe Individuum höchst abweichende biographische Narrative erwarten. Mehr noch, man kann sogar beobachten, wie eine Biographieform in einer anderen ihren prägenden Niederschlag findet. »Asoziale« Menschen beispielsweise gerieten seit Beginn des 20. Jahrhunderts in Deutschland, Skandinavien oder den USA ins Visier von Sozial- und Gesundheitsbehörden. Es wurden administrative Biographien über das Sozialverhalten dieser Menschen erstellt, um die Notwendigkeit einer (Zwangs-) Sterilisierung festzustellen. »Asozialität« galt als vererbbar, und diese Menschen sollten die Gesellschaft nicht durch ihre Nachkommen infizieren. Einmal (gegen ihren Willen) sterilisiert, konnte das künftige Leben ganz anders aussehen, es konnte sich eine regelrechte Opferbiographie über den Lebenslauf legen. Als unversehrtes Individuum, als behördliches Objekt oder als Opfer konnte ein und dasselbe Subjekt biographisch unterschiedlich vor den jeweiligen Beobachtern und sich selbst auftreten. Das biographische Narrativ der Behörde zerstörte das des unversehrten Individuums und setzte die Genese einer dritten biographischen Erzählung in Gang.
Zugleich wird man die absolute Unterscheidung zwischen einem Individuum und seiner Umwelt, zwischen »Subjekt« und »Strukturen« nicht ohne Weiteres aufrechterhalten können. Zwar wird oft eine »Autonomie« des Individuums angenommen, das sich gegen mehr oder weniger »determinierende« Strukturen behauptet – oder das sogar gleich das Postulat erfüllt: »Männer machen Geschichte« –, doch im Lichte neuerer Theorien und Forschungen erweist sich dieses Modell als zu vereinfachend. Denn wenn man systemtheoretischen und neurobiologischen Forschungen vertraut, sind sowohl Subjekt wie auch Umwelt ohnehin kognitive beziehungsweise kommunikative Konstruktionen psychischer Systeme, das heißt sie existieren nicht an sich, sondern werden im Akt des Beobachtens konstituiert und zugleich überhaupt erst unterschieden. Deshalb sollte man das Individuum nicht einfach als eine ontologische Einheit betrachten, dessen »wahren Kern« ein anderes autonomes Subjekt, der Biograph, freilegen kann, wenn er möglichst viele Details sammelt und zusammensetzt. Unter den verschieden konstruierten Biographien verbirgt sich nicht das eine Subjekt, das die Konstruktion seiner Biographie – wenigstens partiell – determiniert, sondern oft sind es erst »Biographiegeneratoren«: Beichte, Psychoanalyse, Tagebuch, Memoiren, Geständnisse, medizinische Anamnesen, also soziale Institutionen, die den Prozess der Konstruktion einer Biographie in Gang setzen.
Ein Problem bleibt zudem die Frage, wieso man eigentlich ein Individuum über die Zeit hinweg als dasselbe identifizieren soll. Aussehen, Stimmfarbe, Kommunikation (etwa gemeinsame Erinnerungen) oder ein Eigenname, ein ganzes Bündel an Indizien verleiten uns zur Annahme von Identität. Aber das sind Wahrnehmungsprozesse, keine substanziellen Beweise für eine reale Identität. Im Alltag funktionieren derartige Identifikationen zumeist problemlos. Aber zugleich wird im 21. Jahrhundert zunehmend unklar, ob Individuum, Subjekt oder Person noch ohne Weiteres über einen Körper definiert werden dürfen, wenn sich nämlich der Begriff des »Körpers« dank der modernen plastischen und Transplantationschirurgie allmählich, aber sicher auflöst. Ist der Körper, den wir auf einem Bild (oder vor uns) sehen, identisch mit der Person, die durch einen Eigennamen markiert wird? Der Biograph wird sich auf Stilvergleiche, Adressierungen und Unterschriften verlassen müssen, um Identität wenigstens postulieren zu können.
Ohnehin sind die Begriffe »Subjekt«, »Individuum«, »Person« und »Personalität« nicht deckungsgleich. Das Subjekt bezeichnet ein »Ich« als Wollendes, Fühlendes, Handelndes, Sich-selbstbewusst-Gewordenes im Gegensatz zu anderen Subjekten oder Objekten, während es als singuläres Individuum von Beobachtern in Gegensatz zur »Gesellschaft« beziehungsweise zur »Masse« gebracht wird. Die Person ist demgegenüber ein leicht verschobener Beobachtungsmodus für Individuen, sie besteht allein aus denjenigen Attributen, die in der Kommunikation über ein bestimmtes Individuum interessieren. Alles, was Beobachter (zum Beispiel Biographen und deren Leser) nicht interessiert, mag zum Individuum, nicht aber zur Person gehören (Luhmann 1989; 1995). Personalität schließlich ist jene innere Instanz, die ein Subjekt aufbaut, um seinem Denken, Handeln und Wollen in unterschiedlichen Lebenssituationen Struktur, Richtung und Kontinuität zu verleihen. Dadurch wird es Person, eine Einheit, der Berechenbarkeit im Umgang attestiert wird, und die zugleich als Ausdruck einer genuinen Individualität erscheint. Als Mensch wiederum könnte man die basale biologische Einheit, den Körper aus Fleisch und Blut bezeichnen, den wir als Grundlage annehmen müssen, damit »Subjekt« und »Personalität« als soziale Formen der Selbstbeobachtung sowie »Individuum« und »Person« als soziale Formen der Außenbeobachtung entstehen können. Aber auch diese Unterscheidung in eine biologische Grundlage und deren differenter sozialer Ausformung ist nur eine begriffliche Unterscheidung, um Beobachtungen operationalisieren zu können.
Biographie als Beobachtungskategorie
Ergibt es überhaupt einen Sinn von einer Biographie zu sprechen, wenn jede Form von Typologisierung des biographischen Textes und jede verbindliche Aussage über das porträtierte Individuum unmöglich zu werden scheinen, und wenn der Begriff sowohl das Leben als auch den Text bezeichnet? Darf man aber umgekehrt die Vielfalt dieser Phänomene durch einen willkürlich eingeschränkten Biographiebegriff beschneiden, nur um Schwierigkeiten zu vermeiden? Die Biographie ist etwas, das eindeutig erscheint, das sich bei näherem Hinsehen freilich in ein kaleidoskopartiges Bild auflöst. Ein Ausweg ist es, das Beobachten in den Mittelpunkt zu rücken. Es verändert das Verhältnis zwischen Individuum, Biograph und biographischem Text. Dann entdeckt nicht mehr ein Biograph das Individuum und schreibt dessen Einmaligkeit in einer – mehr oder weniger realitätsgetreuen oder verzerrten – Biographie fest, sondern die Gesellschaft benutzt die Form »Individuum« zur Beobachtung von Welt, in Unterscheidung zu anderen Formen, wie »Struktur«. Die Biographie ist dann das entsprechende literarische Genre, diese Form als Unterscheidung zu anderen Formen festzuhalten. Komplexität wird auf diese Weise reduziert zur überschaubaren Einheit eines Individuums, dem Identität im Sinne physischer, psychischer und chronologischer Konsistenz, ein Eigenname und Wille zugeschrieben werden, und das als Gegenspieler zur Welt auftritt. Wenn das Individuum derartig als narratives Konstrukt entsteht, so üben biographische Texte freilich umgekehrt einen erheblichen Einfluss auf das Leben von Menschen aus, sie prägen deren Biographie – und genau diese strukturierende Kraft macht das Genre so interessant.
Ludwig Stein gehörte zu den Erfolgsautoren des Genres Biographie. In einem Aufsatz von 1895 versuchte er, eine Methodik der Biographie zu formulieren, indem er ihr einen historischen und einen ethisch-pädagogischen Wert zusprach, die Biographie also als Lehrstück für die Öffentlichkeit verstand. Deshalb, so Stein, dürften Biographien keine blutleeren Abstraktionen, keine ermüdende, chronologische Aneinanderreihung von Fakten sein. Und deshalb setzte er, wie die meisten Biographen bis tief ins 20. Jahrhundert hinein, auf große Persönlichkeiten, die einschneidende Taten vollbracht hatten. Nur sie erschienen biographiewürdig, weil nur sie etwas zu lehren hatten. Allerdings wollte er die biographierten Objekte in ihren professionellen Milieus verortet wissen, denn »[l]eise und unvermerkt schleicht sich so manche im Beruf erlangte praktische Erfahrung in das theoretische Denken ein, um dort zu einer generellen Wahrheit umgestempelt zu werden« (Stein 1895: 37). Nur in ihrem Milieu seien große Denker tatsächlich zu verstehen – freilich sollte diese Milieuschilderung der Profession des biographierten Objektes angemessen sein: Das Liebesleben der Dichter mochte produktive Kräfte entfalten, doch für Philosophen gelte das noch lange nicht, es sollte daher mit Takt übergangen werden.
»Die biographische Kunst galt bisher als herrenloses Gut. Das litterarische Freibeuterthum, das ohne äussere Schulung oder inneren Beruf dankbaren Stoffen auflauert, um sie – entweder zur Stillung der Lebensnothdurft, oder, was noch bedenklicher, zur Befriedigung schriftstellerischen Eitelkeitskitzels – mit ihren plumpen Federn meuchlings zu überfallen, hat sich von jeher mit Vorliebe am biographischen Stoff vergriffen. Ein paar rasch zusammengelesene Jahreszahlen, einige flüchtig zusammengestoppelte Urtheile über die Thaten und Werke der Helden, dazu ein vollgerüttelt Maass von verhimmelnden Epithetis und verschnörkelten Superlativen – und die Dutzend-Biographie ist fertig. Der also Überfallene kann sich, da es sich ja meist um die Lebensbeschreibungen Verstorbener handelt, nicht wehren und muss sich daher die frevle Plünderung seines Namens, des einzigen Guts, das ihm geblieben und für welches seine volle, grosse Persönlichkeit einzusetzen das ganze Leben nur Sinn und Werth hatte, stumm gefallen lassen. […] Alles ernsthaft Biographische hat einen doppelten Zweck: einen historischen und einen pädagogisch-ethischen. Einmal soll es erklären, wie die grosse Persönlichkeit – und vornehmlich eine solche ist ein adäquates Objekt der biographischen Kunst – gewachsen und geworden ist, wie ihre Thaten und Werke entstanden sind und gewirkt haben, welche Seiten ihrer Eigenart ihre geschichtliche Stellung bedingen und die Bedeutsamkeit ihrer Leistungen ausmachen, ob und in welchem Umfange sie den Gesammtfortschritt der Kulturmenschheit gefördert haben, andermal soll es jene Züge kräftig hervorheben und mit Licht übergiessen, die etwas Vorbildliches, Beispielweckendes, die Epigonen zu gleicher Leistung Anspornendes an sich tragen. – Ein drittes, minder vornehmes Ziel der Biographik, dessen Werth in umgekehrtem Verhältniss zu seiner Verbreitung steht: die Befriedigung der Neugierde eines anekdotenhaschenden, sensationslüsternen Lesepöbels, kann hier, wo es sich um die wissenschaftliche Seite der Biographik handelt, füglich übergangen werden.
Der historische Werth der Biographik ist nun allen ernsthaften Biographien – unabhängig von ihrem Objekt – gemeinsam. Ob die geschilderte grosse Persönlichkeit ein Monarch, Feldherr oder Staatsmann, Künstler, Gelehrter oder Erfinder ist, gleichviel: sobald ihre Leistung einen merklichen Einschnitt in den Kulturverlauf bedeutet, gehört sie der Geschichte an, und die Schilderung ihres Lebens und Wirkens hat historischen Werth. Anders verhält es sich jedoch mit dem pädagogisch-ethischen oder didaktischen Werth der Biographie. Nicht jedes Leben politisch oder künstlerisch überragender Individualitäten hat nothwendig ethischen Gehalt oder gar vorbildlichen Werth. […]
Dass nun aber ein solches Leben nach völlig anderen Gesichtspunkten und unter Hervorhebung und Herausarbeitung ganz andersartiger Momente dargestellt sein will, wie das irgendeines Heerführers oder Künstlers, leuchtet ohne weiteres ein. Kommt es hier mehr auf die Thaten an, so dort vornehmlich auf die Gesinnung, zumal diese zuweilen die höchste That ist. Daraus folgt, dass sich für die historische Seite der Biographik allenfalls ein allgemeiner, für alle Biographen gültiger, vom behandelten Objekt unabhängiger Kanon aufstellen lässt, dass hingegen mit Rücksicht auf die ethische Wirkung der Biographie eine Scheidung nach Objekten erforderlich ist. Besteht die psychologische Kunst des Biographen in der feinsinnigen Heraushebung derjenigen Eigenschaften seines Helden, die diesen zu einem solchen stempeln, so ist es klar, dass bei der Biographie eines Philosophen z. B. völlig anders geartete Eigenschaften in Betracht kommen, als bei anderen Berufsarten, ja dass die gleichen Eigenschaften in verschiedenen Berufen verschiedenen, häufig sogar einen entgegengesetzten Werth haben. […] Keinem Historiker der Philosophie fällt es bei, den Liebesverhältnissen seiner Helden, die in den Biographien der Dichter einen so berechtigt breiten Raum einnehmen, auch nur nachzuspüren. Was für die Psychologie des Dichters und für die Vertiefung des Verständnisses seiner Werke von fundamentaler Bedeutung sein mag, das sinkt unter Umständen in der Lebensbeschreibung des Philosophen zur quantité négligeable herab.«
Stein 1895: 22, 27–30; auch als Quelle Nr. 6 unterwww.historische-einfuehrungen.de
Kapitel 2Sechs Beispiele
Am Beispiel von sechs Biographien möchte ich die Vielfalt des Genres skizzieren. Zuerst präsentiere ich einen methodisch konventionellen Text, dann die Biographie einer anonymen Person, über die es kaum Quellenmaterial gibt, gefolgt von einer psychoanalytischen Biographie, einer Kollektivbiographie, dem biographischen Zugriff auf eine Ehe sowie einer experimentell verfahrenden Biographie. Ich werde knapp den Inhalt referieren, auf die jeweils unterschiedlichen Perspektiven eingehen, die spezifische Sprache und das Narrativ beschreiben, außerdem inhaltliche Stärken und Begrenzungen herausarbeiten.
2.1. Julia Scialpi: Der Kulturhistoriker Richard Benz (2010)
Ein Lebensbild
Die Stadt Heidelberg verleiht eine exklusive Münze im Gedenken an den Kulturhistoriker Richard Benz, doch paradoxerweise ist Benz der Öffentlichkeit heute kaum noch ein Begriff. Scialpi hat deshalb eine solide Studie verfasst, die Benz in Erinnerung halten soll. Formal folgt sie dabei dem klassischen Entwicklungsmodell einer Biographie. Sie beginnt mit Elternhaus, Studium und Berufseinstieg, schildert dann seinen Aufstieg zu einem gefragten Publizisten, seinen Rückzug von der öffentlichen Bühne, Alter, Tod, auch sein Nachleben in Form der Gedenkmünze und des ins Vergessenfallen. Eingebettet in diese Chronologie des Lebens sind thematische Blöcke, die Benz’ Weltanschauung rekonstruieren, seine Publikationspolitik beschreiben, seine Haltung im »Dritten Reich« sowie den Neubeginn nach dem Kriege.