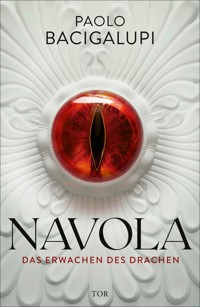5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Bangkok in naher Zukunft: Klimawandel und die Profitgier der internationalen Großunternehmen haben die Welt, wie wir sie kennen, für immer zerstört. Künstlich generierte Krankheiten, Bioterrorismus und Hungersnöte gehören zum Alltag, die Lebensmittelkonzerne beherrschen die globale Marktwirtschaft. Anderson Lake, Mitarbeiter der Firma AgriGen, versucht, Zugang zu thailändischen Genlaboratorien zu bekommen – weltweit die einzigen, die noch Stammkulturen unverseuchten Getreidesamens besitzen. Doch Thailands Regierung setzt alles daran, das Eindringen der westlichen Konzerne in ihr Land zu verhindern ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 837
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Das Buch
Die nicht allzu ferne Zukunft. Der Klimawandel und die Profitgier der internationalen Großunternehmen haben die Erde, wie wir sie kennen, zerstört: Der Meeresspiegel ist angestiegen, das Erdöl ist versiegt, und ganze Spezies wurden ausgerottet. Künstlich generierte Krankheiten, Bioterrorismus und Hungersnöte gehören zum Alltag. Die Supermächte sind schon lange untergegangen, stattdessen beherrschen die Lebensmittelkonzerne die globale Marktwirtschaft. Einzig dem Königreich Thailand ist es gelungen, sich durch Isolation und eine rigorose Biopolitik die Unabhängigkeit zu bewahren. Anderson Lake, Mitarbeiter der Firma AgriGen, wird nach Bangkok geschickt, wo er sich Zugang zu thailändischen Genlaboratorien verschaffen soll – weltweit die einzigen, die noch Stammkulturen unverseuchter Getreidesamen besitzen. Doch Thailands Regierung setzt alles daran, das Eindringen westlicher Konzerne in ihr Land zu verhindern …
Biokrieg ist ein atemberaubender Wissenschaftsthriller, der mit dem Hugo und Nebula Award als bester Roman des Jahres ausgezeichnet wurde.
Der Autor
Paolo Bacigalupi ist bereits als Kurzgeschichtenautor in Erscheinung getreten, bevor er mit Biokrieg seinen ersten Roman veröffentlichte, der vom Time Magazine in die Top Ten der zehn besten Romane des Jahres aufgenommen wurde und zum internationalen Bestseller avancierte. Der Autor lebt mit seiner Frau und seinem Sohn in West Colorado.Im Heyne-Verlag sind von ihm außerdem erschienen: Schiffsdiebe, Versunkene Städte und Tool.
Mehr zu Paolo Bacigalupi und seinen Romanen auf:diezukunft.de
Paolo Bacigalupi
Biokrieg
Roman
Wilhelm Heyne VerlagMünchen
Impressum
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Titel der amerikanischen Originalausgabe THE WINDUP GIRL Deutsche Übersetzung von Hannes Riffel und Dorothea Kallfass
Redaktion: Birgit Herden
Copyright © 2009 by Paolo Bacigalupi
Copyright © 2011 der deutschsprachigen Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Umschlaggestaltung: Schütz
Umschlagmotiv: Illustration: Raphael Lacoste
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-05430-4V007
www.heyne.de
Inhaltsverzeichnis
Für Anjula
1
»Nein! Ich will keine Mangostan.« Anderson Lake beugt sich vor und deutet mit dem Finger. »Ich möchte die da. Kaw pollamai nee khap. Die mit der roten Haut und den grünen Borsten.«
Die Bäuerin lächelt, bleckt dabei die Zähne, die ganz schwarz sind vom Betelnusskauen, und zeigt auf eine Pyramide von Früchten, die neben ihr aufgehäuft sind. »Un nee chai mai kha?«
»Genau, die da. Khap.« Anderson nickt und zwingt sich ebenfalls zu einem Lächeln. »Wie heißen die denn?«
»Ngaw.« Sie spricht das Wort besonders deutlich aus, damit der Fremde es versteht, und reicht ihm eine Kostprobe.
Anderson nimmt die Frucht und runzelt die Stirn. »Ist die neu?«
»Kha.« Sie nickt bekräftigend.
Anderson dreht die Frucht in der Hand hin und her und betrachtet sie eingehend. Sie gleicht eher einer knallbunten Seeanemone oder einem pelzigen Kugelfisch; mit ihren feinen grünen Ranken liegt sie rau in seiner Hand. Die Haut hat den bräunlich roten Farbton von Rostwelke. Als er jedoch daran riecht, kann er keine Anzeichen von Fäulnis wahrnehmen. Trotz ihres Aussehens ist sie allem Anschein nach völlig in Ordnung.
»Ngaw«, wiederholt die Bäuerin, und dann, als könnte sie seine Gedanken lesen: »Neu. Keine Rostwelke.«
Anderson nickt geistesabwesend. Obwohl es noch früh am Morgen ist, herrscht auf der Markt-Soi bereits geschäftige Betriebsamkeit. Entlang der Gasse verbreiten Berge von Durianfrüchten ihren durchdringenden Geruch. In mit Wasser gefüllten Bottichen zappeln Rotflossen-Plaa und Schlangenkopffische. Planen aus Palmölpolymer mit handgemalten Bildern von den Klippern der Handelskompanien und dem Antlitz der verehrten Kindskönigin werfen ihren Schatten auf den Markt und drohen unter der Hochofenhitze der tropischen Sonne nachzugeben. Ein Mann drängelt sich vorbei, in den Händen Hühner mit zinnoberrotem Kamm, die – auf dem Weg zur Schlachtbank – wütend gackern und mit den Flügeln schlagen. Frauen in farbenfrohen Pha Sin feilschen lächelnd mit den Händlern um den Preis von illegalem U-Tex-Reis oder einer neuen Tomatensorte.
Anderson berührt das alles nicht.
»Ngaw«, wiederholt die Frau, um Aufmerksamkeit heischend.
Die langen Borsten der Frucht kitzeln ihn auf der Handfläche – eine Herausforderung, ihre Herkunft auszumachen. Ein weiterer Erfolg thailändischer Genhacker, genau wie die Tomaten, die Auberginen und die Chilis, die es an den Ständen hier in Hülle und Fülle gibt. Als würden die Prophezeiungen der grahamitischen Bibel eintreten. Als würde sich der heilige Franziskus voller Unruhe in seinem Grab regen, um alsbald über das Land zu schreiten und den Menschen die im Laufe der Geschichte verlorenen Kalorien wiederzubringen.
Und mit Trompeten wird er kommen, und Eden wird wiederkehren …
Anderson streicht mit dem Finger über die seltsame Frucht. Kein Geruch nach Cibiskose. Keine Anzeichen von Rostwelke. Kein genmanipulierter Rüsselkäfer hat auf der Haut seine Spuren hinterlassen. Blumen und Gemüse, die Bäume und die Früchte der Welt bilden die Geografie von Andersons Geist, und doch findet er nirgendwo einen Wegweiser, der ihm hilft, das, was er in der Hand hält, zu identifizieren.
Ngaw. Ein Rätsel.
Er mimt, dass er gerne davon probieren würde, und die Bäuerin greift nach der Frucht. Ihr brauner Daumen reißt mühelos die borstige Schale auf, und darunter kommt blasses Fruchtfleisch zum Vorschein. Mit ihrem durchscheinenden Aussehen und den feinen Äderchen könnte es sich genauso gut um eine der Silberzwiebeln handeln, wie sie bei wissenschaftlichen Konferenzen in Des Moines in Martinis serviert werden.
Die Bäuerin reicht ihm die Frucht zurück. Anderson riecht zögerlich daran. Atmet den süßen Blumenduft ein. Eine Ngaw. Die es eigentlich gar nicht geben dürfte. Und die es gestern auch noch nicht gab. Gestern hat kein einziger Stand in Bangkok diese Früchte feilgeboten. Aber jetzt – jetzt sitzt die schmutzige Frau zwischen hohen Pyramiden davon im spärlichen Schatten ihrer Plane. Um den Hals trägt sie ein goldglänzendes Amulett, von dem ihm der Märtyrer Phra Seub zuzwinkert – ein Talisman, der vor den Agrarseuchen der Kalorienkonzerne schützen soll.
Wenn er die Frucht doch nur in ihrer natürlichen Umgebung beobachten könnte, wie sie an einem Baum hängt oder sich unter den Blättern irgendeines Busches versteckt! Würde er über mehr Informationen verfügen, könnte er vielleicht Gattung und Familie erraten, eine Ahnung der genetischen Abstammung erhaschen, die das Königreich Thailand da auszugraben versucht; aber es gibt keine weiteren Hinweise. Anderson steckt sich die schlüpfrige, durchscheinende Kugel in den Mund.
Der Geschmack ist überwältigend – eine Fülle von Süße und Fruchtbarkeit. Die blumige Bombe klebt auf seiner Zunge. Er hat das Gefühl, wieder auf den HiGro-Feldern von Iowa zu sein, wo er als Bauernjunge barfuß zwischen den Getreidehalmen herumrannte und wo ihm ein Agrarwissenschaftler aus dem Midwest Compact sein erstes winziges Lutschbonbon schenkte. Der plötzliche Schock angesichts des vielfältigen Aromas; echten Aromas – etwas, das er bis dahin nicht gekannt hatte.
Die Sonne brennt herab. Die Leute rempeln einander an und feilschen um die Wette. Anderson nimmt von alldem nichts wahr. Er lässt sich die Ngaw auf der Zunge zergehen, kostet mit geschlossenen Augen die Vergangenheit, kostet eine Zeit, bevor Cibiskose, bevor Rostwelke, Krätzenschimmel und der japanische Rüsselkäfer alles ausgelöscht haben.
Unter der unbarmherzigen Hitze der tropischen Sonne, vom Ächzen der Wasserbüffel und dem Schrei sterbender Hühner umgeben, ist er eins mit dem Paradies. Wäre er ein Grahamite, dann würde er jetzt auf die Knie sinken und verzückt danksagen für die Wiederkehr von Eden.
Anderson spuckt die schwarzen Kerne in seine Hand und lächelt. Er hat historische Reiseberichte von Botanikern und Forschern gelesen, von Männern und Frauen, die auf der Suche nach neuen Arten in die tiefste Dschungelwildnis vorgestoßen sind – und trotzdem verblassen ihre Entdeckungen neben dieser Frucht.
Jene Menschen waren alle auf Entdeckungen aus. Er dagegen ist hier auf eine Wiederauferstehung gestoßen.
Die Bäuerin strahlt über das ganze Gesicht – sie ist sich sicher, dass sie etwas verkaufen wird. »Ao gee kilo kha?« Wie viel?
»Sind sie ungefährlich?«, fragt er.
Sie deutet auf das Zertifikat des Umweltministeriums, das neben ihr auf dem Pflaster liegt, und unterstreicht das Datum der Kontrollen mit dem Finger. »Neuste Variante«, sagt sie. »Beste Qualität.«
Anderson studiert die schimmernden Siegel. Wahrscheinlich hat sie die Weißhemden bestochen, um sich einen Teil der Inspektion zu ersparen, die die Resistenz achten Grades gegenüber Rostwelke sowie Widerstandsfähigkeit gegen Cibiskose 111. mt7 und mt8 garantiert hätte. Der Zyniker in ihm mutmaßt, dass das kaum eine Rolle spielt. Die verschlungenen Muster der Plaketten, die in der Sonne glitzern, haben eher symbolischen Charakter — die Leute sollen sich in einer Welt voller Gefahren sicher fühlen können. Falls die Cibiskose erneut ausbricht, werden diese Zertifikate wirkungslos sein. Bei einer neuen Variante sind sämtliche alten Tests völlig unbrauchbar, und dann beten die Leute zu ihren Phra-Seub-Amuletten und den Bildnissen von König Rama XII. oder opfern am Schrein der Stadtsäulen. Ganz gleich, wie viele Plaketten des Umweltministeriums ihr Obst und Gemüse zieren mögen — die Menschen werden sich trotzdem das Blut aus den Lungen husten.
Anderson steckt die Kerne der Ngaw ein. »Ich nehme ein Kilo. Nein. Zwei. Song.«
Er reicht der Bäuerin einen Hanfbeutel, ohne auch nur versuchsweise zu feilschen. Was auch immer sie verlangt – es ist zu wenig. Ein solches Wunder ist alle Reichtümer der Welt wert. Ein einziges Gen, das resistent gegen eine Kalorienseuche ist oder Stickstoff effizienter verwertet, lässt die Profite in die Höhe schießen. Er muss sich nur hier auf dem Markt umschauen, um diese Wahrheit bestätigt zu sehen. In der Gasse wimmelt es von Thai, die alles kaufen – gengefledderte Varianten von U-Tex-Reis ebenso wie zinnoberrote Geflügelrassen. Aber all diese Dinge sind Fortschritte von gestern, die auf den älteren gentechnischen Arbeiten von AgriGen, PurCal und Total Nutrient Holdings basieren. Die Früchte einer überkommenen Wissenschaft aus den Katakomben der Forschungslabore des Midwest Compact.
Die Ngaw ist etwas anderes. Die Ngaw kommt nicht aus dem Mittleren Westen. Das Königreich Thailand ist in mancherlei Hinsicht gerissener als andere Nationen. Es blüht auf, während Länder wie Indien und Burma und Vietnam wie Dominosteine umfallen und hungernd um die wissenschaftlichen Errungenschaften der Kalorienmonopole betteln.
Ein paar Leute bleiben stehen, um einen prüfenden Blick auf das zu werfen, was Anderson da kauft. Aber auch wenn er den Preis für zu niedrig erachtet, finden sie ihn offenbar zu hoch und gehen weiter.
Die Frau reicht Anderson die Ngaw, und fast hätte er vor Freude gelacht. Eigentlich dürfte es keine einzige dieser pelzigen Früchte geben; ebenso gut könnte er einen Beutel Trilobiten mit sich herumtragen. Wenn seine Vermutung hinsichtlich der Abstammung der Ngaw zutrifft, stellt sie die Rückkehr einer ausgestorbenen Art dar, die ebenso unglaublich ist, wie wenn ein Tyrannosaurus die Thanon Sukhumvit hinunterschreiten würde. Andererseits trifft das auch auf die Kartoffeln, Tomaten und Chilis zu, die hier überall erhältlich sind, in solch prächtiger Fülle aufgehäuft – die ganze Vielfalt nahrhafter Nachtschattengewächse, wie sie seit Generationen niemand mehr gesehen hat. In dieser ertrinkenden Stadt scheint alles möglich. Obst und Gemüse kehren aus dem Grab zurück, ausgestorbene Blumen blühen entlang der Chausseen, und hinter den Kulissen wirkt das Umweltministerium Wunder – mit Hilfe von lange verloren geglaubtem genetischem Material.
Den Beutel voller Früchte in der Hand, drängt sich Anderson durch die Soi zurück zur Hauptstraße. Hier brodelt der Verkehr — die morgendlichen Pendler verstopfen die Thanon Rhama IX, als hätte der Mekong Hochwasser. Fahrräder und Fahrradrikschas, blauschwarze Wasserbüffel und große, schwerfällige Megodonten.
Als Anderson die Straße erreicht, taucht Lao Gu aus dem Schatten eines zerfallenden Bürohochhauses auf. Behutsam zwickt er die Glut seiner Zigarette ab. Nachtschattengewächse, schon wieder. Sie gedeihen hier überall. Nirgendwo sonst auf der ganzen Welt, aber hier gibt es sie im Übermaß. Lao Gu lässt den Rest seines Tabaks in einer ausgefransten Hemdtasche verschwinden und eilt Anderson zu ihrer Fahrradrikscha voraus.
Der alte Chinese ist nur eine in Lumpen gekleidete Vogelscheuche, und trotzdem kann er sich glücklich schätzen. Er lebt, während der Großteil seines Volkes tot ist. Er hat Arbeit, während die anderen malaiischen Flüchtlinge, wie Schlachthühner in die brechend vollen Expansionshochhäuser gepackt, vor Hitze fast umkommen. Lao Gu hat sehnige Muskeln auf den Knochen und genug Geld, um sich hin und wieder eine Singha-Zigarette zu gönnen. Gegenüber den anderen Yellow-Card-Flüchtlingen kann er sich so glücklich schätzen wie ein König.
Lao Gu schwingt sich in den Sattel des Fahrrads und wartet geduldig, bis Anderson hinter ihm auf den Fahrgastsitz geklettert ist. »Ins Büro«, sagt Anderson. »Bai khap.« Dann wechselt er ins Chinesische. »Zou ba.«
Der alte Mann richtet sich auf seinen Pedalen auf, und sie fädeln sich in den Verkehr ein. Um sie herum schellen die Fahrradklingeln wie Cibiskose-Glöckchen, wütend über das neue Hindernis. Lao Gu schenkt ihnen keine Beachtung und schlängelt sich durch den Verkehrsstrom.
Anderson greift nach einer weiteren Ngaw, beherrscht sich dann aber. Er sollte sie sich aufsparen. Sie sind zu wertvoll – er darf sie nicht wie ein gieriges Kind hinunterschlingen. Die Thai haben einen Weg gefunden, die Vergangenheit zu exhumieren, und er hat nichts anderes im Sinn, als sich an den Beweisen gütlich zu tun! Er trommelt mit den Fingern auf den Beutel und ringt um Selbstdisziplin.
Um sich abzulenken, kramt er seine Schachtel Zigaretten hervor und zündet sich eine an. Er inhaliert den Tabaksqualm, genießt den Geschmack und erinnert sich an seine Überraschung darüber, wie erfolgreich das Königreich Thailand geworden war und wie weit sich die Nachtschattengewächse verbreitet hatten. Während er raucht, denkt er an Yates. Wie enttäuscht der Mann doch war, als sie einander gegenübersaßen und die wiederbelebte Vergangenheit zwischen ihnen schwelte.
»Nachtschattengewächse.«
Yates’ Streichholz flammte auf und entriss seine Gesichtszüge dem trüben Licht im Büro von SpringLife. Er hielt es an die Zigarette und zog an ihr. Reispapier knisterte. Die Glut leuchtete, und Yates atmete aus; Rauch ringelte sich in Richtung Decke, wo Kurbelventilatoren sich mühten, die Saunahitze zu lindern.
»Auberginen. Tomaten. Chilis. Kartoffeln. Jasmin. Tabak.« Er hielt seine Zigarette in die Höhe und runzelte die Stirn. »Tabak!«
Er zog erneut daran und kniff die Augen zusammen. Die im Schatten liegenden Schreibtische und Tretkurbelcomputer lagen schweigend da. Abends, wenn die Fabrik geschlossen hatte, war es fast möglich, die leeren Schreibtische für etwas anderes zu halten als eine Topografie des Scheiterns. Vielleicht waren die Arbeiter ja nur nach Hause gegangen und ruhten sich aus, um sich am nächsten Tag wieder frohen Mutes an die Arbeit zu machen. Die Staubschutzhauben über den Stühlen und Computern straften diese Vorstellung zwar Lügen. Im Halbdunkel, wenn die Schatten die Möbel einhüllten und der Mondschein durch die Mahagonifensterläden fiel, war es jedoch möglich, der Fantasie freien Lauf zu lassen.
An der Decke drehten sich die Ventilatoren weiter bedächtig im Kreis. Die in Reihe angeordneten Antriebsriemen aus laotischem Gummi ächzten rhythmisch; von den Hauptspannfedern der Fabrik bezogen sie einen steten Strom kinetischer Energie.
»Die Thai haben in ihren Laboren Glück gehabt«, sagte Yates. »Und jetzt tauchen Sie hier auf. Wenn ich abergläubisch wäre, würde ich annehmen, die hätten Sie zusammen mit den Tomaten herbeigezaubert. Jeder Organismus benötigt einen natürlichen Feind, habe ich recht?«
»Sie hätten melden sollen, was für große Fortschritte die Thai machen«, erwiderte Anderson. »Die Fabrik war schließlich nicht Ihre einzige Aufgabe!«
Yates verzog sein von den Tropen gezeichnetes Gesicht. Geplatzte Äderchen bedeckten die Wangen und zogen sich über seine Knollennase. Er blinzelte Anderson aus wässrigen Augen an, so trübe wie die vom Rauch der Dungfeuer geschwängerte Luft. »Ich hätte wissen sollen, dass Sie mir meine Nische streitig machen würden.«
»Das ist nichts Persönliches.«
»Nur mein Lebenswerk.« Er lachte, ein trockenes Röcheln, das an die ersten Anzeichen von Cibiskose gemahnte. Hätte Anderson nicht gewusst, dass Yates, wie alle Angestellten von AgriGen, gegen die neusten Stämme geimpft worden war, hätte er längst die Flucht ergriffen.
»Ich habe Jahre gebraucht, all das hier aufzubauen«, fuhr Yates fort. »Und Sie sagen mir, es sei nichts Persönliches.« Mit einer Handbewegung deutete er zu den großen Glasscheiben hinüber, durch die man vom Büro aus in die Fertigungshalle blicken konnte. »Ich verfüge über Spannfedern von der Größe meiner Faust, die ein Gigajoule Energie speichern können. Die Leistung im Verhältnis zum Gewicht übertrifft die jeder anderen Feder auf dem Markt um das Vierfache. Ich sitze auf einer Revolution in Sachen Energiespeichertechnik, und Sie werfen das alles weg.« Er beugte sich vor. »Energie, die man so leicht transportieren kann, hatten wir seit dem Benzin nicht mehr.«
»Nur wenn Sie die Dinger auch herstellen können.«
»Wir stehen kurz vor dem Durchbruch«, beharrte Yates. »Das einzige Problem sind die Algenbäder.«
Anderson schwieg. Yates schien das als Zuspruch aufzufassen. »Das grundlegende Konzept ist ohne Fehler. Wenn die Bäder erst einmal ausreichende Mengen produzieren …«
»Sie hätten uns informieren sollen, als Sie die Nachtschattengewächse auf dem Markt entdeckt haben. Die Thai haben fünf Anbauperioden in Folge erfolgreich Kartoffeln angepflanzt. Ganz offensichtlich sitzen sie auf einer Samenbank, und von Ihnen haben wir nichts davon erfahren.«
»Das ist nicht meine Abteilung. Ich bin für Energiespeicher zuständig. Nicht für die Erzeugung.«
Anderson verbiss sich eine scharfe Bemerkung. »Woher wollen Sie die Kalorien bekommen, um Ihre raffinierten Spannfedern aufzuziehen, wenn wir eine Missernte haben? Inzwischen mutiert die Rostwelke alle drei Anbauperioden. Hobby-Genfledderer haben sich an unseren Bauplänen für TotalNutrient-Weizen und SoyPRO zu schaffen gemacht. Unsere letzte Variante von HiGro-Mais hat den Rüsselkäferbefall nur zu sechzig Prozent überstanden. Und jetzt erfahren wir urplötzlich, dass Sie auf einer genetischen Goldmine sitzen. Die Menschen verhungern …«
Yates lachte. »Kommen Sie mir bloß nicht damit, dass Sie Leben retten wollen. Ich weiß, was mit den Samenbanken in Finnland passiert ist.«
»Wir haben die Tresorräume doch nicht gesprengt. Niemand hat geahnt, dass die Finnen solche Fanatiker sind.«
»Jeder Idiot hätte das voraussehen können. Kalorienkonzerne haben schließlich ihren ganz speziellen Ruf.«
»An dieser Operation war ich nicht beteiligt.«
Yates lachte erneut. »Das ist immer unsere Entschuldigung, was? Der Konzern schickt irgendwo seine Söldner rein, und wir halten uns aus allem raus und waschen unsere Hände in Unschuld. Und tun so, als wären wir für nichts verantwortlich. Der Konzern nimmt in Burma SoyPRO vom Markt, und wir stehen tatenlos herum und erklären, für Auseinandersetzungen um geistiges Eigentum seien wir nicht zuständig. Und gleichwohl verhungern die Menschen.« Er zog an seiner Zigarette und stieß eine Rauchwolke aus. »Ich weiß wirklich nicht, wie jemand wie Sie nachts schlafen kann.«
»Ganz einfach. Ich bete zu Noah und dem heiligen Franziskus und danke Gott, dass wir der Rostwelke einen Schritt voraus sind.«
»Und das war’s dann? Sie werden die Fabrik schließen?«
»Nein. Natürlich nicht. Wir werden weiter Spannfedern herstellen.«
»Ach ja?« Yates schien wieder Hoffnung zu schöpfen.
Anderson zuckte mit den Achseln. »Das ist eine gute Tarnung. «
Die Glut der Zigarette erreicht Andersons Finger, und er lässt sie einfach fallen. Reibt Daumen und Zeigefinger, die ein wenig angesengt sind, aneinander, während Lao Gu durch den dichten Verkehr strampelt. Bangkok, die Stadt der Engel, gleitet an ihnen vorüber.
Mönche in safrangelben Gewändern gehen gemächlich im Schatten schwarzer Schirme die Gehwege entlang. Gruppen von Kindern rennen auf dem Weg in die Klosterschulen an ihnen vorbei, schubsen einander, lachen und schreien. Straßenverkäufer strecken die Arme aus, an denen Girlanden aus Ringelblumen hängen, für die Opfergaben der Gläubigen in den Tempeln. Sie halten funkelnde Amulette angebeteter Mönche in die Höhe, die gegen alles Mögliche schützen sollen, von Unfruchtbarkeit bis Krätzenschimmel. Mobile Garküchen verströmen zischend den Duft von Bratöl und fermentiertem Fisch, während sich die flackernd-flirrenden Formen der Cheshire jaulend um die Füße der Kunden winden und auf Abfälle hoffen.
Über allem ragen die Hochhäuser aus der Zeit von Bangkoks Expansion empor, von Kletterpflanzen und Schimmelpilzen überwuchert, die Fenster schon seit Jahren herausgesprengt – große, abgenagte Knochen. Ohne Klimaanlagen oder Aufzüge sind sie so gut wie unbewohnbar, und so stehen sie brutzelnd in der Sonne. Der schwarze Rauch illegaler Dungfeuer strömt ihnen aus allen Poren und macht offenbar, wo malaiische Flüchtlinge in aller Eile Chapatis anbraten und Kopi kochen, bevor die Weißhemden die schwülen Höhen stürmen und sie wegen dieser Ordnungswidrigkeit grün und blau schlagen.
In der Mitte der Fahrbahn werfen sich Flüchtlinge aus dem Kohlekrieg im Norden auf die Knie, die erhobenen Hände gegeneinandergedrückt, selbst noch in größter Armut ausnehmend höflich. Fahrräder, Fahrradrikschas und Megodontenwagen fließen an ihnen vorbei, teilen sich wie ein Fluss um einen Fels. Die Blumenkohlgeschwülste der fa’ gan-Wucherung entstellen Mund und Nase der Bettler. Betelnussflecken schwärzen ihre Zähne. Anderson greift in die Hosentasche und wirft ihnen Bargeld vor die Füße. Ihre Dankesbezeugungen erwidert er mit einem angedeuteten Kopfnicken.
Kurze Zeit später kommen die weiß getünchten Mauern und Gassen des Industriegebiets der Farang in Sicht. Lagerhäuser und Fabriken stehen dicht an dicht und verbreiten den Geruch von Salz und fauligem Fisch. Straßenverkäufer säumen die Gassen, nur notdürftig von Planen und Tüchern gegen die unerbittliche Sonne geschützt. Direkt dahinter erheben sich die Deiche und Schleusen der Dammanlage von König Rama XII. und halten das ganze Gewicht des blauen Ozeans zurück.
Es fällt schwer, sich nicht unentwegt dieser hohen Mauern und der dahinter liegenden Wassermassen bewusst zu sein. Die Stadt der Engel droht jeden Augenblick in einer Katastrophe unterzugehen. Aber die Thai sind hartnäckig und kämpfen mit aller Macht um ihr heiliges Krung Thep. Mit kohlegetriebenen Pumpen, zahllosen Dammarbeitern und dem tiefen Glauben an die visionäre Führerschaft ihrer Chakri-Dynastie ist es ihnen bisher gelungen, das in Schach zu halten, was New York und Rangun, Mumbai und New Orleans verschlungen hat.
Lao Gu kämpft sich eine Gasse hinunter und betätigt ungeduldig seine Klingel, um die Kulis zu verscheuchen, die die Hauptverkehrsader verstopfen. WeatherAll-Kisten schaukeln auf braunen Rücken. Logos schwanken hin und her – Spannfedern der Chaozhou-Chinesen, antibakterielle Lenkergriffe von Matsushita, keramische Wasserfilter von Bo Lok; der schlurfende Rhythmus der Lastenträger entfaltet eine geradezu hypnotische Wirkung. Bildnisse des lehrenden Buddha und der verehrten Kindskönigin prangen ebenso an den Fabrikmauern wie handgemalte Bilder von weit zurückliegenden Muay-Thai-Kämpfen.
Die SpringLife-Fabrik erhebt sich über das Verkehrschaos, eine von hohen Mauern umrahmte Festung, gespickt mit riesigen Ventilatoren, die sich in den Lüftungsschächten der oberen Stockwerke drehen. Eine Chaozhou-Fahrradfabrik bildet das Gegenstück auf der anderen Seite der Soi. Dazwischen das Wirrwarr der Garküchen, die sich ringsum an die Fabrikeingänge klammern wie Muscheln an eine Klippe, um die Arbeiter zu allen Tageszeiten mit Essen zu versorgen.
Lao Gu hält im Innenhof von SpringLife und setzt Anderson vor dem Haupteingang der Fabrik ab. Anderson steigt aus der Rikscha, greift nach seinem Beutel mit Ngaw und bleibt einen Augenblick stehen, um zu den acht Meter hohen Toren aufzuschauen, durch welche die Megodonten hineingelangen. Die Fabrik sollte in »Yates’ Luftschloss« umbenannt werden. Der Mann ist ein entsetzlicher Optimist. Anderson sieht ihn noch immer vor sich, wie er die Wunder transgener Algen preist und in seinen Schreibtischschubladen kramt, um nach Grafiken und hingekritzelten Notizen zu suchen.
»Sie können meine Arbeit doch nicht von vornherein schlechtmachen, nur weil das Projekt Ocean Bounty gescheitert ist! Bei fachgerechter Aushärtung verbessern die Algen die Drehmomentaufnahme um ein Vielfaches. Vergessen Sie ihr Potenzial an Kalorien. Konzentrieren Sie sich auf die industriellen Anwendungsmöglichkeiten. Ich serviere Ihnen den gesamten Markt für Energiespeichertechnik auf einem Silbertablett, wenn Sie mir nur noch etwas Zeit geben. Testen Sie wenigstens eine meiner Vorführfedern, bevor Sie eine Entscheidung fällen …«
Als Anderson die Fabrik betritt, brandet das Brüllen der Maschinen über ihn hinweg und übertönt noch das letzte verzweifelte Aufheulen von Yates’ Optimismus.
Schnaufend umkreisen Megodonten die Spindelkurbeln. Ihre gewaltigen Köpfe hängen tief herab, und ihre Greifrüssel schleifen über den Boden, während sie bedächtig einen Fuß vor den anderen setzen. Die genmanipulierten Tiere sind das lebendige Herz der Fabrik; sie erzeugen die Energie für Fließbänder, Entlüftungsanlagen und Produktionsmaschinen. Ihr Geschirr scheppert rhythmisch, während sie sich vorwärtsstemmen. Die Megodontenführer der Gewerkschaften gehen in Rot und Gold neben ihren Schützlingen einher, tauschen sie hin und wieder aus und treiben die vom Elefanten abstammenden Tiere zu mehr Leistung an.
Auf der anderen Seite der Halle spuckt die Fertigungsstraße frisch verpackte Spannfedern aus; diese gleiten an der Qualitätskontrolle vorbei in die Konfektionierung, wo sie, auf Paletten gesetzt, darauf warten, irgendwann einmal exportiert zu werden. Rein theoretisch. Als die Arbeiter Anderson bemerken, halten sie inne und bezeigen ihm ihren Respekt, indem sie die Handflächen aneinanderlegen und vor ihre Stirn heben – die Bewegung läuft gleich einer Welle das ganze Fließband entlang.
Banyat, der Leiter der Qualitätskontrolle, eilt herbei und begrüßt seinen Chef mit einem Wai und einem Lächeln.
Anderson deutet ebenfalls ein Wai an. »Wie ist die Qualität? «
Banyat lächelt noch immer. »Dee khap. Gut. Besser. Kommen Sie, ich möchte Ihnen etwas zeigen.« Er gibt Num, dem Vorarbeiter der Tagesschicht, der weiter oben am Fließband steht, ein Zeichen, und dieser läutet eine Alarmglocke, die eine allgemeine Arbeitspause signalisiert. Banyat bittet Anderson mit einer Handbewegung, ihm zu folgen. »Etwas Interessantes. Das wird Ihnen gefallen.«
Anderson lächelt angespannt – er bezweifelt, dass irgendetwas von dem, was Banyat sagt, ihm wahrhaft gefallen wird. Er holt eine Ngaw aus der Tasche und bietet sie dem QK-Mann an. »Ein Fortschritt? Wirklich?«
Banyat nickt und nimmt die Frucht. Er wirft nur einen flüchtigen Blick darauf, bevor er sie schält. Steckt sich das durchscheinende Herz in den Mund. Ohne im Geringsten überrascht zu wirken. Er isst das verdammte Ding einfach, ohne sich etwas daraus zu machen. Anderson verzieht das Gesicht. Die Farang sind immer die Letzten, die erfahren, wenn sich in diesem Land etwas verändert – eine Tatsache, auf die Hock Seng gerne hinweist, wenn er in seinem Verfolgungswahn befürchtet, von Anderson gefeuert zu werden. Auch Hock Seng weiß wahrscheinlich bereits über diese Frucht Bescheid oder wird jedenfalls so tun, wenn er ihn danach fragt.
Banyat wirft die Fruchtkerne in einen Eimer mit Futter für die Megodonten und führt Anderson das Fließband entlang. »Wir haben ein Problem an der Stanzmaschine behoben«, sagt er.
Num läutet erneut seine Alarmglocke, und die Arbeiter treten von ihren Plätzen zurück. Als die Glocke zum dritten Mal ertönt, versetzen die Mahout den Tieren unter ihrer Aufsicht leichte Schläge mit ihren Bambusruten, und die Megodonten bleiben einer nach dem anderen stehen. Die Fertigungsstraße wird langsamer. Am anderen Ende der Halle ticken und quietschen die Spannfedertrommeln, die von den Schwungrädern der Fabrik neu aufgeladen werden, damit sie das Fließband wieder in Bewegung setzen können, sobald Anderson mit seiner Inspektion fertig ist.
Banyat führt Anderson die jetzt stillliegende Produktionsstraße entlang, vorbei an weiteren in Grün und Weiß gekleideten Arbeitern, die grüßend die Hände zusammenlegen. Schließlich schiebt er den Vorhang aus Palmölpolymer beiseite, der den Eingang zum Klärraum abtrennt. Yates’ industrielle Errungenschaft ist hier überall mit herrlicher Unbekümmertheit verspritzt und überzieht die Spannfedern mit den Rückständen gentechnischer Ingenieurskunst. Frauen und Kinder mit Dreifach-Filtermasken blicken auf und reißen sofort ihren Atemschutz herunter, um dem Mann, der sie ernährt, ihren tiefsten Respekt zu bezeugen. Ihre Gesichter sind von Schweiß und einem farblosen Puder bedeckt. Nur die Haut um Mund und Nase hat durch den Schutz der Filter noch ihre natürliche dunkle Farbe.
Anderson und Banyat gehen hindurch zur anderen Seite und gelangen zum brütend heißen Stanzraum. Härtungslampen funkeln vor Energie, der durchdringende Geruch der Zuchtalgen erfüllt die Luft und raubt einem den Atem. Über ihnen ragen aufeinandergestapelte Gittersiebe bis zur Decke empor. Darauf sind transgene Algen ausgelegt, die erst abtropfen, dann in der Hitze austrocknen und schließlich zu einem schwarzen Brei werden. Die schwitzenden Fließbandarbeiter sind fast nackt – sie tragen nur Shorts, ärmellose Shirts und einen Kopfschutz. Trotz der sirrenden Kurbelventilatoren und der großzügig bemessenen Belüftungsanlage kommt man sich hier vor wie in einem Hochofen. Schweiß läuft Anderson den Hals hinunter. Sein Hemd ist augenblicklich tropfnass.
Banyat deutet auf etwas. »Hier. Schauen Sie.« Er fährt mit dem Finger über den ausgebauten Stempel der Stanzmaschine, der neben dem Fließband liegt. Anderson kniet sich hin, um die Oberfläche zu begutachten. »Rost«, murmelt Banyat.
»Ich dachte, wir führen entsprechende Inspektionen durch?«
»Salzwasser.« Banyat lächelt betreten. »Das Meer ist nicht weit.«
Anderson blickt zu den tropfenden Algen auf und verzieht das Gesicht. »Die Algentanks und die Trockensiebe machen die Sache auch nicht gerade einfacher. Wer auch immer glaubte, wir könnten einfach Abwärme verwenden, um das Zeug auszuhärten, war ein Narr. Von wegen Energie sparen!«
Banyat lächelt erneut verlegen, sagt jedoch nichts.
»Ihr habt also das Schneidewerkzeug ausgetauscht?«
»Die Zuverlässigkeit liegt jetzt bei fünfundzwanzig Prozent. «
»So viel besser?« Anderson nickt flüchtig. Er gibt dem Vorarbeiter des Stanzraumes ein Zeichen, und dieser ruft Num durch den Klärraum hindurch etwas zu. Die Alarmglocke läutet wieder; die Hitzepressen und Härtungslampen fangen an zu glühen, als Elektrizität in die Anlage strömt. Anderson weicht vor der plötzlichen Hitze zurück. Jedes Mal, wenn die Lampen und Pressen angeschaltet werden, entspricht das einer Kohlendioxidsteuer von fünfzehntausend Baht — für diesen Anteil am globalen Budget des Königreiches muss SpringLife ein hübsches Sümmchen hinlegen. Nur dank Yates’ genialer Machenschaften kann die Firma das Kontingent des Landes überhaupt anzapfen; die Bestechungsgelder dafür sind dennoch astronomisch.
Die zentralen Schwungräder setzen sich in Bewegung, und die ganze Fabrik erbebt, als das Getriebe im Untergeschoss einrastet. Die Holzdielen vibrieren. Kinetische Energie schießt durch die Anlage wie Adrenalin, eine kribbelnde Vorwegnahme der Energie, die gleich die Fertigungsstraße entlangströmen wird. Ein Megodont begehrt lauthals auf und wird mit einem Hieb zum Schweigen gebracht. Das Jaulen der Schwungräder wird zu einem Brüllen und verstummt dann, während Joule in das Antriebssystem fließen.
Die Glocke des ersten Vorarbeiters läutet erneut. Arbeiter treten vor, um die Schneidwerkzeuge auszurichten. Sie produzieren Zwei-Gigajoule-Spannfedern, und diese kleinere Größe bedarf besonderer Sorgfalt. Weiter unten am Fließband wird mit dem Aufwickeln begonnen, und die Stanzpresse mit ihren frisch reparierten Präzisionsklingen erhebt sich auf hydraulischen Winden zischend in die Luft.
»Khun, bitte.« Banyat signalisiert Anderson, er möge sich hinter einen Schutzkäfig begeben.
Nums Glocke läutet ein letztes Mal. Das Getriebe der Fertigungsstraße rastet ein. Als sich die Anlage in Bewegung setzt, verspürt Anderson ganz kurz so etwas wie Nervenkitzel. Die Arbeiter ducken sich hinter ihre Schutzschirme. Der glühende Faden der Spannfeder schießt aus Anschlussflanschen hervor und windet sich durch eine Reihe erhitzter Walzen. Stinkendes Reaktionsmittel ergießt sich über den rostfarbenen Draht und umhüllt ihn mit der glatten Schicht, die Yates’ Algenpulver aufnehmen und einen gleichmäßigen Überzug bilden wird.
Die Stanzpresse fährt ruckartig herab. Andersons Zähne schmerzen, so groß ist der Druck, der dabei entsteht. Der Spannfederdraht wird sauber abgetrennt, und das Drahtstück fließt durch den Vorhang und in den Klärraum. Dreißig Sekunden später kommt es wieder zum Vorschein, blassgrau und staubig von dem aus Algen hergestellten Pulver. Es schlängelt sich durch eine weitere Reihe erhitzter Walzen, bevor es in seine endgültige Gestalt gezwungen wird. Immer fester und enger wird der Strang aufgewickelt und in sich verdreht, wobei der ganze Widerstand seiner Molekularstruktur überwunden werden muss. Das Kreischen des gequälten Metalls betäubt die Ohren. Während die Feder zusammengedrückt wird, spritzen aus der Ummantelung Schmierstoffe und Algenreste auf Arbeiter und Maschinen; die gespannte Feder wird dann davongetragen, in ihr Gehäuse eingesetzt und zur QK weiterbefördert.
Eine gelbe LED gibt Entwarnung. Arbeiter stürzen aus ihren Käfigen hervor, um die Presse in Grundstellung zu bringen, während ein neuer Strom rostfarbenen Metalls aus den Eingeweiden der Härteräume schießt. Walzen klappern im Leerlauf. Gleitmitteldüsen versprühen einen feinen Nebel, während sie sich vor dem nächsten Einsatz selbsttätig reinigen. Die Arbeiter führen die letzten Handgriffe durch und ducken sich wieder hinter die Barrieren. Ein Fehler im System, und der Spannfederdraht würde sich in eine hochenergetische Klinge verwandeln und unkontrolliert durch die Fertigungshalle peitschen. Anderson hat schon erlebt, dass Köpfe wie Mangos aufgeschnitten und Körperteile abgetrennt wurden, während Blut wie auf einem Pollock-Gemälde überallhin spritzte …
Die Presse trennt eine weitere Spannfeder ab. Von den vierzig Stück, die stündlich hergestellt werden, landen jetzt offenbar nur noch fünfundsiebzig Prozent auf der Mülldeponie des Umweltministeriums. SpringLife gibt Millionen dafür aus, um Abfall zu produzieren, dessen Entsorgung wiederum Millionen kostet – ein zweischneidiges Schwert, das immer wieder herabfährt. Ob aus Versehen oder Gehässigkeit: Yates hat Mist gebaut. Und es hat über ein Jahr gebraucht, um zu erkennen, wie tiefgreifend das Problem ist, um die Algenbäder zu untersuchen, die die revolutionäre Beschichtung der Spannfedern hervorbringen, um für das Maisgranulat, das die Federn ummantelt, eine neue Zusammensetzung zu finden, um die Qualitätskontrolle effizienter zu gestalten, um zu verstehen, welche Auswirkungen eine Luftfeuchtigkeit von beinahe hundert Prozent auf ein Verfahren hat, das in einem trockeneren Klima entwickelt wurde.
Ein Arbeiter stolpert durch die Vorhänge, die den Klärraum abtrennen, dicht gefolgt von einer Wolke hellen Filterstaubs. Sein dunkles Gesicht ist schweißüberströmt und von einer Mischung aus Maismehl und Palmöl bedeckt. Durch die Vorhänge erhascht Anderson einen Blick auf seine Kollegen in der Düsternis der Staubwolke – Schatten in einem Schneesturm, derweil der Spannfederdraht mit dem Pulver umhüllt wird, das die Federn daran hindert, unter hohem Druck zu blockieren. All der Schweiß, all die Kalorien, ganz zu schweigen von dem Kohlendioxidkontingent — all das nur für eine glaubwürdige Tarnung, damit Anderson das Rätsel der Nachtschattengewächse und der Ngaw lösen kann.
Eine vernünftige Firma würde die Fabrik schließen. Selbst Anderson, der nicht viel von dem Verfahren versteht, in dem die Spannfedern der nächsten Generation hergestellt werden, würde das tun. Aber wenn die Arbeiter und die Gewerkschaften und die Weißhemden und die vielen aufmerksam lauschenden Ohren des Königreichs glauben sollen, dass er ein aufstrebender Unternehmer ist, dann muss die Fabrik in Betrieb bleiben, und zwar nach Kräften.
Anderson schüttelt Banyat die Hand und gratuliert ihm zu seiner guten Arbeit.
Wirklich schade. Das Erfolgspotenzial ist durchaus vorhanden. Wenn Anderson eine von Yates’ Federn sieht, die tatsächlich funktioniert, stockt ihm der Atem. Yates mochte verrückt gewesen sein, aber dumm war er nicht. Anderson hat selbst zugeschaut, wie Joule um Joule aus den winzigen Federgehäusen strömten, die stundenlang zufrieden vor sich hintickten, wo doppelt so schwere Federn nicht ein Viertel der Energie enthalten hätten oder beim Aufladen unter dem enormen Druck der Joule einfach in eine einzige von Molekularkräften zusammengehaltene Masse gepresst worden wären. Manchmal erliegt Anderson fast den Verlockungen von Yates’ Traum.
Er holt tief Luft und duckt sich zurück in den Klärraum. Auf der anderen Seite kommt er in einer Wolke aus Algenpulver und Rauch wieder heraus. Er atmet Luft ein, die nach zertrampeltem Megodontenkot riecht, und steigt die Treppe zu seinem Büro hinauf. Hinter ihm brüllt wieder einer der Megodonten, der Klagelaut eines misshandelten Tiers. Anderson dreht sich um, blickt in die Fertigungshalle hinunter und merkt sich den Mahout. Spindel Nummer 4. Ein weiterer Punkt auf der langen Liste der Probleme von SpringLife. Er öffnet die Tür zur Verwaltung.
In den Zimmern hat sich seit seinem ersten Besuch nicht viel verändert. Das Licht ist noch immer trübe, die gähnend leeren Schreibtische und Tretkurbelcomputer von schweigenden Schatten umgeben. Schmale Streifen aus Sonnenlicht dringen durch die Teakholzfensterläden und fallen auf Rauchopfer – Opfer an Götter, die Tan Hock Sengs chinesischen Klan auf der Malaiischen Halbinsel nicht retten konnten. Der Duft von Sandelholz erfüllt die Luft, und von einem Schrein in der Ecke, wo goldene Statuetten lächelnd über Schüsseln mit U-Tex-Reis und klebrigen, mit Fliegen bedeckten Mangos kauern, steigen seidige Rauchfäden auf.
Hock Seng sitzt bereits an seinem Computer. Seine knochigen Beine ratschen in stetem Rhythmus auf und ab, und die Tretkurbel versorgt den Mikroprozessor und den 12-Zentimeter-Bildschirm mit Energie. Anderson entgeht nicht das Flattern von Hock Sengs Augenlidern, das kurze Zusammenzucken – das Erschrecken eines Mannes, der um sein Leben fürchtet, sobald sich auch nur eine Tür öffnet. Die Bewegung des alten Mannes ist so flüchtig wie das Flimmern der Cheshire, die von einem Moment zum anderen auftauchen und verschwinden. Doch Anderson kennt die Yellow-Card-Flüchtlinge gut genug, um die unterdrückte Todesangst wahrzunehmen. Er schließt die Tür, das Brüllen der Fabrik wird leiser, und der alte Mann beruhigt sich wieder.
Anderson hustet und wedelt den aufsteigenden Rauch beiseite. »Hab ich Ihnen nicht gesagt, Sie sollen aufhören, dieses Zeug zu verbrennen?«
Hock Seng zuckt mit den Achseln, aber er hört nicht auf zu treten und zu tippen. »Soll ich die Fenster öffnen?« Sein Flüstern klingt wie Bambus, der über Sand kratzt.
»Himmel, nein.« Anderson verzieht das Gesicht — vor dem Fenster herrscht tropische Hitze. »Bringen Sie Ihre Rauchopfer künftig zu Hause dar. Ich will das hier nicht mehr haben.«
»Ja. Natürlich.«
»Ich meine es ernst.«
Hock Seng blickt ganz kurz auf, bevor er sich wieder auf den Bildschirm konzentriert. Seine Wangenknochen und seine Augenhöhlen zeichnen sich im Schein des Monitors überdeutlich ab. Seine Spinnenfinger fliegen über die Tasten. »Das bringt Glück«, murmelt er und kichert heiser. »Auch fremde Teufel brauchen Glück. Bei den ganzen Problemen in der Fabrik dachte ich, Sie wüssten die Hilfe Budais zu schätzen.«
»Nicht hier.« Anderson wirft seine gerade erst erworbenen Ngaw auf den Tisch und lässt sich auf seinen Stuhl fallen. Fährt sich über die Stirn. »Verbrennen Sie das Zeug zu Hause.«
Hock Seng neigt leicht den Kopf — er hat verstanden. Kurbelventilatoren drehen sich träge an der Decke; Bambusblätter kämpfen keuchend gegen die Hitze an. Die beiden Männer sitzen wie von der Welt abgeschnitten da, um sie herum die Ruinen von Yates’ prächtigem Plan. Reihen leerer Schreibtische und Computerarbeitsplätze erstrecken sich schweigend, wo sich Verkäufer, Vertriebsleute und Sekretärinnen tummeln sollten.
Anderson schaut sich die Ngaw an. Hält eine seiner mit grünen Borsten bewachsenen Entdeckungen in die Höhe, damit Hock Seng sie sehen kann. »Haben Sie so etwas schon einmal in Händen gehalten?«
Hock Seng blickt kurz auf. »Die Thai nennen sie Ngaw.« Er wendet sich wieder seiner Arbeit zu, kämpft sich durch Tabellen, die nie einen Sinn ergeben werden, durch rote Tinte, die in keinem Bericht je Erwähnung finden wird.
»Ich weiß, wie die Thai sie nennen.« Anderson steht auf und geht zum Schreibtisch des alten Mannes hinüber. Als er die Ngaw neben den Computer legt, zuckt Hock Seng zusammen und betrachtet die Frucht, als sei sie ein Skorpion. Anderson sagt: »Das hätten mir die Bauern auf dem Markt auch verraten können. Hatten Sie die unten in Malaya auch?«
»Ich …« Hock Seng fängt an zu sprechen, hält dann aber inne. Er ringt spürbar um Selbstbeherrschung, während sich auf seinem Gesicht die unterschiedlichsten Gefühle abzeichnen. »Ich …« Wieder verstummt er.
Anderson beobachtet, wie die Angst Hock Sengs Züge in immer neue Formen gießt. Weniger als ein Prozent der Flüchtlinge hat den »Malaiischen Zwischenfall« überlebt. Hock Seng hat, an jedem Maßstab gemessen, ausgesprochen Glück gehabt, und trotzdem tut er Anderson leid. Eine einfache Frage, eine Frucht, die vor ihm auf dem Tisch liegt, und schon sieht der alte Mann aus, als würde er gleich schreiend aus der Fabrik fliehen.
Hock Seng starrt die Ngaw an und atmet pfeifend ein und aus. Schließlich murmelt er: »Nicht in Malaya. So schlau wie die Thai ist bei solchen Sachen niemand.« Und dann arbeitet er weiter, die Augen auf den Bildschirm gerichtet, die Erinnerungen weggesperrt.
Anderson wartet, ob Hock Seng nicht vielleicht doch noch etwas verrät, aber der alte Mann verzieht keine Miene mehr. Das Rätsel der Ngaw wird warten müssen.
Anderson kehrt an seinen eigenen Schreibtisch zurück und geht die Post durch. Quittungen und Steuerunterlagen, die Hock Seng an einer Ecke des Schreibtischs aufgestapelt hat, verlangen nach seiner Aufmerksamkeit. Er beginnt, den Stoß abzuarbeiten, setzt seine Unterschrift unter Gehaltsschecks der Megodonten-Gewerkschaft und den SpringLife-Stempel unter Genehmigungen zur Abfallentsorgung. Immer wieder zupft er an seinem Hemd und fächelt sich Luft zu – die Hitze scheint zunehmend drückender zu werden.
Schließlich blickt Hock Seng auf. »Banyat hat nach Ihnen gefragt.«
Anderson nickt, von den Formularen abgelenkt. »Er hat auf der Stanzmaschine Rost entdeckt. Der Ersatzstempel hat die Zuverlässigkeit um fünf Prozent verbessert.«
»Fünfundzwanzig Prozent, ja?«
Anderson zuckt mit den Schultern und setzt seinen Stempel unter einen Kohlendioxidbescheid des Umweltministeriums. »Das behauptet er zumindest.« Er faltet das Schriftstück zusammen und schiebt es in den Umschlag zurück.
»Das ist noch immer keine profitable Quote. Ihre Federn schlucken nur und geben nichts wieder her. Sie klammern sich an die Joule wie der Somdet Chao Phraya an die Kindskönigin. «
Anderson beißt sich verärgert auf die Lippen, macht sich aber nicht die Mühe, die wechselhafte Qualität zu verteidigen.
»Hat Banyat Ihnen auch von den Nährstofftanks erzählt?«, fragt Hock Seng. »Die für die Algen?«
»Nein. Nur von dem Rost. Warum?«
»Sie sind verunreinigt. Manche der Algen produzieren keinen … «, Hock Seng zögert, »… keinen Überstand. Sie sind nicht produktiv.«
»Das hat er mir gegenüber nicht erwähnt.«
Wieder ein kurzes Zögern. Dann: »Bestimmt hat er es versucht. «
»Hat er gesagt, wie schlimm es ist?«
Hock Seng zuckt mir den Achseln. »Nur, dass der Überstand nicht den Maßgaben entspricht.«
Anderson zieht ein mürrisches Gesicht. »Ich werde ihn rauswerfen. In der QK kann ich niemanden gebrauchen, der mir nicht sagen kann, wenn etwas schiefläuft.«
»Vielleicht haben Sie nicht gut genug aufgepasst.«
Anderson fallen einige Dinge ein, die auf einen Mann passen würden, dem es nicht gelingt, ein bestimmtes Thema anzusprechen, aber das Gebrüll eines Megodonten aus der Halle reißt ihn aus seinen Gedanken. Es ist so laut, dass die Fenster wackeln. Anderson hält inne und wartet auf ein zweites Brüllen.
»Das ist die Energiespindel Nummer 4«, sagt er schließlich. »Der Mahout ist unfähig.«
Hock Seng blickt nicht von seiner Tastatur auf. »Das sind Thai. Sie sind alle unfähig.«
Anderson unterdrückt ein Lachen. »Nun, dieser spezielle Mahout ist noch schlimmer als die anderen.« Er wendet sich wieder seiner Post zu. »Ich möchte, dass er abgelöst wird. Spindel Nummer 4. Bitte merken Sie sich das.«
Hock Sengs Tretkurbel kommt aus dem Rhythmus. »So einfach geht das nicht. Sogar der Kadaverkönig verneigt sich vor der Megodonten-Gewerkschaft. Ohne die Kraft der Megodonten bleiben nur die Joule der Menschen. Und das ist keine besonders gute Verhandlungsposition.«
»Das ist mir egal. Ich will, dass er verschwindet. Wir können uns keine Stampede leisten. Finden Sie einen höflichen Weg, ihn loszuwerden.« Anderson zieht einen weiteren Stapel Gehaltsschecks, die auf seine Unterschrift warten, zu sich heran.
Hock Seng versucht es noch einmal. »Khun, Verhandlungen mit der Gewerkschaft sind eine komplizierte Angelegenheit. «
»Dafür habe ich ja auch Sie. Das nennt man Delegieren.« Anderson fächelt sich mit den Papieren Luft zu.
»Ja, selbstverständlich.« Hock Seng mustert ihn ausdruckslos. »Vielen Dank für die Unterweisung.«
»Sie erklären mir doch dauernd, ich würde von der hiesigen Kultur nichts verstehen«, sagte Anderson. »Also, kümmern Sie sich darum. Sorgen Sie dafür, dass der Kerl verschwindet. Es ist mir gleichgültig, ob Sie höflich sind oder ob alle Beteiligten das Gesicht verlieren. Finden Sie nur einen Weg, ihn zu feuern. Es ist gefährlich, so jemanden in der Antriebskolonne zu haben.«
Hock Seng schürzt die Lippen, widerspricht jedoch nicht mehr. Anderson beschließt, davon auszugehen, dass seinen Anweisungen Folge geleistet wird. Er blättert ein weiteres Genehmigungsschreiben des Umweltministeriums durch und verzieht das Gesicht. Nur Thai verschwenden so viel Zeit darauf, Bestechungsgelder wie eine Dienstleistungsübereinkunft aussehen zu lassen. Sie sind höflich, sogar dann noch, wenn sie dich erpressen. Oder wenn es ein Problem mit den Algentanks gibt. Banyat …
Anderson schiebt die Formulare auf seinem Tisch hin und her. »Hock Seng?«
Der alte Mann zuckt nicht mit der Wimper. »Ich werde mich um Ihren Mahout kümmern«, sagt er, während er weitertippt. »Ich werde das erledigen; auch wenn Sie das eine Stange Geld kosten wird, wenn die Verhandlungen um die Gratifikationen wieder anstehen.«
»Gut zu wissen, aber das ist nicht meine Frage.« Anderson trommelt auf seinen Schreibtisch. »Sie haben gesagt, Banyat hätte sich über die Produktion der Algen beklagt. Hat er Probleme mit den neuen Tanks? Oder mit den alten?«
»Ich … Da hat er sich nicht festgelegt.«
»Haben Sie mir nicht gesagt, letzte Woche sei von den Ankerplätzen Nachschub eingetroffen? Neue Tanks, neue Nährstofflösungen?«
Hock Sengs Finger geraten einen Moment lang ins Stocken. Anderson tut so, als wäre er verwirrt, während er noch einmal in seinen Papieren kramt; dabei weiß er bereits, dass die Empfangsbestätigungen und Quarantäneformulare nicht da sind. »Ich sollte irgendwo hier eine Liste haben. Ich bin mir ganz sicher, dass Sie gesagt haben, alles würde pünktlich eintreffen. « Er blickt auf. »Je mehr ich darüber nachdenke, umso mehr bin ich überzeugt, dass es Probleme wie Verunreinigungen eigentlich gar nicht mehr geben sollte. Nicht wenn das neue Material schon durch den Zoll ist und installiert wurde.«
Hock Seng bleibt ihm die Antwort schuldig. Tippt einfach weiter, als hätte er nichts gehört.
»Hock Seng? Gibt es da etwas, was Sie mir nicht erzählt haben?«
Hock Seng starrt weiterhin wie gebannt auf das graue Glimmen seines Bildschirms. Anderson wartet. Das rhythmische Knarren der Ventilatoren und das Ratschen von Hock Sengs Tretkurbel sind in der Stille überdeutlich zu hören.
»Uns liegt noch kein Ladungsverzeichnis vor«, sagt der alte Mann schließlich. »Die Lieferung ist immer noch beim Zoll.«
»Aber sie hätte doch schon letzte Woche freigegeben werden sollen.«
»Es ist zu Verzögerungen gekommen.«
»Sie haben mir erklärt, es würde keine Schwierigkeiten geben«, sagt Anderson. »Sie waren sich ganz sicher. Sie haben mir erklärt, Sie würden sich persönlich darum kümmern. Ich habe Ihnen sogar noch zusätzlich Bargeld gegeben, damit das auf jeden Fall klappt.«
»Bei den Thai gehen die Uhren anders. Vielleicht trifft alles heute Nachmittag ein. Vielleicht morgen.« Hock verzieht das Gesicht zu etwas, das einem Grinsen ähnlich sieht. »Sie sind nicht wie wir Chinesen. Sie sind faul.«
»Haben Sie die Gelder denn überhaupt ausgezahlt? Das Handelsministerium sollte einen Anteil davon bekommen und an ihre geliebten Weißhemden weiterreichen.«
»Ich habe sie bezahlt.«
»In ausreichender Höhe?«
Hock Seng blickt auf, die Augen zu Schlitzen verengt. »Ich habe sie bezahlt.«
»Sie haben nicht etwa die Hälfte bezahlt und die Hälfte behalten?«
Hock Seng lacht nervös. Natürlich habe ich alles bezahlt.«
Anderson mustert den Yellow Card noch einen Moment länger und versucht einzuschätzen, wie ehrlich er ist, gibt dann jedoch auf und wirft die Papiere auf seinen Schreibtisch. Er weiß nicht einmal, weshalb ihn das überhaupt kümmert, aber es ärgert ihn, dass der alte Mann glaubt, ihn so leicht täuschen zu können. Sein Blick fällt wieder auf den Beutel mit den Ngaw. Vielleicht ahnt Hock Seng, wie nebensächlich die Fabrik ist … Er verdrängt den Gedanken und hakt noch einmal nach. »Also morgen?«
Hock Seng neigt den Kopf. »Mit allergrößter Wahrscheinlichkeit. «
»Da bin ich ja mal gespannt.«
Hock Seng schenkt der sarkastischen Erwiderung keine Beachtung. Anderson fragt sich, ob er sie überhaupt verstanden hat. Der alte Mann kann außergewöhnlich gut Englisch, aber hin und wieder, wenn die Sprache eher in der Kultur zu wurzeln scheint denn im Vokabular, geraten sie in eine Sackgasse.
Anderson wendet sich wieder seiner Büroarbeit zu. Steuerformulare hier. Gehaltsschecks dort. Die Arbeiter kosten doppelt so viel, wie sie eigentlich kosten sollten. Noch so ein Problem im Umgang mit dem Königreich. Thailändische Arbeiter für thailändische Arbeitsplätze. Auf den Straßen verhungern die Yellow-Card-Flüchtlinge aus Malaya, und er darf sie nicht einstellen. Von Rechts wegen müsste Hock Seng zusammen mit allen anderen Überlebenden des Malaiischen Zwischenfalls draußen in den Schlangen vor den Jobbörsen stehen. Er hat es nur seinen Fremdsprachenkenntnissen und seinen Fertigkeiten in Buchhaltung — und Yates’ Nachsichtigkeit — zu verdanken, dass er noch am Leben ist.
Über einem weiteren Umschlag hält Anderson inne. Er ist an ihn persönlich adressiert, aber wie fast immer ist das Siegel erbrochen. Mit dem Postgeheimnis hat Hock Seng so seine Probleme. Sie haben das wiederholt besprochen, aber der alte Mann macht weiterhin »Fehler«.
Aus dem Umschlag zieht Anderson eine kleine Karte — eine Einladung. Von Raleigh, der ein Treffen vorschlägt.
Nachdenklich klopft Anderson mit der Karte auf den Schreibtisch. Raleigh. Abschaum der Großen Expansion. Ein uraltes Stück Treibgut, das nach der Flut zurückgeblieben ist. Aus einer Zeit, als Erdöl noch billig war und Männer und Frauen den Globus innerhalb von Stunden, nicht von Wochen umrundeten.
Als der letzte Jumbojet laut grollend von den überfluteten Startbahnen Suvarnabhumis abhob, da hatte Raleigh knietief im ansteigenden Meerwasser gestanden und dem großen Flieger sehnsüchtig nachgeblickt. Dann hatte er Zuflucht bei seinen diversen Freundinnen gesucht, sie alle überlebt und sich neue genommen, während er aus Zitronengras, Baht und Opium ein neues Leben aus dem Boden stampfte. Wenn man seinen Geschichten Glauben schenken durfte, hat er Putsche und Gegenputsche überlebt, Kalorienseuchen und Hungersnöte. Inzwischen hockt der alte Mann wie eine mit Leberflecken gesprenkelte Kröte in seinem Ploenchit-«Club« und lächelt selbstzufrieden, während er frisch eingetroffene Ausländer in der verlorenen Kunst der Ausschweifung aus der Zeit vor der »Großen Kontraktion« unterrichtet.
Anderson wirft die Karte auf den Schreibtisch. Was auch immer der alte Mann beabsichtigen mag – die Einladung ist einigermaßen unverfänglich. Raleigh hat nicht so lange im Königreich gelebt, ohne selbst eine gewisse Paranoia zu entwickeln. Anderson lächelt flüchtig und blickt zu Hock Seng hinüber. Die beiden würden ein gutes Paar abgeben: zwei entwurzelte Seelen, zwei Männer weit weg von ihrer Heimat, die ihr Überleben ihrem scharfen Verstand und ihrer Paranoia verdanken …
»Wenn Sie schon nichts anderes tun, als mir beim Arbeiten zuzuschauen«, sagt Hock Seng, »die Megodonten-Gewerkschaft möchte ihre Tarife neu aushandeln.«
Anderson betrachtet die Rechnungen, die sich auf seinem Schreibtisch stapeln. »Ich bezweifle, dass sie das so höflich formuliert haben.«
Hock Sengs Stift hält inne. »Die Thai sind immer höflich. Sogar wenn sie einem drohen.«
Der Megodont in der Halle unter ihnen schreit erneut.
Anderson wirft Hock Seng einen vielsagenden Blick zu. »Dann haben Sie ja etwas in der Hand, wenn es darum geht, den Mahout an Nummer 4 loszuwerden. Teufel auch, vielleicht sollte ich denen gar nichts mehr bezahlen, bis wir diesen Scheißkerl los sind.«
»Die Gewerkschaft ist mächtig.«
Ein weiteres Brüllen erschüttert die Fabrik, und Anderson zuckt zusammen. »Und strohdumm!« Sein Blick schweift zum Aussichtsfenster. »Was zum Teufel machen die nur mit dem Tier?« Er gibt Hock Seng ein Zeichen. »Kümmern Sie sich darum.«
Hock Seng scheint erst widersprechen zu wollen, doch Anderson starrt ihn wütend an. Der alte Mann steht auf.
Ein lauter Trompetenstoß hindert ihn daran, irgendwelche Einwände vorzubringen. Das Aussichtsfenster klappert in seinem Rahmen.
»Was zum …«
Ein weiterer ohrenbetäubender Klagelaut erschüttert das Gebäude, gefolgt von einem mechanischen Kreischen: Das Räderwerk blockiert. Anderson springt auf und rennt zum Fenster, aber Hong Seng erreicht es vor ihm. Mit offen stehendem Mund starrt der alte Mann durch die Scheibe.
Tellergroße gelbe Augen starren aus gleicher Höhe zurück. Der Megodont hat sich auf die Hinterbeine aufgerichtet und schwankt hin und her. Die vier Stoßzähne der Bestie sind aus Sicherheitsgründen abgesägt. Dennoch handelt es sich um ein Monstrum mit einer Schulterhöhe von fünf Metern – zehn Tonnen Muskeln und geballte Wut. Der Megodont zerrt an den Ketten, die ihn an die Spindel fesseln. Der Rüssel hebt sich, darunter kommt ein gewaltiger Rachen zum Vorschein. Anderson presst sich die Hände auf die Ohren.
Das Gebrüll brandet durch die Scheibe über ihn hinweg. Anderson fällt betäubt auf die Knie. »Herrgott!« Ihm klingeln die Ohren. »Wo ist dieser Mahout?«
Hock Seng schüttelt den Kopf. Anderson bezweifelt, dass er ihn überhaupt gehört hat. Auch für ihn klingen alle Geräusche gedämpft und weit entfernt. Er taumelt zur Tür und reißt sie auf – und in dem Moment kracht der Megodont auf die Spindel Nummer 4 herab. Die Antriebsspindel zerbricht. Teakholzsplitter stieben in alle Richtungen. Anderson zuckt zusammen, als sie an ihm vorbeischießen; seine Haut brennt wie von Nadelstichen.
Unten lösen die Mahout fieberhaft die Ketten ihrer Tiere und ziehen sie von dem rasenden Ungeheuer fort; mit lauten Rufen versuchen sie, den elefantenartigen Kreaturen ihren Willen aufzuzwingen. Die Megodonten schütteln die Köpfe und wehren sich ächzend, zerren, von dem instinktiven Verlangen getrieben, ihrem Artgenossen zu helfen, an ihrem Geschirr. Die übrigen Thaiarbeiter fliehen auf die Straße.
Der rasende Megodont stürzt sich erneut auf die Spindel. Speichen zerbrechen. Der Mahout, der die Bestie hätte unter Kontrolle halten sollen, ist nur noch eine breiige Masse aus Blut und Knochen auf dem Boden.
Anderson hastet in das Büro zurück. Er schlängelt sich zwischen den leeren Schreibtischen hindurch, springt auf eine Tischplatte, schlittert über sie hinweg und landet vor dem Tresor der Firma.
Seine Finger rutschen ab, während er am Zahlenschloss dreht. Schweiß rinnt ihm in die Augen. 23 rechts. 106 links … Seine Hand gleitet zur nächsten Nummernscheibe, und er betet, dass er sich nicht vertut und wieder von vorne anfangen muss. Unten in der Fertigungshalle geht noch mehr Holz zu Bruch, und jemand schreit vor Schmerz.
Hock Seng taucht dicht neben seinem Ellenbogen auf.
Anderson vertreibt den alten Mann mit einer Geste. »Sag den Leuten, sie sollen machen, dass sie hier rauskommen! Alle! Alle sollen das Gebäude verlassen!«
Hock Seng nickt, bleibt jedoch stehen, während sich Anderson weiter mit den Zahlenschlössern abplagt.
Anderson sieht ihn wütend an. »Na los!«
Hock Seng nickt zustimmend und rennt laut rufend zur Tür; seine Stimme verliert sich zwischen den Schreien der fliehenden Arbeiter und dem Bersten des Hartholzes. Anderson dreht an der letzten Scheibe und reißt den Tresor auf: Akten, Stapel von bunt schillerndem Geld, geheime Unterlagen, ein Luftgewehr … eine Federpistole.
Yates.
Er verzieht das Gesicht. Heute scheint der alte Saubär überall zu sein, als würde sein Phii auf Andersons Schulter hocken. Mit einer fließenden Handbewegung zieht Anderson die Feder der Handfeuerwaffe auf und steckt sie sich in den Gürtel. Dann greift er nach dem Luftgewehr. Überprüft, ob es geladen ist, während hinter ihm ein weiterer Schrei ertönt. Wenigstens war Yates auf so etwas vorbereitet. Der Mistkerl mochte naiv gewesen sein, aber dumm war er nicht. Anderson pumpt Luft in den Gewehrkolben und eilt mit großen Schritten zur Tür.
Unten in der Fertigungshalle spritzt Blut auf die Antriebssysteme und die QK-Laufbänder. Es ist nur schwer zu erkennen, wer umgekommen ist. Keinesfalls nur der eine Mahout. Der süßliche Gestank menschlicher Eingeweide breitet sich aus. Gedärme zieren die Spindel, die der Megodont umrundet hat. Das Tier erhebt sich erneut auf die Hinterbeine, ein Berg transgener Muskeln, die sich ihrer letzten Fesseln erwehren.
Anderson hebt das Gewehr. Am Rande seines Blickfeldes richtet sich ein weiterer Megodont auf und trompetet sein Mitgefühl hinaus. Die Mahout verlieren zunehmend die Kontrolle. Er zwingt sich, das um sich greifende Chaos zu ignorieren, und legt sein Auge an das Visier.
Das Fadenkreuz gleitet über eine verkrustete Wand aus faltigem Fleisch. In der Vergrößerung des Visiers ist das Tier so riesig, dass er es nicht verfehlen kann. Er schaltet das Gewehr auf Vollautomatik, atmet aus und lässt den Druck aus der Gaskammer entweichen.
Ein Sturm von Pfeilen schießt aus der Mündung. Grellorange Punkte sprenkeln die Haut des Megodonten, jeder Schuss ein Treffer. Das von AgriGen entwickelte hochkonzentrierte Wespengift strömt durch den Leib des Tieres und nimmt Kurs auf sein zentrales Nervensystem.
Anderson lässt das Gewehr sinken. Ohne die Vergrößerung des Visiers kann er die winzigen Pfeile in der Haut der Bestie kaum erkennen. Noch wenige Augenblicke, dann wird sie tot sein.
Der Megodont dreht sich herum und richtet seine Aufmerksamkeit auf Anderson; in seinen Augen blitzt die Wut des Pleistozäns. Wider Willen ist Anderson von der Intelligenz des Tiers beeindruckt. Fast scheint es, als wüsste die Kreatur, was er getan hat.
Der Megodont spannt die Muskeln an und zerrt mit ganzer Kraft an seinen Fesseln. Gusseiserne Kettenglieder bersten und pfeifen durch die Luft, krachen in die Fließbänder. Ein fliehender Arbeiter geht zu Boden. Anderson lässt das Luftgewehr fallen und reißt die Federpistole aus dem Gürtel. Gegen die zehn Tonnen erzürnter Bestie ist sie ein Spielzeug, aber sie ist alles, was er noch hat. Der Megodont stürzt los, und Anderson feuert, betätigt den Abzug so schnell, wie seine Finger sich krümmen. Messerscharf geschliffene Scheiben prallen nutzlos von der anrollenden Lawine ab.
Der Megodont reißt ihn mit dem Rüssel von den Füßen. Wie eine Python umschlingt das Greiforgan seine Beine. Anderson strampelt verzweifelt mit den Beinen und versucht, sich am Türpfosten festzuhalten. Der Rüssel drückt zu. Blut schießt Anderson in den Kopf. Er fragt sich, ob das Ungeheuer ihn einfach wie einen Moskito zerquetschen will, doch das Tier zerrt ihn vom Balkon herunter. Anderson versucht noch, am Geländer Halt zu finden, doch dann hebt er ab – und befindet sich in freiem Flug.
Das frohlockende Trompeten des Megodonten hallt durch das Gebäude, während Anderson durch die Luft segelt. Der Fabrikboden kommt auf ihn zugerast. Er kracht auf den Beton. Finsternis droht ihn zu verschlucken. Leg dich hin und stirb. Anderson wehrt sich gegen die Bewusstlosigkeit. Einfach nur sterben.
Er versucht aufzustehen oder wegzurollen – irgendetwas. Aber er kann sich nicht bewegen.
Bunte Schemen tanzen vor seinen Augen. Der Megodont kommt immer näher. Anderson kann seinen Atem riechen.
Die farbigen Flecken verschwimmen, der Megodont nimmt fast sein ganzes Gesichtsfeld ein. Krustige Haut und uralte Wut. Er hebt einen Fuß, um ihn zu zerquetschen. Anderson rollt auf die Seite, doch seine Beine wollen ihm nicht gehorchen. Nicht einmal mehr wegkriechen kann er. Seine Hände scharren über den Beton wie Spinnen auf Eis. Er kann sich nicht schnell genug bewegen. Himmelherrgott, so möchte ich nicht sterben. Nicht hier. Nicht so … Er kommt sich vor wie eine Echse, deren Schwanz eingeklemmt ist. Er kann nicht aufstehen, er kann nicht fliehen, er wird sterben – Gelee unter dem Fuß eines überdimensionierten Elefanten.
Der Megodont stöhnt auf. Anderson hebt den Kopf. Das Tier hat den Fuß wieder gesenkt. Es schwankt, wie betrunken, tastet mit seinem Rüssel umher. Und dann, plötzlich, geben seine Hinterbeine nach. Das Ungeheuer hockt sich auf den Boden und sieht aus wie ein Hund, geradezu lächerlich. Fast scheint es ratlos dreinzuschauen — völlig überrascht, dass sein Körper ihm nicht mehr gehorcht.
Ganz langsam spreizen sich seine Vorderbeine, und es sinkt ächzend auf Stroh und Dung. Die Augen des Megodonten befinden sich nun auf gleicher Höhe mit Anderson. Sie starren ihn an, fast wie ein Mensch, und blinzeln verwirrt. Der Rüssel streckt sich wieder nach ihm aus, eine Python aus Muskeln und Instinkt, jetzt allerdings völlig unkoordiniert. Das Maul steht offen, keucht vernehmlich. Heiße, süßliche Luft brandet über Anderson hinweg. Der Rüssel greift nach ihm. Bekommt ihn nicht mehr zu fassen.
Anderson schleppt sich langsam außer Reichweite. Stemmt sich auf die Knie hoch und zwingt sich schließlich aufzustehen. Benommen schwankt er hin und her, stellt sich dann breitbeinig hin und findet sein Gleichgewicht. Eines der gelben Augen des Megodonten folgt seinen Bewegungen. Alle Wut ist daraus gewichen. Augenlider mit langen Wimpern blinzen. Anderson fragt sich, was das Tier wohl denkt. Ob es die neurale Verwüstung spüren kann, die durch seinen Körper tobt? Ob es weiß, dass sein Ende bevorsteht? Oder ob es einfach nur müde ist?
Wie er so über dem Megodonten steht, empfindet Anderson fast Mitleid. Wo einst Stoßzähne aufragten, sind nur vier schartige Ovale zu sehen, schmutzige Elfenbeinflecken, unbarmherzig abgesägt. An den Knien glänzen wunde Stellen, der Mund ist von Krätzenschimmel entstellt. Die Rippen heben und senken sich kaum wahrnehmbar. Aus der Nähe betrachtet, handelt es sich nur noch um eine missbrauchte Kreatur, die Muskeln gelähmt, dem Tod nahe. Dieses Ungeheuer war nie für den Kampf bestimmt.
Dem Megodonten entfährt ein letzter Atemzug. Sein Körper sinkt in sich zusammen.
Überall um Anderson herum drängen sich Menschen, schreien, zerren an ihm, versuchen, ihren Verwundeten zu helfen und ihre Toten zu finden. Zu viele Menschen – in Rot und Gold, den Farben der Gewerkschaft, in grünen SpringLife-Overalls. Und Mahout, die über den gewaltigen Kadaver klettern.
Für einen Moment glaubt Anderson, Yates neben sich stehen zu sehen; er raucht seinen Tabak und weidet sich an der ganzen Katastrophe. »Und Sie haben behauptet, Sie wären allerhöchstens einen Monat hier.« Dann ist Hock Seng neben ihm, mit flüsternder Stimme und schwarzen Mandelaugen. Eine knochige Hand hebt sich und berührt ihn am Hals. Die Finger färben sich rot.
»Sie bluten«, murmelt der alte Mann.
2
»Und hoch!«, ruft Hock Seng. Pom und Nu und Kukrit und Kanda stemmen sich alle gegen die geborstene Spindel und ziehen sie aus der Wiege wie einen Splitter, der einem Riesen aus dem Fleisch gezogen wird. Sie wuchten sie so weit heraus, bis Mai, ein kleines Mädchen, in den Zwischenraum darunter kriechen kann.
»Ich kann nichts sehen!«, ruft sie.