
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gerstenberg Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Leipzig, 1936. Am ersten Tag der Sommerferien wird der 16-jährige Harro in eine Prügelei mit Hitlerjungs verwickelt. Unverhofft bekommt er Hilfe von Gleichgesinnten, die wie er nichts mit der Nazi-Ideologie zu tun haben wollen. In dem Jahr, das folgt, ändert sich für Harro alles. Reibereien mit den Eltern und Ärger in der Schule, Nächte am Lagerfeuer, politische Aktionen, erste Liebe. Und über allem die bange Ahnung, dass sein wildes Treiben gefährliche Konsequenzen haben kann. Die »Leipziger Meuten«, oppositionelle Jugendcliquen ähnlich den »Edelweißpiraten«, haben Johannes Herwig zu seinem Debüt inspiriert. Kraftvoll, mitreißend und emotional erzählt Herwig vom Erwachsenwerden in einer Diktatur. Die Fragen, die er dabei stellt, sind heute so aktuell wie damals: Mitmachen, sich still anpassen oder Kontra geben?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 267
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für dich
INHALT
PROLOG
KAPITEL 1
KAPITEL 2
KAPITEL 3
KAPITEL 4
KAPITEL 5
KAPITEL 6
KAPITEL 7
KAPITEL 8
KAPITEL 9
KAPITEL 10
KAPITEL 11
KAPITEL 12
KAPITEL 13
KAPITEL 14
KAPITEL 15
KAPITEL 16
KAPITEL 17
KAPITEL 18
KAPITEL 19
KAPITEL 20
KAPITEL 21
KAPITEL 22
KAPITEL 23
KAPITEL 24
KAPITEL 25
KAPITEL 26
KAPITEL 27
KAPITEL 28
KAPITEL 29
KAPITEL 30
KAPITEL 31
KAPITEL 32
Postskriptum
Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen,
die sich über die Dinge ziehn.
Ich werde den letzten vielleicht nicht vollbringen,
aber versuchen will ich ihn.
Rainer Maria Rilke
PROLOG
Der Zigarettenrauch vor der Schreibtischlampe des Kommissars stieg in den Raum wie eine Erscheinung aus dem Moor. Die Arbeitsfläche des Tischs war grell erleuchtet, der Rest des Zimmers lag in unergründlicher Dunkelheit. Ich sah fleischige Finger, die ein Büchlein hielten. Es war lächerlich winzig. »Was wir suchen, ist alles«, stand auf dem Einband. In dem gläsernen Aschenbecher daneben qualmte eine Kippe, deren Glut sich träge ihren Weg fraß.
»Hinsetzen«, sagte der Kopf, von dem ich nur die Umrisse erkennen konnte. Das Büchlein deutete dabei in Richtung eines Stuhls. Ich tat wie geheißen und wartete. Langsam gewöhnten sich meine Augen an das trübe Licht und ich konnte ein wenig des Interieurs ausmachen: hohe Schränke, eine Garderobenstange, die aussah wie eine mittelalterliche Waffe, ein zweiter Schreibtisch.
Die Zigarette erlosch. Der Kommissar hatte kein einziges Mal an ihr gezogen. Für Minuten passierte nichts. Mein Gegenüber blätterte nicht einmal in seinem Buch. Beinahe dachte ich, er hätte mich vergessen, und überlegte, mich in irgendeiner Form bemerkbar zu machen, als er endlich anfing zu sprechen.
»Harro Jäger. Adolf-Hitler-Straße 157. Sechzehn Jahre alt. Schüler. Tatsachen so weit?« Er legte das Büchlein beiseite, aufgeschlagen.
»Korrekt«, bestätigte ich förmlich.
»Du gehst gern in die Schule? Bist ein guter Schüler?« Das klang nach Feststellungen, nicht nach Fragen.
»Ich bemühe mich.« Der Kopf nickte.
»In der Freizeit, was machst du in der Freizeit?«
»Nichts Besonderes«, sagte ich. »Das, was alle machen. Körper und Geist trainieren. Lesen. Sport. Spazieren gehen.« Der Kopf nickte wieder.
»Du bist spät in die HJ eingetreten. Und umso früher wieder abberufen worden. Warum?« Der Kopf des Kommissars schob sich weiter nach vorne, ins Licht. Der Mann war jünger, als ich gedacht hatte.
»Differenzen mit dem Kameradschaftsführer. Hatte nichts zu tun mit der Organisation.« Das war gar nicht mal gelogen. Der Kommissar zeigte keine Regung und griff nach seinen Zigaretten. In sein Feuerzeug war ein Hakenkreuz geprägt, das, schnippte man den Deckel hoch, in der Mitte auseinanderklappte.
»Konrad Weißgerber? Sagt dir was?« Erneut mehr eine Feststellung. Hilmas Bruder. Ich entschied, mich so ahnungslos wie möglich zu stellen, und verneinte. Die neue Zigarette wanderte in den Aschenbecher. Wunderliche Formen aus Rauch begannen, über dem Tisch zu tanzen.
»Harry Sommer? Kennst du den?« Ich schüttelte den Kopf.
»Sagt mir nichts. Überhaupt nichts.«
»Breiter Kerl. Unmöglich zu übersehen«, hakte der Kommissar nach. Nun ahnte ich, wen er meinte. Ich blieb beim Nein. Die Finger griffen nach der brennenden Kippe und klopften die Asche ab. Dann nahm der Kommissar einen langen, knisternden Zug, fixierte mich und drehte den Lichtkegel der Lampe in mein Gesicht, sodass ich blinzeln musste.
»Heinrich Umrath? Was ist mit dem?«
»Mal getroffen. Keine nahe Bekanntschaft«, sagte ich, so unbeteiligt es ging. Alles konnte ich ja auch nicht abstreiten, zumal er nach meinem Nachbarn fragte. Die Zigarette, erneut im Becher abgelegt, warf einen Funken, als wäre versehentlich ein Körnchen Schwarzpulver im Tabak gelandet.
»Wo?«, fragte der Kommissar, und als ich nicht gleich reagierte, fügte er an: »Wo getroffen?«
»Auf der Straße«, sagte ich. »Auf der Straße mal.« Das weiße Licht der Lampe blendete. Ich schaute unter der Innenfläche meiner Hand hervor.
»Auf der Straße mal«, wiederholte der Kommissar. Ich hörte, wie einfältig diese Antwort war. In meinem Hals kitzelte es und ich gab mir Mühe, mich nicht zu räuspern. Stattdessen rutschte ich auf dem Stuhl hin und her. Der Kommissar klopfte mit seinem Feuerzeug auf dem Tisch. Es klang wie der Rhythmus eines langsamen Marsches.
»Wenn ihr euch getroffen habt, worüber habt ihr geredet?«, fragte er schließlich.
»Was meinen Sie damit?«, fragte ich zurück, ein wenig zu schrill. Und dann ging alles ganz schnell. Der Kommissar stand auf, zog meinen linken Unterarm auf den Tisch und prügelte die Kante des Feuerzeugs in meinen Handrücken, kurz und hart, als hacke er Buchenholz. Ungläubig starrte ich auf Haut und Blut und noch mal Blut, immer wieder stampfte das silberne Hakenkreuz auf meine Knochen, und dann kam der Schmerz. Ich schrie und schrie und verlor die Fassung. Egal wie dick die Wände waren, ganz sicher war mein Gebrüll bis auf die Straße zu hören. Verzweifelt versuchte ich, mein Handgelenk aus der Umklammerung zu lösen. Ich wand mich und riss und hatte keine Chance. Endlich ließ der Polizist von mir ab. Ich drückte meine Linke gegen die Brust und bedeckte sie mit der Rechten. Weich und heiß drängte sich das zerschlagene Fleisch gegen den Ballen. Doch es war noch nicht vorbei. Der nächste Schmerz kam vom linken Ohr. Dicke Finger packten es und zogen und drehten meine Ohrmuschel einmal herum. Es knirschte und knackte in meinem Kopf. Ich jaulte in blinder Panik und vergaß für ein paar Momente, wer ich war und wo. Die Marter war bestialisch.
»Bin ich ein Idiot?«, rief der Kommissar in das zerdrehte Ohr. »Bin ich ein Idiot?«, immer und immer wieder. Ich versuchte, ihn abzuwehren, irgendwie, aber es ging nicht. Ich war zu klein und zu schwach und fühlte mich viel zu elend. Es war eine schrecklich entwürdigende Angelegenheit.
»Bin ich ein Idiot? Bin ich ein Idiot?« Zehn, zwanzig Mal, vielleicht noch öfter. Als ich wieder zu mir kam, lag ich auf dem Boden und hustete. Der Kommissar saß auf seinem Platz. Aus einer dämmrigen Ecke seines Schreibtischs hatte er ein Telefon gezogen und sprach leise in den Hörer. Meine linke Hand bot einen erschreckenden Anblick. Mit der rechten tastete ich zu meinem Ohr. Einen irren Moment lang dachte ich, es wäre nicht mehr da. Dann blieb ich liegen. Beim Aufstehen wollte ich aus dem bösen Traum erwacht sein.
Der Wärter, der mich gebracht hatte, betrat den Raum, ohne zu klopfen. Erst sah ich im Türrahmen sein Gesicht, dann nur noch seine Schuhe. Eine schwarze Sohle wackelte vor meiner Nase.
»Komm, hoch. Ich zeig dir dein Nest.« Ich richtete mich auf. Das ging erstaunlich einfach, doch als ich in der Senkrechten war, blinkten Sterne wie bei einem kaputten Signalgeber. Die Wände wurden schräg. Um nicht zusammenzusinken, hielt ich mich am Nächstbesten fest, was ich greifen konnte. Das war der Kragen des Wachmanns.
»Na, na«, sagte er und stützte mich ein wenig. »Schon gut. Hier geht’s raus.« Ich hatte keine Orientierung und keine Reserven. Ein Schäfchen hätte sich nicht leichter führen lassen. Wenn ich die schmale Hoffnung gehegt hatte, mit »raus« hätte der Wachmann »in die Freiheit« gemeint, wurde sie sogleich vernichtet. Ein paar Gänge, ein paar Treppen, dann stand ich in einer Zelle.
»Erzähl ihm lieber alles, was du weißt«, sagte der Wachmann, bevor er die Holztür schloss. Sie sah mehr nach Burgverlies als nach moderner Gefängnisanstalt aus. War da Mitleid in seiner Stimme? Oder war das nur ein besonders schmutziger Trick, mich zum Quatschen zu überreden?
Scharf zog der Gestank der Zelle in meine Nasenflügel. Hier komme ich nicht wieder weg, dachte ich. Nie.
1
Meine Geschichte beginnt dort, wo Leipzigs schönste Straße endet. Der Scheißdreck an Leipzigs schönster Straße war, dass sie seit drei Jahren einen neuen Namen trug. Als ich zwölf war, hatte ein Mann das Blechschild an meinem Haus entfernt, das bis dahin jedem Vorbeigehenden anzeigte, wo er sich befand. Auf der Südstraße nämlich. Er war nur ein Grashalm gewesen, der Mann, im Gesicht windschief und verknittert. Aber das Schild hat er mitgenommen. Am nächsten Tag kam er mit seinem Handwagen und seiner Leiter wieder und brachte ein neues an. Seitdem hieß die schönste Straße Leipzigs so: Adolf-Hitler-Straße.
Es passierte am ersten Tag der Sommerferien. Zu Ostern hatte ich die neunte Klasse der Oberschule mit mäßigen Zensuren abgeschlossen, in jedem Fall nicht gut genug für meine Eltern. Sie hätten es lieber gesehen, wenn ich mir ein Türmchen aus Schreibkram und Büchern gebaut und mich dahinter versteckt hätte, aber ich trieb mich lieber auf der Straße rum.
An der Kreuzung vor meinem Wohnblock lärmte der Nachmittag. Elfenbeinfarbene Straßenbahnen luden zerrupfte Trauben von Menschen aus und wieder ein. Bremsten sie ab, konnte man das Geräusch bis in die Backenzähne spüren. Das war witzig und widerwärtig zugleich. Ungefähr eine Million Mofas unterschiedlichster Ausführung knatterten pro Minute über beide Seiten der Straßen. Die Dinger waren der letzte Schrei, auch wenn sie einen Lärm veranstalteten, der in keinem Verhältnis zu ihren geringen PS stand. Sie klangen wie ein Hummelstaat, der durch ein Megafon gejagt wurde. Komplettiert wurde das Konzert von Dutzenden Stimmen, die aus den weit geöffneten Türen und Fenstern der Wirtschaften drangen. Es war zwar noch nicht Abend, aber die Sonne machte durstig. An der Ecke zu einer Seitenstraße spielten ein paar Mädchen mit blauen Haarbändern Himmelhuppe.
Dort also, wo Leipzigs schönste Straße endet, an der großen Kreuzung, die Connewitzer Kreuz genannt wurde, flatterte an diesem Tag die Fahne der Hitlerjugend heran, ein schwarz-weiß-rotes Biest an einer langen Stange aus Holz. Unten an der Stange war ein Junge, ungefähr in meinem Alter, festgewachsen. Er schaute so ernst, als ob seine Miene selbst aus Holz wäre, unbeirrt und unbewegt.
Hinter ihm, aufgereiht wie auf einer Perlenkette, marschierten noch mehr Hitlerjungs. Ich sah nicht so genau hin, denn ich suchte keinen Ärger. Die Hände in den Hosentaschen trat ich zur Seite und tat, als wäre ich überall, nur nicht an dieser Stelle zwischen Straße und grauem Mauerwerk. Doch ich war nicht so durchsichtig, wie ich es mir wünschte.
»He, du da!«, brannte es in meinem Nacken. Ich gab vor, nichts gehört zu haben, obwohl ich schon ahnte, was jetzt kommen würde. Wäre ich gerannt, hätte der Tag einen anderen Ausgang genommen. Doch ich rannte nicht, ob aus Leichtsinn oder aus Angst oder aus Tapferkeit, das wusste nur die Sonne.
Noch ein Pfiff. Noch ein Rufen. Und dann waren sie plötzlich so nahe, dass man keine besonders geschärften Sinne brauchte, um zu spüren, dass jemand hinter einem ging.
»Bist du taub?«, sprach es direkt in mein Ohr. Ich drehte mich um. Die Fassaden der Häuser reflektierten das Licht, sodass ich blinzeln musste. Ein Halbkreis von Gesichtern rückte näher. Alles Mögliche war in ihnen zu lesen: Verachtung, Hochnäsigkeit, ernste Empörung, in jedem Augenwinkel die Erleichterung, nicht in meiner Haut zu stecken. Wie von selbst hob mein Körper abwehrend die Hände.
»Langsam«, sagte ich. »Was ist los? Was hab ich gemacht?« Der Halbkreis blieb stehen. Eins der Gesichter löste sich und kam ganz nah an meins heran.
»Du hast etwas nicht gemacht«, sagte das Gesicht. Die Worte kamen direkt durch die Zähne, in den Lippen war keinerlei Bewegung. Die Schultern unter dem Gesicht waren so dick, dass sie den Halbkreis der anderen verschluckten. Der Riemen über dem braunen Hemd spannte.
»Du hast die Fahne nicht gegrüßt.«
»Hab sie nicht bemerkt, nur nicht bemerkt«, sagte ich. »War keine Missachtung!«
»Kleiner, die Fahne, die ist mehr als der Tod! Verstehst du das?« Nein, das verstand ich nicht. Ich nickte.
»Ein jeder hat die Fahne zu grüßen! Ganz gleich, wo er steht!«
Die Doppeldeutigkeit seiner Worte war dem Hitlerjungen offensichtlich nicht bewusst.
»Wer es nicht tut, wird bestraft!« Ich wich ein Stück zurück, als könnte das die unvermeidlichen Schmerzen verhindern. Die Mauer, an die meine Hacke stieß, besiegelte die Situation.
»Kommt, bitte, lasst«, stammelte ich beschwichtigend, ohne mir etwas davon zu versprechen. Wie ein umgekehrtes Echo spürte ich schon die Backpfeifen. Doch sie kamen nicht.
»Macht die Fliege!«, rief eine sehr laute Stimme. Dann hörte ich, wie mehrere Personen in die Hände klatschten, als wollten sie eine Rotte Wildschweine vertreiben. Die dicken Schultern drehten sich zur Seite, dahinter sah ich bunten Tumult, Dutzende Arme schoben und rissen aneinander. Empörte Schreie flogen durch die Luft.
»Schluss! Genug!«, rief der Dickschultrige. Es klang wie zwei Schüsse. Das Gewimmel löste sich. Jetzt konnte ich die veränderte Lage erfassen. In die Gruppe der Hitlerjungs hatten sich mehrere Keile anderer Kerle geschoben. Ihre Kleidung wich deutlich ab von dem, was man so kannte. Es waren weniger, aber sie sahen verwegen aus.
»Is’ uns recht! Mach’ mer uns nich’ dreckig, weißte?«, sagte einer von ihnen, ein großer Bursche mit viel zu langen strohblonden Haaren. Seine Augen sprühten Funken. Er erinnerte mich an jemanden.
Für ein paar Sekunden hätte man die Luft in Stücke schneiden können. Wenn auch nur eine Person der beiden Fraktionen eine falsche Bewegung machte, würde das Jüngste Gericht losbrechen. Mühsam würgte der Dickschultrige seine Wut herunter. Wenn es nach ihm gegangen wäre, hätte er hier wohl nicht klein beigegeben, doch dem Rest seiner Truppe war sichtlich die Lust vergangen. Die meisten blickten zu Boden.
»Und kehrt! Aus der Bahn!«, sagte er schließlich, irgendwohin. Die Neuankömmlinge grinsten. Mit erhobenen Händen ließen sie die Hitlerjungs passieren. Der Wortführer lief hinten. Hätte sein Blick töten können, wären wir alle gefallen wie Kegel.
Der Tross entfernte sich. Ein paar Passanten schauten neugierig, noch mehr schauten streng, doch alle schwiegen.
»War’n los?«, fragte der Blonde. Ich atmete einmal tief aus, die Anspannung ließ nach.
»Habe die Fahne nicht gegrüßt«, sagte ich und zuckte mit den Schultern. Der Blonde grinste und klopfte in einer freundschaftlichen Geste, die so angenehm wie ein Hammerschlag war, gegen meine Brust.
»Bestens«, sagte er. »Braucht man auch nicht grüßen.« Prüfend blickte er mich an. »Wolltste nicht oder konntste nicht?« Ich verschränkte die Arme und zog die Brauen nach oben. Ein bisschen konnte ich auch spielen. Der Blonde zeigte seine Zähne.
»Bestens«, wiederholte er. Dann lief ein Grübeln über sein Gesicht. »Kenn ich dich nich’? Wohnst in der Gegend, was?« Jetzt wusste ich, an wen er mich erinnerte. In der Nachbarschaft gab es einen Jungen, der mit seinem Vater auf einem alten, kutschenartigen Ungetüm Kohlen auslieferte. Das war er. Ich hatte ihn nicht erkannt, weil er sonst ganz anders aussah, in seiner schwarzen Arbeitskleidung und mit dem Ruß auf den Wangen. Ich nickte.
»Kenn dich auch«, sagte ich. »Umrath, richtig? Kohlen?« Der Blonde spitzte die Lippen, als wolle er pfeifen.
»Da vorn. Stimmt’s?«, fragte er und zeigte auf das Eckhaus, in dem ich wohnte. Es war nicht weit. Ich nickte wieder. Mein Gegenüber zwinkerte mir zu.
»Alsdenn. War uns ein Vergnügen.« Noch einmal spürte ich seinen prüfenden Blick, den er kurz von mir löste, in die Runde schweifen ließ und wieder auf mich heftete.
»Komm doch mal vorbei«, sagte er dann. Noch einmal verschränkte ich die Arme und zog die Brauen gen Himmel. Ein Daumen von der Größe eines jungen Baumstumpfs deutete die leicht abschüssige Pegauer Straße hinunter.
»Kinos. Oder Kirche«, sagte der Blonde. »Mal so, mal so. Gegen Abend. Alle zwei, drei Tage. Schau einfach.« Er strich seinen Scheitel nach, die Haare fielen ihm bis in die Augen. Eine kolossale Hand schob sich vor meine Nase. Ich schüttelte sie.
»Heinrich.«
»Harro.«
2
Erker schmückten die Fassade meines Hauses, neben dem hohen Eingang befanden sich links und rechts zwei Geschäfte. Oben an der Ecke schaute eine kleine, etwas verirrt wirkende Kuppel hervor. Darüber schloss der Bau mit einem offenen Türmchen ab. Widersetzte man sich den Verboten, auf dem Dachboden zu spielen, konnte man sogar in das Türmchen hineinklettern, sich bei Wind die Haare zerzausen lassen und eine herrliche Aussicht über die Stadt genießen.
Gegenüber vom Haus lag ein kleiner Park, der das örtliche Brausebad einfasste: die öffentliche Einrichtung für all jene, die keinen Boiler oder Wannenofen besaßen. Ich, als Sohn einer Lehrerfamilie mit beiden ihren Beruf auch tatsächlich ausübenden Elternteilen, gehörte nicht dazu.
In ein Buch vergraben – es war nicht von der Schule, sondern von Karl May – lag ich auf meinem Bett. Das geschlossene Fenster schützte mich vor der Schwüle. Die Geschichte war spannend, doch immer wieder flossen meine Gedanken weg zu dem Erlebnis vor ein paar Tagen, wie die Farben bei einem viel zu nassen Aquarell.
Wer waren diese Jungs? Mit etwas Abstand fiel mir auf, dass ich dem einen oder anderen schon einmal begegnet war. Dieser Stil, die Art sich zu kleiden, war einfach zu ungewöhnlich, um ihn zu übersehen.
Es muss irgendwann im Frühjahr gewesen sein, vor dem Central-Theater am Anfang der Bornaischen Straße. Da standen zwei dieser Kerle in kurzen Lederhosen und blauen Jacken, unter dem Saum winkten frech bunte Karos. Danach sah ich diese oder eine ähnliche Kluft immer wieder. Sie war wie eine rote Murmel in einem Riesensack voll grauer Kugeln. Sie fiel auf, aber auch wieder nicht, denn es gab so viele andere.
Und nun war ich eingeladen, bei den roten Murmeln vorbeizuschauen. Hatte ich darauf Lust? Natürlich hatte ich das.
Ich steckte ein Lesezeichen in mein Buch, legte es zur Seite und stand auf. In Bügelfalten und weißem Hemd wollte ich nicht vorstellig werden. Ich brauchte eine weniger blamable Montur, unbedingt.
Unser Dielenschrank war drei Meter hoch wie breit, oder zumindest kam es mir so vor. Wie immer protestierten die Scharniere der rechten Tür. Ziellos wühlte ich in Stoffhäufchen herum. Leinenjacken, Hosenträger, Sakkoanzüge, nichts erschien mir passend. Eine Knickerbocker sprang mir ins Auge, die hatte ich seit Jahren nicht getragen, aber sie war besser als nichts.
Oberhalb der Hüfte war die Sache noch schwieriger. Es gab einfach überhaupt nichts, was nicht nach bravem Jüngelchen aussah. Irgendwann resignierte ich, krempelte die Ärmel meines Hemdes hoch, schob die Unterlippe vor und drehte mich zum Spiegel. Wie gewollt und nicht gekonnt feixte mich mein Ebenbild an. Sei’s drum, dachte ich mir. Die Sache war ja mir angeboten worden und nicht umgekehrt.
Langsam kroch die Schwüle nun doch durch die Ritzen der Fenster. Es war einer jener Abende, an denen man jede Minute darauf wartet, dass die Hölle vom Himmel fällt – oder, ohne ein einziges Tröpflein, hochnäsig vorbeischwebt.
Ich trat auf die Straße. In der Mitte der großen Kreuzung streckte sich eine Steinsäule mit Stadtwappen und Kreuzbild in die Luft. Irgendetwas Historisches, genau wusste ich es nicht, in jedem Fall war sie Namensgeber für das Connewitzer Kreuz. Als ich an ihr vorbeilief, klapste ich einmal auf den rostroten Porphyr. Das sollte Glück bringen.
Ich musste nicht überlegen, welches der beiden Kinos ich zuerst ansteuern sollte. Heinrichs Schopf, hell wie ein Büschel Gerstenähren, leuchtete vom Fußweg vor dem Union-Theater auf der Pegauer Straße herüber. Mein langsames Näherkommen erlaubte mir, ihn genauer zu betrachten. Wieder staunte ich, wie anders er ohne Kohlenschwärze wirkte. Weiße Kniestrümpfe in kastanienbraunen Bundschuhen, kurze Lederhose, rot-schwarz kariertes Hemd – die Metamorphose war beeindruckend. Seine Ärmel hatte er ebenfalls hochgekrempelt, das fand ich beruhigend. Er lächelte mir zu, breit wie ein Fenster.
»Da biste! Prächtig! Geht’s gut? Hast Ferien, was?« Ich hob die Schultern, gleichzeitig nickte ich. Eine Handvoll anderer Jungs musterte mich und ich sah ihnen an, dass ich der Einzige mit Sommerferien war. Schnell wechselte ich das Thema.
»Harro«, sagte ich und hielt dem Erstbesten im Kreis die Hand hin, einem kantigen, sonnenverbrannten Kerl, der vor ein paar Tagen dabei gewesen war. Sein Händedruck ließ mich innerlich aufschreien, aber ich wahrte die Haltung.
»Willi«, sagte er und musterte mich weiter, nicht unfreundlich.
»Einer unserer Kanuten«, sagte Heinrich. »Das hier ist der andere.« Er setzte seine Pratze wie eine riesige Spinne auf die Schulter von Willis Nebenmann. Der grinste.
»Richard«, sagte er. Wir schüttelten die Hände. Es ging schon besser, ich war vorbereitet.
Die Vorstellungsrunde brach ab, als Heinrich anfing zu lachen. Er lachte und lachte und schlug sich die rechte Faust in den linken Handballen, sie knallte wie ein Bauchklatscher im Schwimmbad.
»Gibt’s nicht! Frauen in kurzen Hosen! Was’n das Nächste? ’ne Reichskanzlerin?« Ich folgte seinem Blick. Ein Mädchen mit brünettem Bob, dessen Haarspitzen sich um ihre Augen kräuselten, kam die Straße hoch. Sie hatte einen Ausdruck im Gesicht, der ihr Platz verschaffte, auch wenn sie höchstens so alt war wie ich. Sie sah aus, als wüsste sie genau, was sie wollte – und auch, dass man ihr genau das ansah.
Doch eigentlich war es nicht ihre Mimik, die mich fesselte. Mich fesselte ein Kleidungsstück. Es war eine Hose. Eine kurze Hose. Eine kurze Lederhose. Genauso eine, wie Heinrich sie trug, und der sah damit schon wild aus. Das Mädchen kam näher, ging direkt auf ihn zu. Ich dachte schon, sie wolle Heinrich schlagen, doch dann blieb sie einen halben Meter vor ihm stehen und umarmte ihn. Ich staunte.
»Bestens! Steht dir bestens, meine alte Hose!«, sagte Heinrich, während er das Mädchen noch an den Schultern hielt und betrachtete.
»Darf ich vorstellen? Hilma!«, sagte er schließlich und wandte sich zu mir. Ich streckte meine Hand aus. Die Vorgestellte hob das Kinn, höher als ihre Augen.
»Harro«, wiederholte sie, ein bisschen so, als zweifelte sie, dass ich wirklich so hieß. Ich nickte und zeigte auf Heinrich.
»Wir sind Nachbarn«, sagte ich. Ich wusste nicht genau, was das erklären sollte, aber etwas anderes fiel mir nicht ein.
»Nachbarn«, wiederholte sie und legte den Kopf schräg. »Na gut. Na dann. Willkommen!« Verspätet schüttelten wir die Hände. Dann zupfte sie Heinrich am Ärmel.
»Komm, wir gehen mal ein Stück. Muss dir was erzählen.« Mit einem Mal stand ich allein in der Runde. Ein schmaler Junge mit weißem Seemannskragen nahm sich meiner an, kurz bevor es peinlich geworden wäre.
»Ich bin Edgar«, sagte er schlicht. »Was führt dich her, Harro? Dass du der Nachbar bist? Oder gibt’s da noch mehr?« Ich kratzte mit dem Fuß über den Asphalt, schob die Unterlippe vor und schaute Edgar in die Augen. Je nach Lichteinfall wirkten sie traurig oder freundlich.
»Bin sowieso immer auf der Straße«, sagte ich. »Und neue Freunde kann man immer gebrauchen, nicht?« Edgars Nicken war nur ein Windhauch.
»Und du?« Edgar lächelte, vielleicht, weil ich ablenkte.
»Hab auf Arbeit nichts zu melden. Vater war in der KPD. Mein Meister macht sich ’nen Spaß draus. Deutscher Gruß, jedes Mal, wenn er die Werkstatt betritt oder verlässt. Mach ich’s zu spät, gibt’s Überstunden. Solche Sachen.« Er drehte das Koppelschloss an seinem Gürtel. Es war glatt und schimmerte in der Sonne. »Natürlich nur für mich. Nicht für die anderen. Das ist einer der Gründe.«
»Wie läuft das, mit den Lehrstellen«, fragte ich. »Kann man die wechseln?«
»Manchmal«, sagte Edgar. »Ich nicht. Volksschule, ranzige Zensuren, keine Kontakte. Eltern Kommunisten.« Er schnippte gegen die schimmernde Metallplatte. »Wie heißt es so schön? Sei froh, dass du überhaupt was hast. Und du, gehst noch zur Schule, ja?« Ich nickte und vergrub die Hände in den Hosentaschen.
»Ist doch klasse«, sagte Edgar. »Ist doch toll. Sei froh. Oder nicht?«
»Die Schule ist scheiße«, sagte ich nach einer kurzen Pause. Edgar hob die Augenbrauen. Er war wirklich sehr schmal.
»Lehrstelle schmeißen, geht das?«, lenkte ich wieder ab. Edgar lachte, aber nicht so, dass ich mir dumm vorkam.
»Ganz schlecht«, sagte er. »Vater kriegt nur Stütze. Meine Mutter arbeitet bei der HASAG, der Lohn ist erbärmlich. Und wer weiß, wie lange sie die Stelle noch hat. Außerdem gibt es da noch meine kleine Schwester. Nein, nein, wir brauchen mein Lehrgeld.« Ich weiß nicht, ob mir mein verständnisvolles Gesicht gelang. Über die roten Ziegeldächer an den Häusern gegenüber rannte ein fernes Blitzen. Das Gewitter hatte sich noch immer nicht entschieden.
3
In dieselbe Zeit, in der ich die Clique kennenlernte, fiel ein Gespräch mit meinen Eltern, das so angenehm war wie ein Loch im hintersten Backenzahn. Ich mochte sie ohnehin schon nicht, diese Gespräche, denn ich fühlte mich dabei stets wie ein kleiner Junge. Dieses eine war besonders schwer verdaulich.
Mein Vater, bis dreiunddreißig Mitglied in Reichsbanner und SPD, saß im Wohnzimmer auf einem Sessel, groß, schwer und unbewegt wie eine altägyptische Statue. Ihm gegenüber saß meine Mutter, ihr Körper ein C, zwischen Büchern, Notizblättern und abgegriffenen Aktenordnern.
Unser Wohnzimmer war nicht gemütlich. Es war der Ort, an dem meine Eltern ihren Unterricht vor- und nachbereiteten. Und an diesem Tag war es der Ort, an dem das Eltern-Sohn-Gespräch schon aus den Bücherregalen grinste, bevor irgendjemand überhaupt etwas gesagt hatte.
»Komm rein bitte und setz dich«, eröffnete mein Vater und ich hätte lieber das Gegenteil getan. Ich nahm Platz. Meine Mutter wurde zum L, ein L mit geschwungener Rolle in den Locken an der linken Stirn. Sie war nicht eitel, was jedoch nicht hieß, dass ihr Mode gleichgültig war. Ihre Fingerspitzen blieben auf einem Heft liegen, wie bei einer Pianistin kurz vor ihrem Einsatz. Sie schaute mich über den Rand ihrer Brille an. Mein Vater räusperte sich.
»Lange waren deine Mutter und ich nicht einverstanden damit, dass du in die Staatsjugend eintrittst«, sagte er und betonte jedes einzelne Wort. Ein kleiner, übler Schauer huschte mir über den Rücken. Meine Eltern waren nicht in der Partei, allerdings schützten sie sich vor unbequemen Fragen mit der Mitgliedschaft im Nationalsozialistischen Lehrerbund. Besonders bei meinem Vater hatte ich das Gefühl, dass es nicht dabei bleiben würde.
»Wir haben uns beraten. Und wir haben uns entschieden. Wir genehmigen den Beitritt.« Mein Vater sah, dass ich den Mund öffnete, und schnitt mir das Wort ab. Er sprach laut.
»Wir müssen uns darüber Gedanken machen, wie es mal weitergeht. Müssen uns arrangieren. Mit der Zeit gehen. Das hast du sicher schon mal gehört. Studienplätze sind rar. Erst recht ohne Ausweis. Das wollen wir dir nicht zumuten!« Mit jedem Satz war mein Vater ein Stück näher an mich herangerückt. Jetzt rutschte er wieder zurück in die Lehne. Irgendein Harro hinter mir warf ihm ins Gesicht, dass er sich doch nur nicht selbst zumuten wolle, ein Kind ohne Studienplatz zu haben. Der echte Harro hatte Mühe, überhaupt etwas zu erwidern.
»Aber ihr wisst doch, dass ich da gar nicht mehr eintreten will!«, sagte ich. »Früher vielleicht, ja. Weil alle eingetreten sind. Aber nicht mehr, seit … seit Paul!« Der Name hallte von den Wänden, als wäre das Zimmer eine Krypta. Der Mund meines Vaters war ein dünner Strich.
»Harro«, legte sich die Stimme meiner Mutter auf meine Schulter. »Paul ist nicht mehr da. Du darfst darüber nicht deine Zukunft vergessen.«
»Möglich«, sagte ich. »Ist schon möglich. Weiß ich nicht. So oder so. Kein Interesse.«
»Dummes Zeug!«, rief mein Vater und warf die Hände in die Luft. »Davon will ich nichts hören!« Er hatte keine Geduld, vor allem nicht mit mir.
»Deine Eintrittserklärung ist bereits ausgefüllt«, schob er hinterher und beendete die Unterhaltung, indem er seine Zeitung aufschlug.
Damit war die Sache erledigt. Weitere Diskussionen hatten an dieser Stelle keinen Zweck. Ich würde mich um mich selbst kümmern müssen. So, wie ich es ohnehin schon seit Langem tat.
Am Sonntag darauf hatte ich das Gespräch längst weggeschoben, eingepackt in ein kleines Kistchen in meinem Kopf, auf das ein anderes, größeres seinen Schatten warf: das Kistchen mit meiner neuen Clique.
Sonntag, der gesegnete Tag, tauchte das Connewitzer Kreuz in ruhiges Licht. Festtagskleider und feine Zweireiher säumten die Straßen. Vor dem Union-Theater stand nur eine knappe Handvoll Personen. Ich erkannte kein Gesicht. Ich grüßte.
»Heinrich oder Edgar, waren die heute schon da?« Ein düsterer Kerl blies den Rauch seiner Zigarette himmelwärts.
»Wer will das wissen?«, rieb seine Stimme wie zwei Blätter Schleifpapier aufeinander. Der Blick des Kerls drückte mich aus wie eine alte Kartoffel.
»Harro«, sagte ich. »Harro Jäger. Ich bin … ich war … ich war schon ein paar Mal da. Ich bin Heinrichs Nachbar.« Neuer Rauch dampfte gen Himmel, die Mundwinkel folgten. Meinem Gegenüber fehlten die oberen Eckzähne. Er sah aus wie ein amputierter Vampir.
»Kirche«, sagte er. Es klang ungefähr so freundlich wie: »Schwirr ab.«
Die Stadtteilkirche war nicht weit, genauer gesagt, einmal um die Ecke. Ihr Name, Paul-Gerhardt-Kirche, war noch recht frisch. Große, weiß verputzte Außenflächen wurden von hellrotem Porphyr gerahmt, dem Vulkangestein, das in der Gegend öfter Verwendung fand. Der Eingangsbereich war mit Mosaiken geschmückt. Ein mächtiger Turm stach die Wolken auf. Rund um die Kirche befand sich ein kleiner Park.
Auf der hinteren Seitentreppe, versetzt wie Noten auf einer Tonleiter, grinsten mich die Gesuchten an. Hilma und Edgar nickten mir zu. Neben Heinrich saß noch ein Mädchen, das ich nicht kannte. Auf dem blauen Stoff, der ihre Haut bedeckte, flogen gelbe und orangene Blätter. Ihre Locken waren fein und hellblond, der Lippenstift karminrot, der Puder auf ihren Wangen zartrosa. Sie sah aus, als wäre sie direkt aus einem Gemälde gestiegen. Ich hatte noch nie jemanden wie sie gesehen.
Der Blick des Mädchens war unbestimmt. Ich spürte in ihm nichts, was auf Zu- oder Abneigung hinwies. Die feinen Regungen, wie sie üblich sind, wenn zwei Menschen das erste Mal aufeinandertreffen – ein kleines Lächeln vielleicht oder ein winziges Runzeln der Stirn –, fehlten. Wenn überhaupt, war ihr Blick der eines Prüfers auf seinen Kandidaten. Trotzdem ließ er das Gras unter meinen Füßen noch weicher werden.
»Ist wohl der Sonntagsplatz?«, fragte ich und suchte mir einen Platz im Notensystem.
»Josephines Platz«, sagte Heinrich und wackelte seinen Kopf in Richtung des geheimnisvollen bunten Mädchens. »Wenn de so willst, ja. Der Sonntagsplatz.«
»Josephine«, wiederholte ich. »Ich bin Harro.« Jetzt glaubte ich, eine kleine Regung in ihrem Gesicht zu erkennen. Sie nickte.
»Arbeite sonst«, sagte sie. »Bin nur sonntags da. Keine Lust auf die Kinos da vorn.«
»Muss sich verstecken«, sprang Hilma ein. »Eltern. Stammkunden. Zu viel Publikum.«
»Stammkunden?«, fragte ich. Josephine holte Zigaretten aus ihrer Tasche, Eckstein stand auf der Packung. Ich machte noch größere Augen als vorhin. Ein Mädchen hatte ich noch nie rauchen sehen. Schon gar nicht in der Öffentlichkeit.
»Stammkunden«, wiederholte sie. Der Zigarettenrauch wanderte an den Ärmeln ihres Kleids entlang. »Reinhardt und Handelskompanie, schon mal gehört?«
»Die Kolonialwaren, auf der Bornaischen? Klar. Kenn ich. Kennt doch jeder.« Josephine nickte wieder.
»Gehört meinem Vater.«
»Feiner Laden. Beste Schokoladen in Connewitz!«
Josephine lächelte, etwas zu dünn für das Kompliment.
»Weiß schon«, sagte sie. »Mein Vater. Großer Kaufmann.« Sie drückte die Zigarette auf der Treppe aus, viel zu früh. Ich schaute fragend, aber eigentlich war schon klar, dass ihr Verhältnis zu ihrem Vater schlecht war. Musste es ja, sonst würde sie sich nicht hier verstecken.
»Wird sie dir schon noch erklären«, sagte Hilma, die meinen Blick bemerkte. Sie grinste. »Zumindest wenn du dich für unsere komische Truppe entscheidest.«
Ich wollte nichts lieber als das.
Der Rest des Tages zog vorbei wie ein Lidschlag. Ein schwarzer Kasten, das Decca-Grammofon von Hilmas großem Bruder, spielte uns auf den Steinstufen Musik bis in die Nacht. Dutzende Male hörten wir auf ihm abwechselnd »Goody Goody« und »Sometimes I’m Happy« von Benny Goodman. Dazu rauchten wir. Ich rauchte auch. Die Ecksteins schmeckten ekelhaft, aber großartig. Ich war glücklich.
4
Jeden Tag kam ich später nach Hause. Dass ich mich rumtrieb, waren meine Eltern gewöhnt, vielleicht fiel ihnen die Veränderung deswegen nicht auf. Möglicherweise dachten sie, es wäre ein vorübergehendes Phänomen; Sturm und Übermut des Sommers und der Ferien. Vielleicht gaben sie sich aber auch nur Mühe, den Wandel nicht zu sehen. Jedenfalls waren die Fragen meiner Mutter zur Gestaltung meiner Tage spärlich und ich wich immer aus. Von meinem Vater kamen gar keine.
Die Lebenswirklichkeit meiner neuen Freunde unterschied sich von meiner eigenen erheblich, doch für die meisten war das überhaupt kein Problem. Das Problem schien eher bei mir zu liegen, denn ich hatte das Gefühl, nie den richtigen Ton zu treffen, wenn mir beispielsweise Hilma erzählte, dass das Geld ihrer Gelegenheitsarbeiten nicht reichte. Sie selbst, und insbesondere Heinrich, lachten in diesen Momenten jedoch nur über mich. Sie wollten keine Almosen von mir. Nicht, dass ich über besonders viel Geld verfügte, aber die eine oder andere Münze wurde mir schon zugesteckt.
»Wenn du Pinke hast, lass uns was Vernünftiges damit machen«, sagte Hilma eines Tages und spitzte die Lippen zu einem lautlosen Pfiff.
»Du und was Vernünftiges«, neckte ich und bekam zur Belohnung einen Schlag auf den Oberarm.
»Genau. Was Vernünftiges. Wir kaufen dir ’ne neue Garderobe. Damit du nicht mehr rumrennst wie … wie das Bübchen vom Internat.« Sie tänzelte um mich herum und grinste, aber ich ging nicht auf die Provokation ein.
»Warum nicht«, sagte ich. »Wo denn?« Hilma stoppte und stemmte die Fäuste in ihre Hüften.
»Im Haus der Jugend natürlich. Nürnberger Straße. Sag bloß, das kennste nicht.« Ich zuckte mit den Schultern.
»Mal gehört.«

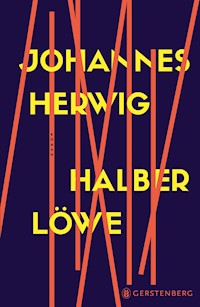












![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)














