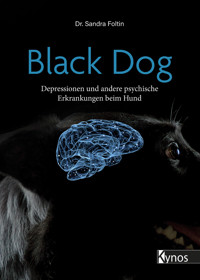
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kynos Verlag
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
"Ich hatte einen schwarzen Hund, sein Name war Depression", so beschrieb Winston Churchill seine immer wiederkehrenden "dunklen Perioden", in denen er sich wie gelähmt fühlte. Aber können auch Hunde Depressionen haben? Tatsächlich nicht nur das- sie teilen mit uns auch posttraumatische Belastungsstörungen, Zwangsstörungen, Süchte, generalisierte Angststörungen, ADHS, Burn-out und vieles mehr. Die Forschung dazu steht noch am Anfang, wozu dieses Buch erstmals einen Überblick liefert. Die Biologin, Psychologin und Hundeexpertin Dr. Sandra Foltin zeigt eindrucksvoll, wie die WHO-Definitionen für mentale Erkrankungen auch auf Hunde zutreffen und wie diese ihre Gesundheit und ihr emotionales Wohlbefinden beeinflussen. Auch für die Halter betroffener Hunde besteht oft erheblicher Leidensdruck, sodass ein besseres Verständnis dieser Erkrankungen sowohl dem Hund als auch dem Menschen zugutekommt. Hier finden Halter betroffener Hunde, aber auch Tierärzte und Verhaltenstherapeuten Ideen für Diagnosefindung und Lösungsansätze, die wirklich weiterhelfen. Enthält Videolinks zur Expertendiskussion konkreter Fallbeispiele im Gespräch mit Tierärztin, Verhaltenstherapeutin und Trainerin Maria Hense.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 243
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dr. Sandra Foltin
Black Dog
Depressionen und andere psychischeErkrankungen beim Hund
© 2023 KYNOS VERLAG Dr. Dieter Fleig GmbH
Konrad-Zuse-Straße 3, D-54552 Nerdlen / Daun
Telefon: 06592 957389-0
www.kynos-verlag.de
eBook (epub) Ausgabe der Printversion 2023
ISBN der gedruckten Ausgabe: 978-3-95464-311-0
eBook (epub)-ISBN: 978-3-95464-319-6
Grafik & Layout: Kynos Verlag
Bildnachweis:
Alle Grafiken: Kynos Verlag, außer:
Titelfoto: Tsvetkova-adobe.stock.com
S. 19: Antje-adobe.stock.com
S. 123: Kynos Verlag unter Verwendung des Fotos von Tatiana Shepeleva-adobe.stock.com
Mit dem Kauf dieses Buches unterstützen Sie die
Kynos Stiftung Hunde helfen Menschen
www.kynos-stiftung.de
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne schriftliche Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Haftungsausschluss: Die Benutzung dieses Buches und die Umsetzung der darin enthaltenen Informationen erfolgt ausdrücklich auf eigenes Risiko. Der Verlag und auch der Autor können für etwaige Unfälle und Schäden jeder Art, die sich bei der Umsetzung von im Buch beschriebenen Vorgehensweisen ergeben, aus keinem Rechtsgrund eine Haftung übernehmen. Rechts- und Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen. Das Werk inklusive aller Inhalte wurde unter größter Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können Druckfehler und Falschinformationen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Der Verlag und auch der Autor übernehmen keine Haftung für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte des Buches, ebenso nicht für Druckfehler. Es kann keine juristische Verantwortung sowie Haftung in irgendeiner Form für fehlerhafte Angaben und daraus entstandenen Folgen vom Verlag bzw. Autor übernommen werden. Für die Inhalte von den in diesem Buch abgedruckten Internetseiten sind ausschließlich die Betreiber der jeweiligen Internetseiten verantwortlich.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Einführung
1.Psychische Erkrankungen beim Hund?
Tiermodelle
Und wie sollen wir das nun herausfinden?
Diagnostischer Ansatz
2.Domestikation und unsere gemeinsame Geschichte
Soziale Anforderungen an Haushunde und damit verbundene Verhaltensprobleme
Andere menschliche Einflüsse
Emotionale Ansteckung
Synchronisation
3.Welche psychischen Krankheiten sind bisher beim Hund beschrieben worden?
Essstörungen
Fettleibigkeit – Adipositas
Das Pica-Syndrom
Auswirkungen auf die Gesundheit und die Mensch-Hund-Beziehung
Angststörungen
Natürliche im Gegensatz zu krankmachender Angst
Angststörungen und deren Auslöser
Ursachen von Angststörungen
Eine Beispielstudie: Hundetrainer und Trennungsangst
Pharmakologie
Generalisierte Angststörung (GAD)
Furcht und Angst – die Unterschiede
Angst und Leistung
Integrative Modelle
Medizinische Tests
Mögliche Behandlungsmethoden
Zwangsstörungen (Obsessive compulsive disorder (OCD) oder canide Zwangsstörung (canine compulsive disorder – CCD)
Imaginäre Fliegen jagen
Schattenjagen
Schwanzjagen
Flankensaugen
Trance-ähnliches Syndrom (Trance-like Syndrome TLS)
Kanide Zwangsstörungen (Canine compulsive disorder – CCD) – eine Studie
ADHS Aufmerksamkeitsdefizit- / Hyperaktivitätsstörung
Das Belohnungssystem
Beispiel einer Diagnose
Genetik
Soziale und physische Faktoren
Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS)
Asperger
Autismus
4.Depressionen
Entstehung
Pränatale Einflüsse
Postnatale Einflüsse
Bindung
Das Panik-Trauer-System
Symptome
Burn-out
Bore-out
Lösungsansätze bei Depressionen
5.Trauer
Trauer ist nicht Depression
Trauerphasen
6.Lösungsansätze
Resilienz fördern!
Neurobiologie der Resilienz
Persönlichkeit
Mütterliche Fürsorge
Stressoren im frühen Leben, andere Widrigkeiten und das Umfeld des Heranwachsenden
Bindung und soziale Beziehungen
Körperliche Aktivitäten
Genetik
Epigenetik
Medikamente
Neurotransmitter
7.Fazit
Danksagung
Über die Autorin
Vorwort
„Psychische Gesundheit ist ein Zustand des Wohlbefindens, in dem eine Person ihre Fähigkeiten ausschöpfen, die normalen Lebensbelastungen bewältigen, produktiv arbeiten und einen Beitrag zu ihrer Gemeinschaft beitragen kann. Psychische Störungen stellen Störungen der psychischen Gesundheit dar, die oft durch eine Kombination von belastenden Gedanken, Emotionen, Verhaltensweisen und Beziehungen zu anderen gekennzeichnet sind. Beispiele für psychische Störungen sind Depressionen, Angststörungen, Verhaltensstörungen, bipolare Störungen und Psychosen. Psychische Gesundheit und Wohlbefinden werden nicht nur durch individuelle Merkmale beeinflusst, sondern auch durch die sozialen Umstände, in denen sich Individuen befinden und die Umgebung, in der sie leben.“ (WHO12019)
Psychische Gesundheit ist eine wesentliche Voraussetzung für Lebensqualität, Leistungsfähigkeit, Resilienz, Wohlergehen und soziale Teilhabe. Beeinträchtigungen der psychischen Gesundheit sind beim Menschen weit verbreitet und reichen von leichten Einschränkungen des seelischen Wohlbefindens bis zu schweren psychischen Störungen und gehen mit erheblichen individuellen und gesellschaftlichen Folgen einher2. Aufgrund ihrer weiten Verbreitung haben insbesondere Depressionen, Angststörungen, Suchterkrankungen und Demenzerkrankungen große Public-Health-Relevanz. Und wie ist das beim Hund? Psychische Beeinträchtigungen beeinflussen auch bei unseren Vierbeinern deren körperliche Gesundheit und vor allen Dingen ihr emotionales Wohlbefinden und die WHO-Definition findet auch auf sie Anwendung. Da psychopathologisches Verhalten auch die Beziehung zwischen Hund und Halter negativ beeinflussen kann, wird ein besseres Verständnis der Umwelt-, Lebensstil- sowie molekularen und genetischen krankheitsbeeinflussenden Faktoren sowohl dem Hund als auch seinem Menschen zugutekommen.
Wir haben eine eigene Videoseite zum Buch im Netz erstellt, auf der Sie unter anderem einige Fallbeispiele von der Autorin mit der Tierärztin und Verhaltensspezialistin Maria Hense analysiert sehen. Auf die Videobeispiele wird auf den entsprechenden Buchseiten verwiesen.
Hier geht’s zu den Filmbeiträgen:https://www.hundebuchshop.com/nextshopcms/Videolinks-Black-Dog.htm
ICH HATTE EINEN SCHWARZEN HUND, SEIN NAME WAR DEPRESSION3
Die WHO erzählt gemeinsam mit dem Schriftsteller und Zeichner Matthew Johnstone die Geschichte „I had a black dog, his name was depression“.4
Winston Churchill5 litt unter Depressionen und nannte diese seinen „schwarzen Hund“.
Churchill war durch seine Erkrankung häufig so gelähmt, dass er viel Zeit im Bett verbrachte, wenig Energie hatte, sich für wenig interessierte, seinen Appetit verlor und sich nicht konzentrieren konnte. Er war kaum noch funktionsfähig. Diese „dunklen Perioden“ dauerten einige Wochen bis hin zu einigen Monaten. In einem Brief an seine Frau Clementine schrieb er 1911, nachdem er erfahren hatte, dass die Frau eines Freundes von einem deutschen Arzt Hilfe gegen Depressionen erhalten hatte:
„Ich glaube, dieser Mann könnte mir nützlich sein – wenn mein schwarzer Hund zurückkehrt. Er scheint jetzt ganz weit weg von mir zu sein – es ist eine solche Erleichterung. Alle Farben kommen zurück ins Leben“.
1World Health Organsisation, Weltgesundheitsorganisation
2https://www.rki.de/DE/Content/GesundAZ/P/Psychische_Gesundheit/Psychische_Gesundheit_node.html
3https://www.youtube.com/watch?v=XiCrniLQGYc
4https://www.youtube.com/watch?v=XiCrniLQGYcÜbersetzung: Ich hatte einen schwarzen Hund und sein Name war Depression.
5Sir Winston Leonard Spencer-Churchill (* 30. November 1874 in Blenheim Palace, Oxfordshire; † 24. Januar 1965 in London) gilt als bedeutendster britischer Staatsmann des 20. Jahrhunderts. Er war zweimal Premierminister – von 1940 bis 1945 sowie von 1951 bis 1955 – und führte Großbritannien durch den Zweiten Weltkrieg. Zuvor hatte er bereits mehrere Regierungsämter bekleidet, unter anderem das des Innenministers, des Ersten Lords der Admiralität und des Schatzkanzlers. Darüber hinaus trat er als Autor politischer und historischer Werke hervor und erhielt 1953 den Nobelpreis für Literatur.
Einführung
Wenn sich Hunde im Laufe der Domestikation mit uns entwickelt haben, ist es dann möglich, dass sie auch an vergleichbaren psychischen Störungen leiden wie wir? Immer mehr Studien deuten darauf hin, dass die Antwort ja lautet. So wird zunehmend anerkannt, dass unsere Haushunde eine Reihe von psychischen Krankheitsbildern zeigen können: Vom posttraumatischen Stresssyndrom über Angstzustände bis hin zu Zwangsstörungen, Süchten und Depressionen – Hunde sind von psychischen Beeinträchtigungen offenbar nicht ausgenommen.
Die pharmakologische Forschung zu Medikamenten zum Beispiel gegen Depressionen beim Menschen findet an Tieren statt. Das wäre wenig sinnvoll, wenn Tiere keine entsprechenden Symptome zeigen würden. Die an Depressionen beteiligten Hirnstrukturen gibt es bei Menschen wie bei Hunden. Auch beteiligte Neurotransmitter wie Serotonin und Dopamin gibt es bei beiden und sie haben vergleichbare Funktionen.
Reaktionen von Trauer und Apathie zeigen zwar nicht alle, aber viele Tiere. Sicher ist: Tiere können wie wir Menschen psychisch auffällig werden. Zu den Ursachen psychischer Erkrankungen bei Hunden zählen Umwelteinflüsse, körperliche Grunderkrankungen, aber auch Fehler im Umgang und in der Haltung. Aversive Trainingsmethoden können sowohl die körperliche als auch die psychische Gesundheit von Hunden mittel- und langfristig gefährden.
Die Erforschung psychischer Beeinträchtigungen bei Tieren steht noch am Anfang. Die Ursache für psychische Erkrankungen zum Menschen gleichzustellen, weil das Verhalten dem von Menschen ähnlich ist, muss deswegen genau diskutiert werden.
Erkenntnisse über Depressionen im Tierreich sind spärlich, allein schon, weil ein depressives Tier in freier Wildbahn nicht überlebensfähig wäre, da es sich keine passiven Phasen der Zurückgezogenheit oder Apathie leisten kann.
Anders unsere Haushunde. Sie werden auch dann versorgt, wenn es ihnen nicht gut geht. Eine genetische Veranlagung zur Entwicklung einer Depression ist kein Zuchtausschluss, beteiligte Gene werden demzufolge weitergegeben. Hunde werden seit Jahrtausenden vom Menschen gezüchtet und durch die Formalisierung der modernen Rassen wie sie vor ca. 300 Jahren stattfand, verringerte sich der genetische Pool maßgeblich6. Folglich zeichnen sich die meisten modernen Rassen durch eine sehr begrenzte genetische Vielfalt aus.
Im letzten Jahrhundert hat sich das typische Leben vieler Hunde dramatisch verändert: Sie leben nun im Haus und sind zu unseren Begleitern und häufig Familienmitgliedern geworden. In vielerlei Hinsicht scheint dieser Wandel zu einer Verbesserung des Wohlergehens von Hunden geführt zu haben. Allerdings haben sich die Bewegungs-, Kontakt- und Sozialisierungsmöglichkeiten der Hunde dadurch massiv reduziert und viele Hunde, die in der Vergangenheit frei waren, leben heute auf engem Raum und isoliert. Darüber hinaus hat die selektive Zucht von Hunden, die weitgehend von menschlichen ästhetischen Idealen und Vorstellungen einer Rasse bestimmt wird, die Hundepopulationen im gleichen Zeitraum dramatisch verändert.
Wir wissen nicht genau, inwieweit Beeinträchtigungen der psychischen Gesundheit bei unseren Hunden verbreitet sind. Veterinäre gehen davon aus, dass jeder fünfte Hund an einer psychischen Erkrankung leidet7! Beeinträchtigungen gehen mit erheblichen individuellen Folgen einher und beeinflussen die körperliche und emotionale Gesundheit. Insbesondere Depressionen, Angststörungen, Suchterkrankungen und Demenzerkrankungen sind vermehrt bei den (in westlichen bzw. industrialisierten Gesellschaften lebenden) Hunden von Relevanz. Studien erheben im Rahmen des Gesundheitsmonitorings bei Hunden keine regelmäßigen Daten zur psychischen Gesundheit, psychischen Auffälligkeiten, psychischen Störungen oder Risiko- und Schutzfaktoren8.
Psychische Probleme bei Hunden sind häufig eine Reaktion auf eine Veränderung in ihrem Leben. Manche Hunde sind sehr sensibel und können schon bei scheinbar kleinen Dingen Depressionen oder Ängste entwickeln. Zu den bedeutenderen Ereignissen, die sich auf die psychische Gesundheit unseres Hundes auswirken können, gehören ein Neuzugang im Haushalt, z. B. ein neues Baby, ein Mitbewohner oder ein Haustier oder Veränderungen in der Routine, wenn die Kinder wieder zur Schule gehen, der Arbeitsplatz gewechselt oder nach Corona nicht mehr im Homeoffice gearbeitet wird. Auch der Verlust wie der Tod eines Familienmitglieds oder eines anderen Haustiers verursachen häufig psychische Veränderungen.
Zudem können Hunde Anzeichen für psychische Probleme zeigen, wenn sie Traumatisches erleben, zum Beispiel, wenn sie von einem anderen Hund gebissen werden oder eine Katastrophe wie aktuell einen Krieg oder einen Vulkanausbruch erleben, aber auch, wenn sie einem traumatischen Erlebnis beiwohnen.
Es ist wichtig, daran zu denken, dass Symptome von Depressionen und Angstzuständen Anzeichen von Krankheiten sein können, die diagnostiziert und behandelt werden müssen.
Hauptauslöser aller psychischen Erkrankungen beim Hund ist jedoch der Mensch: Durch schlechte Zuchthygiene, gewaltbasierte Trainingsmethoden, Welpenvermehrer und den Einsatz diverser Zwangsmittel. Zudem können wir auch die eigenen Befindlichkeiten auf unseren Hund durch Synchronizität oder emotionale Ansteckung übertragen.
Zu einer verantwortungsvollen Hundehaltung gehört demnach, dass wir uns um die eigene und die psychische Gesundheit unserer Hunde sorgen.
6Parker, H.G. et al. 2004 Genetic structure of the purebred domestic dog. Science 304, 1160 – 1164.
7https://www.petprofessional.com.au/info-centre/mental-health-for-dogs/
8Meyer-Holzapfel, M. Erforschung des Tierverhaltens – Weg zum Menschen? In: V. Faust (Hrsg.): Psychiatrie – ein Lehrbuch für Klinik, Praxis und Beratung. Gustav Fischer-Verlag, Stuttgart-Jena-New York 1996.
1.
Psychische Erkrankungen beim Hund?
Psychische Störungen werden nach der psychoanalytischen und tiefenpsychologischen Schule als „kreative Lösungen des Unterbewusstseins“ angesehen, vereinfacht: „Jedes Symptom hat eine Funktion“9. So kann ein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom als abgewehrte Depression verstanden werden oder eine Panikstörung als Ausdruck eines inneren, ansonsten unaushaltbaren Konfliktes. Dieser Erklärungsansatz versteht sich nicht als Gegenentwurf zu den in den letzten Jahren zunehmenden neurobiologischen Erklärungsmodellen, sondern als ein zusätzlicher Ansatz und Aspekt. Niemand würde denken, dass ein an einer Depression erkrankter Hund ausschließlich aufgrund der neurobiologischen Transmitterveränderung im Gehirn eine Depression entwickelt, sondern diese vielmehr eine multifaktorielle Entstehungsgeschichte hat. Der Hund ist im Kern ein „biopsychosoziales“ Lebewesen, daher sind für die überwiegende Anzahl der psychiatrischen Erkrankungen verschiedene Faktoren wie Genetik, gesundheitliche Risikofaktoren während der Trächtigkeit der Hündin, Geburt und Welpenalter, aber auch frühe Beziehungserfahren und einschneidende Lebensereignisse, Bindungsparameter, aktuelle Lebensumstände und Coping Mechanismen ausschlaggebend10.
In den letzten Jahren hat der translationale11 Ansatz, der darauf abzielt, die Kluft zwischen der Grundlagenforschung an Tieren und der medizinischen Praxis zu überbrücken, stark an Popularität gewonnen. Das gilt auch für den Bereich der Psychiatrie und insbesondere für affektive Störungen, einen Zweig, der Depressionen und Angststörungen umfasst. Im Rahmen dieser translationalen Medizin soll ein solider Ansatz sowohl die Forschung vom Labor zum Krankenbett (vom Tier zum Menschen bzw. von der Grundlagenforschung zur klinischen Forschung) als auch die „Rückübersetzungsforschung“ (vom Menschen zum Tier) umfassen12. Die meisten Anstrengungen gelten der erstgenannten Richtung und konzentrieren sich auf die Entwicklung von Tiermodellen. Leider gibt es nur wenige Forschungsarbeiten, die den umgekehrten Weg beschreiten.
Für den Forschungsbereich der psychischen Erkrankungen beim Hund brauchen wir mehr Theorien über das Wesen des z. B. depressiven Zustands; die entscheidende Bedeutung einiger dysfunktionaler Prozesse (zum Beispiel, dass Hilflosigkeit oder Anhedonie zentrale Symptome der Depression sind); die Dynamik einer Störung (z. B. den biphasischen Verlauf einer Depression). Aber eben auch die häufigsten Auslöser (Stress; Trennung); die Bedeutung einiger spezifischer Merkmale dieser Ereignisse (Unkontrollierbarkeit oder Unvorhersehbarkeit der Stressoren als zentrale Mechanismen) und die Beteiligung zugrunde liegender biologischer Prozesse (z. B. die Beteiligung einer Störung des Belohnungssystems im Gehirn).
Es gibt also noch viel zu tun!
Tiermodelle
Um Anwendbarkeit zu finden, brauchen wir eine Übereinstimmung zwischen den Organismen, was die Entstehung, den Verlauf und die Symptome betrifft.
Ein Rahmen für Tiermodelle. Tiermodelle sollen nicht nur einer menschlichen Funktionsstörung ähneln, auch die Prozesse, durch die Tier und Mensch in diesen Zustand geraten, müssen ähnlich sein, um wissenschaftliche Verwendung zu finden. Hier ist eine vereinfachte Darstellung, wie dies geschieht13.
Hier sehen wir, wie ein Individuum durch frühe Umweltfaktoren beeinflusst wird: positiv, so dass es eine hohe Resilienz entwickeln kann oder negativ, sodass eine erste „Schwachstelle“ entsteht, die den Organismus bereits schwächt und anfälliger für Krankheitsprozesse macht. Ist der Organismus erst einmal anfällig, reicht häufig ein Auslöser aus, um ein Krankheitsbild entstehen zu lassen. Ein Auslöser kann entweder ein sehr belastendes Einzelereignis sein (Trauma) oder eine Reihe von Traumata über einen längeren Zeitraum. Das Individuum zeigt nun Symptome und anhand der Biomarker wie Kortisol können wir bestimmte Pathologien verorten und vergleichen, um diese dann zu bestimmen.
Und wie sollen wir das nun herausfinden?
Da Hunde nicht sprechen können, können sie uns auch nicht sagen, ob sie traurig oder niedergeschlagen sind. Auch wenn sich dies durch Neuroimaging14 bald bis zu einem bestimmten Grad ändern könnte, müssen wir uns derzeit auf das Verhalten unserer Hunde verlassen, um auf ihre Gefühle zu schließen. Wenn Hunde beispielsweise verängstigt sind, zeigen sie charakteristische Verhaltensweisen wie Zittern, Verstecken, Speicheln oder Kratzen an der Tür, um zu entkommen, Auf- und Ablaufen, Bellen, Winseln oder Urinieren. Das bedeutet, dass wir als Mensch unseren Hund lesen können müssen. Hier beginnt meist bereits die Problematik, da ein Großteil aller Hundehalter weder Stress- noch Beschwichtigungssignale erkennen. Auch, weil es in den klassischen Hundeschulen nicht gelehrt wird.
Diagnostischer Ansatz
Verhaltensprobleme bei Hunden verbessern sich häufig, wenn ein sachkundiger Tierarzt, individuell für das jeweilige Tier angepasst, Humanpräparate gegen Depressionen und Angstzustände verschreibt. Serotonin- und Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer gehören zu den am häufigsten verschriebenen Medikamenten in der Verhaltensmedizin für Tiere. Andere sind Benzodiazepine, trizyklische Antidepressiva, Betablocker und sogar Lithium. In der Tat ist das Psychopharmakopotenzial bei Hunden fast dasselbe wie bei Menschen. Die Tatsache, dass diese Medikamente bei Hunden wirken, spricht für gemeinsame biologische Mechanismen der Stimmungsregulierung. Und im Gegensatz zum Menschen sind Hunde nicht anfällig für Placebo-Effekte (auch wenn ihre Besitzer das vielleicht sind, weil sie eine Verbesserung des Hunde Verhaltens erwarten).
Keinesfalls sollten Medikamente von einem Laien – ob Hundetrainer oder Halter – dem eigenen Tier verabreicht werden!
Das ist ein Grund mehr, sich genauer anzusehen, was in den Köpfen der Hunde vor sich geht. Menschliche Krankheiten werden hauptsächlich anhand von Symptomen diagnostiziert. Laut dem Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) der American Psychiatric Association (APA) sind Depressionen zum Beispiel durch gedrückte Stimmung, verminderte Freude, verlangsamtes Denken, Müdigkeit oder Motivationslosigkeit gekennzeichnet. Ein messbares Symptom ist eine Gewichtsveränderung. Ähnlich verhält es sich mit der generalisierten Angststörung, die mit übermäßigen Ängsten und Sorgen, Unruhe, Müdigkeit, Konzentrationsschwäche, Muskelschmerzen und Schlafproblemen einhergeht. Um nun die psychischen Krankheitsbilder wissenschaftlich zu beschreiben und einzuordnen müssen wir Kriterien schaffen, die nachprüfbar und generalisiert anwendbar sind. Und zwar in Bezug auf die Hunde! Nur nachprüfbare, objektive Merkmale und Hinweise haben Gültigkeit, um tatsächlich eine psychische Erkrankung beim Hund zu diagnostizieren.
Viele von uns kennen wahrscheinlich die Befindlichkeiten des eigenen Hundes – so auch, wenn dieser „trauert“ oder „deprimiert“ ist. Um allerdings wissenschaftlich basiert zu arbeiten und zu behandeln, brauchen wir feste Eckdaten, die überprüfbar sein müssen!
Dieses Schaubild zeigt die wichtigsten Eckpunkte, die erfüllt sein müssen, damit eine fundierte Basis für die Beschreibung und Diagnose psychischer Krankheitsbilder beim Hund geschaffen werden kann:
Kriterien der psychiatrischen Erkrankungen, wie sie in ICD-10 und DSM aufgeführt sind:
Das bedeutet, um wirklich von einem Krankheitsbild sprechen zu dürfen, wie wir es in der Humanmedizin tun, brauchen wir: Die Ätiologie, das bedeutet die Ursache der Krankheitsentstehung. Es gibt drei grundlegende Methoden der Ätiologie: Die Causa (lat. für „Ursache“) – wir suchen nach „kausalen“ Gründen einer Krankheit. Die Contributio (lat. für „Förderung, Beitrag“), also der Zusammenhang im Sinne einer Ursache-Folge-Beziehung und die Korrelation (Correlatio, lat. für „Korrelation, Zusammenhang“) schaut, ob es Verbindungen gibt bei Krankheiten, die keine klaren bzw. erforschten Ursache-Folge-Beziehungen haben. Die Entstehung eines Krankheitsbildes sollte demnach auch beim Hund eine nachvollziehbare Ursache haben.
Des Weiteren muss der Hund eine vergleichbare Symptomatik für das beschriebene Krankheitsbild aufweisen. Dazu gehört eine entsprechende Biochemie – beispielsweise in Zusammenhang mit den Neurotransmittern und den Ansatzorten der Medikation.
Zudem sollten die gleichen Reaktionen auf gleichartige Behandlung zutreffen – also, wie oben erwähnt, objektive Nachweise das Antidepressiva auch beim Hund sein Verhalten, seine Blutwerte etc. pp. verändern.
Und um zu definieren, ob es sich um eine Krankheit handelt, und wenn ja um welche, brauchen wir ein immer gleich anwendbares Protokoll bzw. eine fest definierte Vorgabe. Und dazu wird im Bereich der psychischen Erkrankungen der ICD oder der DSM benutzt.
Die ICD (International Classification of Diseases) ist derzeit bei der 11. Version der internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme. Er wurde erstellt von der Weltgesundheitsorganisation. Der ICD enthält Codes für Krankheiten, Anzeichen und Symptome, auffällige Befunde, Beschwerden, soziale Umstände und äußere Ursachen von Verletzungen oder Krankheiten.
DSM ist die Abkürzung für Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, auf Deutsch: „Diagnostischer und statistischer Leitfaden psychischer Störungen“. Das DSM ist das dominierende psychiatrische Klassifikationssystem und wird von der Amerikanischen Psychiatrischen Gesellschaft (APA) herausgegeben. Das DSM wird in diesem Buch mit den aktuellen Definitionen benutzt.
9„Psychische Krankheit stellt die Manifestation eines Prozesses dar, der in allen Bereichen der menschlichen Persönlichkeit verankert ist, diese von frühester Kindheit an mitprägt und häufig die Eigenart der Persönlichkeit bestimmt. Daher ist dieser Prozess mit allen Reifungs- und Entwicklungsphasen des Lebens eng verbunden.“ Argelander H. Das Erstinterview in der Psychotherapie. 10. Auflage 2014. WBG-Verlag.
10McKinney, W.T., Bunney, W.E. Animal models of depression. Arch. Gen. Psychiat. 1969, 127: 240 – 248.
11von englisch: translation = übersetzen. Aktivitäten und Maßnahmen, die sich mit der Umsetzung von Forschungsergebnissen aus der Medizin in der Gesundheitsversorgung beschäftigen. Translationale Medizin oder Forschung verbindet die Grundlagenforschung mit der praktischen Anwendung von Forschungsergebnissen in der Praxis. Zugleich lassen sich auf diese Weise Fragestellungen aus der Praxis zurück an die Wissenschaftler tragen.
12Belzung, C., Lemoine, M. Criteria of validity for animal models of psychiatric disorders: focus on anxiety disorders and depression. Biol. Mood Anxiety Disord 1, 9 (2011). https://doi.org/10.1186/2045-5380-1-9
13Belzung, C., Lemoine, M. Criteria of validity for animal models of psychiatric disorders: focus on anxiety disorders and depression. Biol. Mood Anxiety Disord 1, 9 (2011). https://doi.org/10.1186/2045-5380-1-9
14Neuroimaging (englisch Bildgebung des zentralen Nervensystems) bezeichnet die medizinische Abbildung des Nervensystems und ist ein bildgebendes Verfahren. Sowohl Anatomie, dynamische Vorgänge wie Durchblutung oder Liquorfluss sowie Funktion können bildhaft dargestellt werden. Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Neuroimaging.
2.
Domestikation und unsere gemeinsame Geschichte
Meyer et al. (2022)15 verglichen in ihrer Studie das Wohlergehen von Haushunden mit dem von modernen Dorfhunden, da Hunde, geschichtlich gesehen, die meiste Zeit als Dorfhunde gelebt haben. Dorfhunde sind Hunde, die menschennah und an Menschen angeschlossen leben, allerdings die Freiheit besitzen, sich selbstentscheidend zu bewegen. Sie halten sich um menschliche Siedlungen oder Dörfer auf, ernähren sich meist von Abfall oder Erbetteltem und leben auf der Straße. Wir finden sie heute immer noch – wenn auch nicht mehr in Deutschland – in den meisten Ländern der Welt: Ob in Ost- oder Südeuropa, Asien oder Afrika. Daher kann dieser Vergleich als gute Grundlage für die Bewertung der Auswirkungen der „petification“ von Hunden dienen. Der typische Vorstadt- oder Stadthund hat im Vergleich zum typischen Dorfhund in vielerlei Hinsicht ein gutes Leben. Dies gilt insbesondere für die Sicherheit, die Befriedigung der Ernährungsbedürfnisse (obwohl Haushunde Probleme mit einer hohen Prävalenz von Fettleibigkeit haben) und eine angemessene tierärztliche Versorgung. In anderer Hinsicht leidet der moderne Hund jedoch häufig unter einer Reihe von durch den Menschen verursachten Problemen, die zu einem schlechten Wohlergehen führen. Untersucht wurden zwei zentrale Herausforderungen für Haushunde: 1) unrealistische soziale Anforderungen, die zu Ängsten, Depressionen und Aggressionen führen können, und 2) schlechte Zuchthygiene, die bei vielen Haushunden zu zuchtbedingten – auch psychischen – Krankheiten führt.
Während Hunde historisch verschiedene Rollen als Wächter, Hirten, Jagdhelfer und Gefährten erfüllten16, führten Industrialisierung und Urbanisierung zu Veränderungen im menschlichen Lebensstil, die auch die Beziehung zwischen Mensch und Hund beeinträchtigte, wobei Hunde hauptsächlich zu Begleittieren und Mitbewohnern wurden17. Hunde, die von einer einzigen modernen Rasse abstammen (reinrassige Hunde), überwiegen in genetischen Studien, die sich ihre ungewöhnliche Populationsgeschichte und begrenzte genetische Vielfalt zunutze machen, stellen aber nur eine Minderheit aller Hunde dar18. Mehr als 80 % der fast 1 Milliarde Hunde auf der Erde leben frei und stehen nicht unter menschlicher Kontrolle (z. B. Dorfhunde).
Unsere Haushunde sind inzwischen Teil und Auslöser einer Multi-Millionen Euro- Industrie, die Spezialfutter, tierärztliche Versorgung, Spielzeug, Zubehör, Dienstleistungen und Waren anbietet19. Ihr Lebensstil unterscheidet sich stark von dem Leben, das Hunde in der Vergangenheit als Freigänger geführt haben. Viele Hunde gehen heute nur in Begleitung ihres Besitzers und an der Leine nach draußen und haben sehr begrenzte Möglichkeiten, außerhalb ihres Leinenradius zu erkunden, zu spielen und Kontakte zu knüpfen20. Aufgrund unseres westlichen Lebensstils sind unsere Hunde häufig täglich viele Stunden allein zu Hause, was ihre Möglichkeiten des sozialen Austauschs weiter einschränkt. Darüber hinaus hat die selektive Zucht, die weitgehend von menschlichen Schönheitsidealen und Vorstellungen von Rassenreinheit bestimmt wird, die Hundepopulationen in einem relativ kurzen Zeitraum immens verändert.
Menschen und Hunde leben seit Tausenden von Jahren in enger Nachbarschaft21. Die meiste Zeit über konnten sich die Hunde, ähnlich wie die heutigen Dorfhunde, frei bewegen. Dorfhunde sind mittelgroß und phänotypisch weltweit sehr ähnlich, obwohl es je nach Klima einige Unterschiede gibt; z. B. sind Dorfhunde in nördlichen Regionen tendenziell größer, haben kleinere Ohren und längeres Haar22.
Der typische „Dorfhund“ ist häufig sandfarben und mittelgroß, kann allerdings phänotypisch unterschiedlich sein aufgrund der Anpassung an den jeweiligen Lebensraum. Hunde, die auf der Straße geboren wurden, handeln selbständig, kümmern sich selbst um Probleme, entscheiden frei über ihre Sozialkontakte, organisieren sich Futter und unterteilen sich den Tag frei in Ruhephasen, Sozialphasen und Phasen der Reviererkundung und Futtersuche.
Dorfhunde werden in Würfen von durchschnittlich sechs Welpen aufgezogen23. Sie sind gut mit Artgenossen sozialisiert und streifen als Erwachsene in der Regel allein oder in kleinen Gruppen von zwei bis drei Hunden umher24. Sie durchwühlen Abfälle in der Umgebung von Haushalten und konkurrieren mit anderen Hunden oder Tieren um Nahrungsressourcen25.
Zu den täglichen sozialen Interaktionen mit vertrauten und unbekannten Menschen können Mensch-Hund-Spiele, das Betteln um Futter und das Verfolgen von Menschen bei der täglichen Arbeit und bei Aktivitäten gehören26. Es gibt Hinweise darauf, dass die Sozialisierung von Dorfhunden von Kultur zu Kultur variiert27. Weniger sozialisierte Dorfhunde in Äthiopien fliehen, wenn sich ihnen ein Fremder nähert (Ortolani et al., 2009). Aber selbst gut sozialisierte Dorfhunde in Mexiko kommen nicht heran, wenn sie von einem unbekannten Menschen gerufen werden28. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass Dorfhunde an die spezifische menschliche Kultur, zu der sie gehören, und an die einzelnen Menschen, mit denen sie interagieren, angepasst sind, während sie gleichzeitig ein Leben führen, das eben nicht vollständig vom Menschen abhängig oder bestimmt ist.
Soziale Anforderungen an Haushunde und damit verbundene Verhaltensprobleme
Wenn man das Leben von Haushunden mit dem von freilebenden Dorfhunden vergleicht, ist ein offensichtlicher Unterschied das Ausmaß, in dem die Halter das Leben der Hunde kontrollieren. Dies gilt insbesondere für ihr Sozialleben, da der Halter entscheidet, wie viel soziale Interaktion der Hund haben soll oder darf und wie und mit wem er sich austauschen kann.
Dorfhunde sind zwar bei ihrer Nahrungsbeschaffung auf den Menschen angewiesen und mögen unter Umständen auch die Gesellschaft des Menschen suchen und genießen, aber sie brauchen Menschen nicht, um ihre sozialen Bedürfnisse zu erfüllen.
Mit dem Einzug der Hunde in Haus und Leben als Familienmitglied wurde mehr Wert darauf gelegt, wie sie mit uns (statt mit anderen Hunden) interagieren29. Vom „idealen Hund“ wird erwartet, dass er sozial und freundlich, sowohl ruhig als auch energiegeladen und leicht zu erziehen ist30. Der Selektionsdruck, der sich aus diesem Ideal ergibt, besteht darin, dass die Hunde zugänglicher, mehr auf die Kommunikation mit dem Menschen bedacht und weniger aggressiv gegenüber Menschen sind31.
Viele Hunde leben allerdings nun unter Bedingungen, bei denen die Menschen einen Großteil des Tages abwesend sind. Es überrascht daher nicht, dass trennungsbedingte Probleme sehr häufig auftreten32;33. Basierend auf Berichten von Haltern wird die Prävalenz von trennungsbedingten Problemen bei 5 % bis 30 % aller Hunde angegeben (Tiira et al., 2016,34,35). Diese Schätzungen sind jedoch wahrscheinlich zu niedrig. Einige Halter sind sich des Problems nicht bewusst, weil das trennungsbedingte Verhalten erst auftritt, nachdem sie gegangen sind und ihr Hund unter Umständen keine „Beweise“ (z. B. Zerstörung) hinterlässt36. Andere Halter können die subtileren Anzeichen von Angst oder Stress bei ihrem Hund nicht erkennen37. Es gibt sogar Hinweise darauf, dass manche Besitzer wissen, dass ihr Hund trennungsbedingtes Verhalten zeigt, aber die Notwendigkeit oder Möglichkeit einer Behandlung nicht sehen38.
Die am häufigsten berichteten klinischen Anzeichen für trennungsbedingte Probleme sind Lautäußerungen, Urinieren / Koten und zerstörerisches Verhalten39. Hunde können auch andere Anzeichen im Zusammenhang mit der Trennung von ihrem / ihren Besitzer(n) zeigen, wie z. B. Verhaltensindikatoren für Stress oder Angst (Hecheln, Zittern usw.), Depressionen (Lethargie, Lustlosigkeit) oder physiologische Anzeichen (Speichelfluss, Appetitlosigkeit, Erbrechen, Durchfall usw.)40. Diese Anzeichen können vom Besitzer leichter übersehen werden, sind aber dennoch Indikatoren für einen zugrunde liegenden negativen emotionalen Zustand. Obwohl einige trennungsbedingte Verhaltensweisen möglicherweise unterschiedliche emotionale / motivationale Hintergründe widerspiegeln könnten, sind Hunde, die während der Trennung Anzeichen von Stress oder Frustration zeigen, zweifellos in ihrem Wohlbefinden beeinträchtigt.
Hunde sind obligat soziale Tiere, die Gesellschaft für ihr Wohlbefinden brauchen. Es wurde festgestellt, dass Dorfhunde ein ruhigeres, weniger erregbares Gemüt haben, was sich durch den ständigen Kontakt mit Menschen, Tieren und anderen Hunden erklären lässt41. Daraus folgt, dass das stundenlange Alleinsein erlernt werden muss, und eine mangelnde Gewöhnung an das Alleinsein ein Risikofaktor für die psychische Gesundheit ist.
Allerdings ist auch ein Zuviel an Miteinander häufig ein Stressauslöser. Hunde, die täglich mit in das Büro oder die Schule müssen, keine oder unangemessene Rückzugsorte haben und so nicht zu Ruhe kommen können entwickeln häufig psychische (Burn-out) oder physische Erkrankungen (chronische Ohrenentzündung, Magen- Darm Problematiken etc.).
In den letzten Jahren wurde auch der Bindungsstil zwischen Halter und Hund in Bezug auf psychische Problematiken untersucht (z. B. 42), da angenommen wird, dass dieser eine essenzielle Rolle bei der Entwicklung von beispielsweise trennungsbedingten Problemen spielt43. Einige Autoren haben schon früher festgestellt, dass zu viel Bindung oder Hyperbindung ein Problem darstellen44. Neuere Studien heben die Art der Bindung von Halter und Hund als Vorhersagefaktor für psychopathologische Probleme hervor45.
Ein weiterer Aspekt in Bezug auf Trennungsprobleme ist das Phänomen der „Welpenpandemie“. Laut Packer und Kollegen. (2021)46 waren Menschen, die während der COVID-19-Pandemie einen Welpen erwarben, mit größerer Wahrscheinlichkeit Ersthundehalter, wählten Hunde mit weniger Sachkunde aus und hatten zusätzlich kaum Unterstützung durch Hundetrainer.
Aufgrund der pandemiebedingten Lockdowns und Einschränkungen des Soziallebens können wir davon ausgehen, dass Welpen daran gewöhnt waren, viel Zeit mit ihren Bezugspersonen zu verbringen und wahrscheinlich nicht kleinschrittig lernten, alleine zu bleiben. Selbst für erwachsene Hunde sind diese Veränderungen eine Herausforderung. Mehrere Studien berichten, dass die lange Zeit zu Hause und die Wechsel der Routine mit einer Zunahme von Verhaltensproblemen einhergehen47,48.
Bei unseren Haushunden wird die Interaktion mit Artgenossen in erster Linie durch den Menschen kontrolliert, der bestimmt, mit wem oder ob der Hund überhaupt interagieren darf. Haltern von Welpen wird häufig geraten, ihren Hund mit anderen Hunden zu sozialisieren49. Allerdings kann es zu intraspezifischer Aggression führen, wenn ein Welpe zu viel oder zu früh zur Interaktion mit anderen Hunden gedrängt wird50, da der Welpe dort häufig negative Erfahrungen macht. Im Vergleich zu Interaktionen von Dorfhunden untereinander ist die mangelnde Wahlmöglichkeit unserer Haushunde, mit Artgenossen zu interagieren oder sich zu entziehen, ein Grund der Entwicklung von intraspezifischer Aggression.
Im Vergleich zu den Möglichkeiten, die Dorfhunde haben, sich regelmäßig mit einem oder zwei anderen Hunden zu treffen, leiden Haushunde, denen diese Interaktion mit Artgenossen fehlt, unter einem geringeren Wohlbefinden.





























