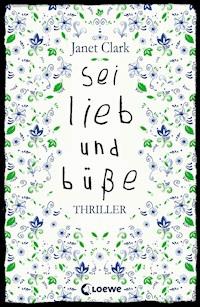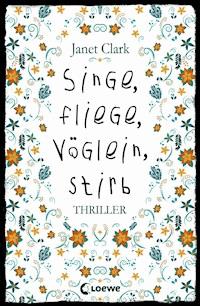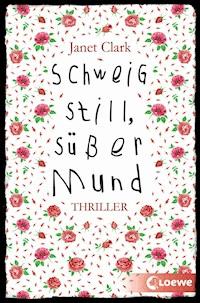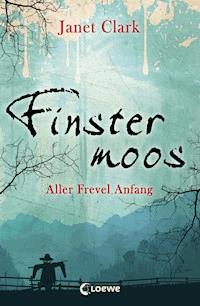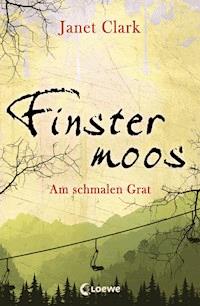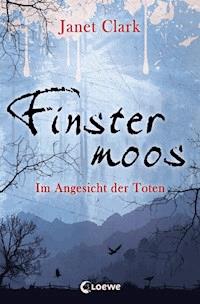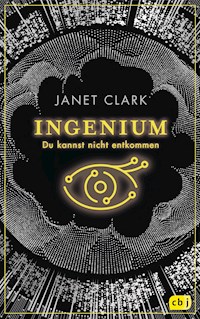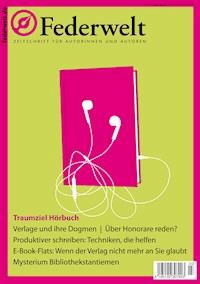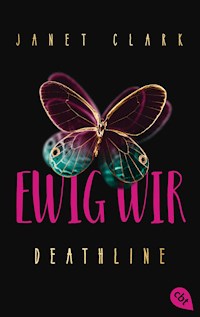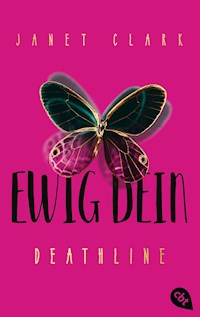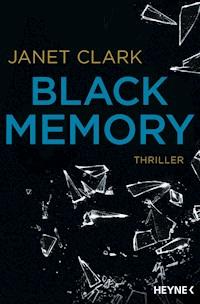
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein vermisstes Mädchen mit einer einzigartigen Inselbegabung.
Eine Ärztin, die sich an jedes Detail ihrer Ausbildung erinnern kann, aber nicht an ihren Namen und auch nicht an das Verbrechen, das sie begangen haben soll.
Als Clare orientierungslos auf einem Boot vor der indonesischen Küste erwacht, wird sie verhaftet. Sie soll ein kleines Mädchen entführt haben. Nur durch den Einsatz eines Mannes, mit dem sie angeblich verheiratet ist, kommt sie frei.
Zurück in London begreift sie, dass der Schlüssel zu dem Schicksal des vermissten Mädchens in ihrer Erinnerung vergraben ist. Doch diese ist verschüttet - von einem Trauma, so extrem, dass sich Clare mit einem völligen Blackout schützt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 438
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Das Buch
Ein vermisstes Mädchen mit einer einzigartigen Inselbegabung. Eine Ärztin, die sich an jedes Detail ihrer Ausbildung erinnern kann, aber nicht an ihren Namen und auch nicht an das Verbrechen, das sie begangen haben soll. Als Clare orientierungslos auf einem Boot vor der indonesischen Küste erwacht, wird sie verhaftet. Sie soll ein kleines Mädchen entführt haben. Nur durch den Einsatz eines Mannes, mit dem sie angeblich verheiratet ist, kommt sie frei. Zurück in London begreift sie, dass der Schlüssel zu dem Schicksal des vermissten Mädchens in ihrer Erinnerung vergraben ist. Doch diese ist verschüttet – von einem Trauma, so extrem, dass sich Clare mit einem völligen Blackout schützt.
Die Autorin
Janet Clark arbeitete nach ihrem Studium als wissenschaftliche Assistentin, Universitätsdozentin und Marketingchefin in Belgien, England und Deutschland. Nach einer erfolgreichen Karriere im Wirtschaftsbereich, startete sie 2010 noch einmal von Null: als Autorin. 2011 wurde ihr erster Roman veröffentlicht. Seitdem erschienen 4 weitere Romane und eine vierteilige Serie. Neben dem Schreiben setzt sich Janet Clark als Präsidentin der Mörderischen Schwestern e.V. für die Rechte von Autorinnen ein. Mehr über die Autorin unter www.janet-clark.de
Lieferbare Titel
Ich sehe dich
Rachekind
JANET CLARK
BLACK MEMORY
ROMAN
WILHELM HEYNE VERLAG
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2016 by Janet Clark Copyright © 2017 dieser Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München Redaktion: Eva Philippon Umschlaggestaltung: © Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/Runrun2 Satz: Uhl + Massopust, Aalen ISBN: 978-3-641-16491-1 V003 www.heyne.de
»Wenn wir uns nicht erinnern, können wir nicht verstehen.«
Meinem Vater
Vor fast 15 Jahren habe ich von Dir Abschied genommen, doch zum Glück begleitest Du mich weiterhin durch mein Leben.
Als stummer, aber sehr zuverlässiger Gesprächspartner bei all den Fragen, die nur ich selbst mir beantworten kann.
1
Plätschern.
Es ist das Erste, was ich wahrnehme. Leise wandert es durch meinen Kopf und vermischt sich mit dem sanften Schaukeln, so gleichmäßig und einschläfernd wie das Wippen einer Wiege.
Ich muss geschlafen haben. Tief und fest, bis all meine Gedanken von dem rhythmischen Plätschern des Wassers davongetragen wurden.
Meine Kehle ist trocken, der salzige Geschmack in meinem Mund unerträglich, die Lippen fühlen sich ausgedörrt und rissig an wie verbrannter Lehmboden. Instinktiv benetze ich sie mit der Zunge. Noch mehr Salz.
Du musst trinken, denke ich, deine Augen öffnen, dich aufsetzen. Doch ich bin zu müde, um meinen Anweisungen zu folgen. Einzig meine Hand tastet über die harte Fläche, auf der ich liege.
Holz.
Bootsplanken?
Suchend gleiten meine Finger über die raue Oberfläche. Etwas passt nicht zu dem Bild, das sich in meinem Kopf formt.
Waren Bootsplanken nicht glatt?
Ich öffne die Augen und kneife sie sofort wieder zusammen. Weiße Blitze tanzen vor meinen geschlossenen Lidern, dann wird es wieder angenehm dunkel. Ich weiß, ich muss mich langsam an das gleißende Licht gewöhnen. Vorsichtig blinzele ich in den Himmel.
Hellstes, klarstes Blau. Alles, was ich sehe, ist vergissmeinnichtblau.
Keine Wolke. Kein Vogel. Kein einziger Tupfen.
Keine Schattierung in dem makellosen, unendlichen Blau. Ich hebe den Kopf, stütze mich ab und blicke über die fleckig ausgebleichten Seitenplanken des Ruderboots.
Kein Baum. Kein Land.
Nur Wasser, auf dessen Oberfläche sich das grelle Glitzern der Sonne millionenfach bricht.
Wo bin ich? Es ist eine banale Frage, doch ich habe keine Antwort darauf. Stattdessen überrollt mich ein Tsunami an weiteren Fragen und schwemmt die Trägheit des ersten Aufwachens aus meinem Kopf.
Was mache ich allein in diesem Boot? Wo sind die anderen? Welche anderen? Mit wem war ich unterwegs? Und wohin?
Fragen, Fragen, Fragen … aber keine Antworten.
Angestrengt blicke ich über das Meer, halte Ausschau nach einem zweiten Boot oder wenigstens Schwimmern, die gleich zu mir zurückkommen würden. Doch da ist nichts als Glitzern.
Unruhe packt mich.
Ich richte mich auf und umklammere den Bootsrand. Sofort fährt mir ein stechender Schmerz in die Stirn. Stöhnend schließe ich die Augen und presse zwei Finger auf den Schmerzpunkt direkt hinter dem Frontallappen.
Nur ein Traum, denke ich. Gleich wache ich auf. In meinem Bett in … in … Ja, wo? Verdammt noch mal! Ich muss doch wissen, wo mein Bett steht! Verzweifelt suche ich nach einem Ort, einem Bild, einem Namen. Doch es kommt nichts. Wo Informationen zum Abruf hätten bereitstehen sollen, herrscht Leere.
Plötzlich verändert sich das Plätschern. Das sanfte Schaukeln steigert sich zu einem Beben und Schlingern, als würde das Boot jeden Moment kentern. Erschrocken reiße ich die Augen auf und fahre mit einem Schrei zurück.
Wie aus dem Nichts hockt ein Mann vor mir. Wasser perlt von seiner dunklen, sonnengegerbten Haut, tropft aus dem schwarzen Haar und hinterlässt eine Pfütze auf den rauen Planken. Er öffnet den Mund zu einem breiten, zahnlückigen Grinsen.
Kenne ich diesen Mann? Er hat etwas Asiatisches, doch seine Haut ist dunkler, als ich bei einem Asiaten vermuten würde.
Der Schmerz in meinem Kopf explodiert.
Der Mann tippt an seine Brust und sagt etwas, wiederholt es.
»E-k-o.«
Dann streckt er den Arm aus und tippt an meine Schulter. Wieder sagt er etwas. Diesmal sind es schnelle Laute. Ich glaube zu verstehen. Er will wissen, wie ich heiße.
Ich öffne meinen Mund, doch kein Name will mir über die Lippen kommen. Wieso kenne ich meinen Namen nicht? Die Frage bombardiert meinen Kopf wie ein feindlicher Luftangriff. Wer bin ich?
Unbewusst ziehe ich die Beine an meinen Körper und das ausgeleierte T-Shirt-Kleid über die Knie. Dann schüttle ich so langsam, wie es der Schmerz in meiner Stirn zulässt, den Kopf. Der Mann vor mir sieht mich erwartungsvoll an. Ich muss etwas sagen, irgendetwas. Wieder öffne ich den Mund, will ihn fragen, wer er ist, ihn fragen, ob er weiß, wer ich bin, doch meine Zunge klebt so schwer und trocken am Gaumen, dass kein Laut herauskommt.
Der Mann zeigt auf das Meer, schnelle Laute prasseln auf mich nieder und ersticken meine unausgesprochenen Fragen.
Mühsam sammele ich die letzten Reste salzigen Speichels, und es gelingt mir, meine festsitzende Zunge zu lösen. Ich starte einen weiteren Versuch: »Ich …« Es ist weniger als ein Flüstern. Ich schlucke und kämpfe mit der Trockenheit in meinem Mund. »Ich … verstehe Sie nicht.« Dann zucke ich mit den Schultern und drehe die Handflächen nach oben. »Sprechen Sie Englisch?«, frage ich ihn. Meine Stimme klingt rau und krächzend.
Ein weiterer Schwall unverständlicher Laute schallt mir entgegen. Der Mann hält mir eine geöffnete Wasserflasche hin. Ich ergreife sie gierig und presse meinen Mund auf den Flaschenhals. Er schmeckt salzig, dann, endlich, kommt das Wasser. Feucht und warm spült es das Salz aus meinem Mund und rinnt angenehm weich durch meine ausgetrocknete Kehle.
Ein zufriedenes Grinsen breitet sich auf dem Gesicht des Mannes aus. Mit einem Nicken steht er auf und geht leichtfüßig zu dem einzigen Sitzplatz. Das kleine Ruderboot schwankt wild hin und her, doch ihn scheint das nicht im Geringsten zu stören. Geschickt lässt er die Paddel ins Wasser gleiten und beginnt mit kräftigen Zügen zu rudern.
Ich sehe mich um. Wo bringt er mich hin?
Angespannt kauere ich mich gegen die Bootswand, die Wasserflasche presse ich dabei so fest an die Brust, als könnte sie mir den Halt geben, den die Leere in meinem Kopf mir geraubt hat. Ich blicke unverwandt auf den Mann. Wer ist er? Er hat mir zu trinken gegeben und mich angelächelt, und trotzdem … Mir ist nicht wohl in seiner Gegenwart. Ich fühle mich wie ein Fremdkörper. Eine Trophäe, die er aus dem Meer geangelt und sich zu eigen gemacht hat. Ich weiß, dass ich ihm ausgeliefert bin, und hoffe, dass er es gut mit mir meint.
Seine Arme bewegen sich schnell, tauchen die Paddel ins glitzernde Meer und ziehen sie durchs Wasser. Immer der gleiche Rhythmus. Der gleiche plätschernde Ton.
Zug um Zug.
Minute um Minute.
Stunde um Stunde, in denen ich an der Bootswand kauere und mich zu erinnern versuche. Der Sprache nach muss ich Engländerin sein, doch alles andere bleibt ein Rätsel: Wer ich bin. Wo ich bin. Wie ich in dieses Boot kam. Mit wem und wohin ich unterwegs gewesen sein mochte. Doch die Erinnerungen bleiben aus. Als habe man sie von meiner biomechanischen Festplatte gelöscht. Als habe mein Gehirn den Reifeprozess des episodischen Gedächtnisses nie erreicht. Ich stutze. Meine was? Biomechanische Festplatte? Episodisches Gedächtnis? Wo kommen diese Begriffe her? Verwirrt suche ich nach ihrem Ursprung und stolpere über weitere Ausdrücke, abstrakt und losgelöst schwimmen sie als Lichtpunkte in dem tiefen Schwarz meiner Orientierungslosigkeit.
Ich lege den Kopf in den Nacken und sehe zum Himmel hinauf. Vergissmeinnichtblau. Als wolle der Himmel sich über mich lustig machen.
2
Trampelgeräusche schrecken mich aus einem unruhigen Halbschlaf. Ich spüre, wie mich Hände an den Armen packen, noch bevor ich richtig wach bin. Jemand zerrt mich über die Planken, und alles, was ich denken kann, ist: Was will er von mir?
Es ist zu dunkel, um zu sehen, wer an mir zerrt, aber die Hände sind die eines Mannes. Hektische Stimmen rufen sich etwas zu, und das Schlingern und Wackeln verrät, dass wir noch auf dem Boot sind. Grob schleift der Mann mich mit sich. Da greift eine weitere Hand nach mir.
Ich werde verschleppt, schießt es mir panisch durch den Kopf. In dem Moment geht ein Ruck durch meine Arme, dann spüre ich festen Boden unter den Füßen.
»Wer sind Sie?«, frage ich ängstlich und versuche, mehr Kraft in meine zittrige Stimme zu legen. »Wo bin ich? Wo bringen Sie mich hin?«
Einer der Männer sagt etwas. Wieder die schnellen Laute, die ich nicht verstehe. Ich stolpere einen unbeleuchteten Steg entlang, geführt von einer kräftigen Männerhand. Als wir an dessen Ende angekommen sind, blitzen Scheinwerfer auf. Die Männer steuern direkt darauf zu. Schritt um Schritt, und je näher wir dem Auto kommen, desto fester wird der Griff um meinen Arm. Instinktiv stemme ich mich dagegen. Reiß dich los!, schreit es in mir. Lauf weg!
Doch schon werde ich in das Auto gestoßen, und die Tür fällt zu. Es riecht nach Schweiß und einem Gewürz. Nach Curry, glaube ich. Meine Finger tasten über die zerschlissene Rückbank. Der Wagen rollt an, fährt einen Weg entlang, dann hinaus auf eine schmale Straße.
Wieder drängen sich Fragen in meinem Kopf: Wer sind diese Männer? Wo bringen sie mich hin? Unauffällig rücke ich näher an die Tür, weg von dem Mann mit den kurzen schwarzen Haaren. Ich taste nach dem Griff, ziehe daran, doch nichts rührt sich. Fieberhaft checke ich die Fluchtmöglichkeiten, aber ich begreife schnell: Es gibt keine.
Mit einem Mal werde ich ruhiger, meine Gedanken präzisieren sich, als hätte mein Gehirn von Panik- auf Überlebensmodus geschaltet. Beobachten, analysieren – dann handeln. Der Befehl kommt von irgendwo in meinem Kopf, und er überzeugt mich sofort. Also beobachte ich.
Der Mann sieht asiatisch aus, und wir sind in einer Küstenregion. Ich tippe auf Südostasien. Philippinen, Malaysien oder Indonesien. Eine Urlaubsgegend. Denn ich muss hier im Urlaub sein – würde ich hier wohnen, müsste ich wenigstens ansatzweise die Sprache verstehen.
Im Licht der Scheinwerfer erhasche ich Blicke auf dürftig zusammengeschusterte Häuser, manche nicht mehr als Bretterverschläge, umgeben von Schrott und Müll. Mit jedem Kilometer werden die Häuser größer und die Müllberge kleiner. Wir überqueren unübersichtliche Kreuzungen, die Straßen füllen sich mit klapprigen Autos, unzähligen knatternden Mopeds und Fußgängern, die wie wandelnde Hindernisse die Straße bevölkern. Immer öfter fahren wir an Straßenhändlern vorbei, die ihre Ware auf Tischen oder am Boden darbieten, notdürftig beleuchtet von Kerosinfackeln oder weiß schimmernden Solarlampen.
Ich sehe mich erneut im Wageninneren um und bemerke auf einmal die einheitliche Kleidung der Männer: helle Hosen und Hemden, am Ärmel ein Emblem. Uniformen.
Erleichtert atme ich auf. Alles wird gut. Der Mann aus dem Boot hat mich der Polizei übergeben. Bald wird man herausfinden, wer ich bin.
»Wie heißen Sie?«
Unruhig rutsche ich auf dem harten Holzstuhl hin und her. Wie oft will der Polizeichef mir diese Frage noch stellen? Ich habe ihm erklärt, dass ich mich nicht erinnern kann. An nichts. Denkt er, ich habe auf wunderbare Weise mein Gedächtnis zurückerhalten, weil seine Leute mich wie eine Verbrecherin fotografiert und mir Fingerabdrücke abgenommen haben?
»Ich weiß es nicht.«
Sein Lächeln ist freundlich. Doch das Lauern in seinen Augen verrät, dass er mir nicht glaubt. Das ist schlecht. Sehr schlecht. Panik steigt in mir auf wie Luftblasen in Sodawasser und bringt meinen Magen zum Kribbeln. Es muss einen Grund geben, dass er mich wie eine Tatverdächtige behandelt.
»Wo kommen Sie her?«
»Ich weiß es nicht.«
Immerhin weiß ich inzwischen, wo ich bin – auf der indonesischen Insel Sumba. Und ich weiß nun, dass der Mann in dem Ruderboot mich etwa zwölf Kilometer vor der Küste aus dem Meer gefischt hat. Ich blicke zu dem surrenden Ventilator über meinem Kopf – ein Relikt, genauso vorsintflutlich wie der intarsienverzierte Schreibtisch und das überlebensgroße Porträt eines Mannes in Uniform an der Wand hinter dem Polizeichef. Aber ich darf mich von der fehlenden Fortschrittlichkeit nicht täuschen lassen. Der Polizeichef ist schlau. Mein Blick fällt auf die ordentlich aufgereihte Büchersammlung: T. S. Elliot, Dylan Thomas, James Joyce, Samuel Beckett. Er ist gebildet. Sein Englisch ist fehlerfrei, auch wenn sein Akzent so stark ist, dass ich mich auf jedes Wort konzentrieren muss.
»Wer ist Ihr Auftraggeber? Was haben Sie mit der Ware gemacht?«
Aha. Daher weht der Wind. Auftraggeber. Ware. Es bedarf keiner besonderen Denkleistung, um zu erraten, von welcher Ware er spricht: Drogen. Er hält mich für einen Kurier, meine Geschichte für eine müde Ausrede, die Prellungen am Rücken und an den Beinen und die blauen Flecken für den Beweis eines Kampfes. Das Kribbeln in meinem Magen wird stärker, unentwegt suche ich nach einer Antwort auf meine stumme Frage: Bin ich tatsächlich ein Drogenkurier?
Ich hoffe, dass er meine Unsicherheit nicht bemerkt, denn langsam kann ich sein Misstrauen nachvollziehen: Warum sollte eine unschuldige Touristin in einen Kampf geraten und wie Treibgut im offenen Meer landen? Er vermutet mehr dahinter, das würde ich wahrscheinlich auch an seiner Stelle. Und so wie er sich auf mich einschießt, hat er nicht vor, seinen vermeintlichen Fang so ohne Weiteres von der Angel zu lassen.
Ich muss ihn davon überzeugen, dass ich nur eine harmlose Touristin bin. Eine Geschichte erzählen, die plausibel klingt. »Ich weiß nichts von einem Auftraggeber«, sage ich überdeutlich. »Vielleicht war ich segeln, und der Seitenbaum hat mich erwischt und ins Wasser geschleudert. Daher die Prellungen.«
»Und die blauen Flecken? Stammen die auch von dem Seitenbaum?« Das Lächeln verschwindet. »Glauben Sie, Sie sind die Erste, die diese Show hier abzieht?«
»Ich weiß es doch nicht!«, rufe ich, und die Verzweiflung in meiner Stimme ist so real, wie sie nur sein kann. Denn ich begreife nun, dass ich auf verlorenem Posten stehe. Es ist völlig egal, was ich sage, ich werde ihn nicht davon überzeugen können, dass ich nur eine harmlose Touristin bin. Wie auch, wenn nicht einmal ich selbst das mit Sicherheit behaupten kann. Meine Hand rutscht vom Sitz ab, und mein Ellenbogen stößt gegen die Hüfte. Ich zucke vor Schmerz zusammen und wundere mich, warum ich die Schmerzen vorher nicht wahrgenommen habe. Von irgendwo kullern Worte wie bunte Murmeln durch meinen Kopf: retardiertes Schmerzempfinden, eine Schockreaktion. Ich verbanne die Wortmurmeln in eine Ecke und konzentriere mich auf meine Antwort: »Vielleicht wurde unser Boot ja überfallen und ich über Bord geworfen.«
»Daran erinnern Sie sich?« Wie ein lauerndes Raubtier springt er auf meine Vermutung an.
»Nein! Ich erinnere mich an gar nichts! Aber so könnte es gewesen sein. Vielleicht …« Ich halte inne. Eine entsetzliche Erkenntnis zieht mir das Blut aus den Wangen. Kein normaler Tourist geht alleine auf dem Meer segeln. War ich mit meinem Mann unterwegs, und jetzt ist er … tot? Schnell blicke ich auf meine Hand. Kein Ehering. Vielleicht war ich mit meinem Freund unterwegs. Oder einer Freundin. Was ist mit meiner Begleitung passiert? Meine Brust zieht sich zusammen. Ist sie gestorben? Ertrunken? Wenn nun niemand weiß, wo wir hingefahren sind, niemand uns vermisst, weil man uns noch wochenlang auf einer Urlaubsreise vermutet, wer soll mich dann hier herausholen?
Hinter mir öffnet sich quietschend die Tür. Ein junger Polizist eilt herein und legt seinem Chef zwei Blätter auf den Schreibtisch. Aufgeregt redet er auf ihn ein, immer wieder huschen verstohlene Blicke zu mir. Der Polizeichef greift nach dem ersten Dokument, liest es, und ein zufriedenes Lächeln umspielt seine Lippen.
»Sie wissen also nicht, wer Sie sind?«, fragt er.
»Nein.«
»Dann werde ich es Ihnen sagen.« Er beugt sich über den Tisch. In seinen Augen sehe ich Verwunderung, aber auch Triumph, und das Kribbeln in meinem Magen wird unerträglich. Wer zum Teufel bin ich, dass mein Name bei ihm eine solche Reaktion hervorruft?
»Sie sind … Clare Brent.«
Clare Brent?
Ich warte auf ein Bild in meinem Kopf. Doch da ist nichts. Kein Bild und keine Stimme, die dem Namen ein Leben eingehaucht hätte. Er löst weder Regung noch Erinnerung in mir aus, er steht als belanglose Aneinanderreihung von Buchstaben im Raum, die mir nichts über mich verrät. Clare Brent.
Enttäuscht beobachte ich den Polizeichef. Dieser Triumph in seinen Augen … Im Gegensatz zu mir sagt ihm der Name offensichtlich etwas. Ja, ganz eindeutig. Aber was? Bin ich bekannt? Prominent?
Er tippt auf das Blatt vor ihm, ein Fax. Ich recke den Hals und starre auf seinen tippenden Finger, auf das unscharfe Schwarz-Weiß-Foto im rechten oberen Eck. Ein ovales, gleichmäßiges Gesicht. Die hellen Haare straff nach hinten gebunden. Große Augen, schmale Nase, volle Lippen. Das also bin ich. Unwillkürlich hebe ich die Hand und taste über mein Gesicht. Die Lippen fühlen sich rau und aufgesprungen an, die Nase heiß und sonnenverbrannt, die Haare kraus und spröde.
»Das ist ein Fahndungsaufruf von Interpol. Man sucht Sie wegen Kindesentführung.«
Ich brauche einen Moment, um seine Worte zu erfassen. Und selbst als ich sie erfasst habe, schaffe ich es nicht, sie mit meiner Person in Verbindung zu bringen.
Ich soll ein Kind entführt haben?
Nein, das kann nicht sein, ich muss mich verhört haben.
Doch an seinem Gesichtsausdruck erkenne ich, dass ich mich nicht verhört habe. Meine Kehle ist zugeschnürt wie ein viktorianisches Korsett, und ich kann kaum mehr atmen. Wieder bombardiere ich mich selbst mit Fragen: Ein Kind? Was für ein Kind? Wie alt ist es? Ein Junge? Ein Mädchen? Warum kommen keine Bilder? Da müssen doch verdammt noch mal Bilder sein! Ich rufe mich zur Ordnung. Ich muss Ruhe bewahren. Bleib bei den Fakten.
Was ich weiß: Ich wurde aus dem Wasser gefischt. Allein. Mein Körper zeigt Spuren von Gewalteinwirkung. Und das Kind? Was ist mit dem Kind passiert? Wo ist es jetzt?
Seine lauernden Augen bohren sich in meine. Dann werden sie schmal.
»Reden Sie!«, herrscht er mich an. »Wo ist das Kind?«
In meinem Kopf dreht sich alles. Ich habe ein Kind entführt. Werde über Interpol gesucht.
Das darf nicht sein.
»Wissen Sie, was man bei uns mit Kindesentführern macht?«
Ich kann es mir denken. Indonesien ist bekannt für seine unbarmherzige Justiz. Aber ich will es mir nicht denken, und ich will nicht glauben, dass ich ein Kind entführt habe. Ich will glauben, dass es nur eine Finte ist, um mich zum Reden zu bringen. Ihm von meiner Arbeit als Kurier zu beichten, ihm die Namen meiner Kontakte zu geben, Übergabeorte und was sonst ein Kurier noch weiß. Ein Psychospielchen. Mehr nicht.
Doch er fragt nicht weiter. Stattdessen lehnt er sich zurück, und wieder erscheint das zufriedene Lächeln auf seinem Gesicht. Meine Finger krallen sich um die hölzerne Sitzfläche des Stuhls. Es ist kein Psychospielchen. Er hat einen Fang gemacht. Einen großen. Einen deutlich besseren als einen mickrigen Drogenkurier.
»Sie wollen nicht reden?« Mit scharfem Ton gibt er dem Polizisten neben sich einen kurzen, mir unverständlichen Befehl. »Glauben Sie mir, Sie werden reden.«
Nur Sekunden später zerrt der junge Polizist mich vom Stuhl hoch, schleppt mich hinaus aus dem Raum und einen Gang entlang, durch schwere Türen, die von schläfrigen Wächtern erst auf- und wieder zugesperrt werden. Mein Kopf ist benebelt, doch mein Herz schlägt schnell, immer schneller, als wolle es sich selbst überholen. Mit jedem Schritt nimmt der Gestank nach Kot und Urin zu, der Boden ist so schmutzig, als wäre er noch nie geschrubbt worden. Eine Kakerlake flitzt über die fleckige Wand.
Mir wird schlecht. Ich zwinge mich, stur auf die Schuhe des Polizisten zu starren und ruhig und gleichmäßig in den Bauch hineinzuatmen. Schließlich halten wir an.
Die Zelle hinter dem mannshohen Gitter ist groß. Es ist zu dunkel, um erkennen zu können, wie viele Frauen darin kauern, hocken oder liegen. Auf Bänken, vereinzelten Matten, dem blanken Boden. Es sind viele. Zu viele für die Größe der Zelle, zusammengepfercht wie eine Herde Tiere.
Unwillkürlich weiche ich zurück, spüre die dürren, kräftigen Finger des Polizisten um meinen Arm, spüre, wie mein Magen endgültig rebelliert, wie meine Beine nachgeben.
3
Eine Banane und ein Glas Wasser.
Mehr hat es nicht gebraucht, um mich wieder auf die Beine zu bringen. Die Süße der Banane klebt an meinem Gaumen und überdeckt für einen Moment den Salzgeschmack, der mich seit dem Aufwachen auf dem Boot begleitet.
Ich hocke auf dem kühlen Steinboden, mit dem Rücken zur Wand, und mein Blick wandert in der Zelle umher. Etwa vierzig Quadratmeter, überschlage ich, zwei lange Bänke in der Mitte, dazu eine an jeder Wand. Überall Frauen, manche sitzend, manche auf Decken oder Matten am Boden liegend. Einundzwanzig sind es ohne mich. In der Zelle selbst brennt keine Lampe, aber der Flur ist beleuchtet, und durch das vergitterte Fensterband fällt genügend Licht herein – vom Mond oder von einer Laterne –, um Konturen und vereinzelt die Gesichter der Frauen zu erkennen. Die meisten schlafen, es ist spät, wahrscheinlich bereits nach Mitternacht.
Bisher hat mich niemand von ihnen angesprochen, und ich bin froh darüber. Mir ist nicht nach Reden, ich bin wie aufgepeitscht von unerträglichem Nichtwissen, von Halbwissen und Wissen. Dem Wissen, dass ich eine Kindesentführerin bin. Dem Halbwissen, dass ich in einen Kampf verwickelt gewesen sein muss, und dem Nichtwissen, das mein Leben in ein leeres Blatt verwandelt. Nein, ein fast leeres Blatt, gezeichnet von nur einem rabenschwarzen Fleck:
Kindesentführerin.
Die einzige bestätigte Information, die ich über mich habe. Kein guter Startpunkt, um mir ein Bild über mich selbst zu machen, außer ich gebe mich damit zufrieden, dass ich ein schlechter Mensch bin. Habgierig genug, um ein wehrloses Kind für meine Zwecke zu missbrauchen. Aber damit kann ich mich nicht zufriedengeben. Ich kann und will das nicht glauben. Die Interpolfahndung muss ein Missverständnis sein. Ein bedauerlicher Behördenfehler, eine Verwechslung.
Ich presse die Hände gegen meinen Kopf, fester und fester, als könne ich die verschüttete Erinnerung herausquetschen wie den Saft aus einer Zitrone. Ich presse, bis ich meine Schläfen schier eindrücke, und genieße den Moment der Ablenkung durch den Schmerz. Schließlich lasse ich die Hände sinken und lege erschöpft meinen Kopf auf die Knie.
Ich brauche unbedingt mehr Flecken auf meinem leeren Lebensblatt. Bunte, positive Flecken, die mir einen Grund geben, an mich selbst zu glauben und für mich kämpfen zu wollen. Aber dazu brauche ich Informationen. Nur woher?
Mein Blick streift meine bloßen Füße, und ich streiche mit den Fingern darüber, vom Rist zu den Zehen. Vom Schmutz abgesehen, wirken sie gepflegt. Die Nägel lackiert, der Lack an zwei Stellen gesprungen. Ich streiche über die Knöchel. Über die Waden. Keine Haare, keine Stoppeln. Entweder ich gehe zum Wachsen oder ich epiliere. Als Nächstes betrachte ich meine Fingernägel. Nicht lackiert und relativ kurz. Aber es sind keine Arbeiterhände mit rissigen Schwielen und in der Haut verwachsenem Dreck. Vorsichtig und unauffällig taste ich weiter, über die Hüften, den Bauch. Hier und da etwas Fett, insgesamt jedoch eher muskulös, wie jemand, der regelmäßig Sport treibt. Aber welchen? Radfahren? Ich spanne meine Wadenmuskeln an. Nein. Dazu sind die Muskeln nicht ausgeprägt genug.
Nachdenklich ziehe ich mir das Kleid über die Knie. Es ist ein schlichtes gestreiftes T-Shirt-Kleid, dessen Form, falls es denn je eine hatte, unter dem Bad in Meer und Sonne sichtlich gelitten hat. Meine Schuhe muss ich verloren haben. Zusammengefasst: einigermaßen gepflegt und sportlich, eher Kopf- als Handarbeiterin. Das passt zu dem Wissen, das ich im Gegensatz zu meiner Erinnerung problemlos abrufen kann. Etwa, dass es in Indonesien die Todesstrafe gibt. Dass sie Gefangene nur selten in ihre Heimatländer überstellen. Dass die Zellengröße in Bezug zur Zellenbelegung nicht den internationalen Standards entspricht. Dass die Bücher auf dem Schreibtisch des Polizeichefs durchwegs zu den Klassikern gehören. Wissen, das ich als jenseits des üblichen Allgemeinwissens einstufe.
Ich lehne mich zurück. In der stehenden Schwüle der Zelle ist die Wand in meinem Rücken angenehm kühl. Dann überkommt mich wieder die quälende Unruhe. Ich brauche mehr Informationen.
Das Fahndungsfoto kommt mir in den Sinn. Unwillkürlich ziehe ich eine Haarsträhne lang, bis die Haare sich vor meinen Augen entkringeln. Sie sind dunkler, als ich aufgrund des Fahndungsfotos vermutet hatte. Nicht blond, eher braun, eine Art Mittelbraun, genau lässt es sich in dem schwachen Licht jedoch nicht ausmachen. Fehlt noch die Augenfarbe.
Clare Brent. Ich wiederhole stumm den Namen in meinem Kopf, unzählige Male, als müsste ich ihn mir einbläuen, um ihn zu meinem eigenen zu machen.
Rede mit mir, Clare Brent. Sag mir, wer du bist. Wer das Kind ist, das du entführt hast.
Die Konversation bleibt jedoch frustrierend einseitig, noch einseitiger, als Selbstgespräche ohnehin verlaufen. Stumpf blicke ich auf die ringlosen Finger. Nicht verheiratet. Kann das Kind mein eigenes sein? Aber … kann man sein eigenes Kind entführen?
Und vor allem: Wo ist das Kind? Treibt es irgendwo auf dem Meer?
Allein. Verängstigt. Ohne Wasser.
Mir wird wieder schlecht.
Noch immer schmecke ich das Salz, erinnere mich an den quälenden Durst, mit dem ich aufgewacht bin.
Oder ist es ertrunken? Habe ich es getötet? Mühsam unterdrücke ich die stärker werdende Übelkeit.
Ein Kind. Es darf, darf, darf nicht sein!
Leise stöhnend vergrabe ich meinen Kopf in den Händen. Was immer passiert sein mochte, wenn dieses Kind wegen mir gestorben ist, wäre es besser gewesen, der Mann mit dem Boot hätte mich nie aus dem Meer gefischt.
4
Wie schon die letzten drei Tage, verkrieche ich mich nach dem mageren Frühstück wieder in die Ecke der Zelle. Ich will nur meine Ruhe, keine Fragen mehr, keine Kommentare. Allein die teils mitleidigen, teils gehässigen Blicke meiner durchwegs asiatischen Zellengenossinnen sind mir bereits zu viel. Also lasse ich den Kopf wieder auf die Knie sinken. Er fühlt sich schwer an vom tagelangen Jonglieren der wenigen nutzlosen Fakten. Sosehr ich mich auch bemühe, einen Sinn zu erkennen oder wenigstens zu begreifen, wer ich wirklich bin und wie ich hier landen konnte – ich komme nicht weiter. Genervt blende ich das ansteigende Getuschel um mich herum aus, die unfreundlich klingende Stimme, die immer wieder denselben Namen ruft.
Da zieht jemand an meinem Arm. Unwillig hebe ich den Kopf. Eine kleine alte Frau steht vor mir und zerrt an meinem Ärmel, bis ich endlich verstehe. Ich soll aufstehen. Ächzend stemme ich mich hoch. Vom langen Sitzen auf dem harten Boden knacken und schmerzen meine Knie. Ich strecke die Beine durch und massiere die platt gesessenen Stellen an meinem Hintern.
Erneut schallt der Name durch die Zelle:
»Clare Brent!«
Erst jetzt schalte ich. Die Stimme gilt mir!
Die kleine Frau packt meinen Arm und schleift mich mit erstaunlich starkem Griff mit sich, weg von der Wand, hin zu der Traube Frauen, die sich neugierig im Halbkreis um die Zellentür scharen. Aufgeregt redet die Alte auf mich ein, unverständliches, maschinengewehrschnelles Gepiepse. Fragend hebe ich die Schultern und schüttele den Kopf, doch mein offensichtliches Nichtverstehen kann ihren Redefluss nicht eindämmen. Ganz im Gegenteil, das Gepiepse wird immer schneller und aufgeregter, bis die Nervosität der Alten auf mich überschwappt.
Wie Filmfetzen rasen mir die Fragen der Frauen an meinem ersten Tag hier durch den Kopf: »Du Drogen?«, die mitleidigen Blicke, die eindeutigen Handbewegungen. Keine Auslieferung. Exitus.
Wenn das die Strafe für Drogenschmuggel ist, was erwartet mich dann bei Kindesentführung?
Mein Puls wechselt von Trab in Galopp und schaltet auf Fluchtmodus. Ich wehre mich gegen das Ziehen der alten Frau, ich will nicht dahin, wo sie mich hinschleift. Da tritt die Menschentraube auseinander und bildet eine schmale Gasse, gerade groß genug, um uns durchzulassen. Auf der anderen Seite der Zellentür wartet der Polizeichef. Breitbeinig steht er da, die Hände in die Hüften gestemmt, etwas größer als ich, gut einhundertfünfundsiebzig Zentimeter Autorität. Seitlich versetzt hinter ihm ein grauhaariger, sehr schlanker, großer Mann mit undurchdringlicher Miene. Er ist kein Asiate, und in mir wächst die irrwitzige Hoffnung, dass er Engländer ist und von der Botschaft geschickt wurde, um mir beizustehen. Hinter dem Grauhaarigen ein Büschel blonder Haare.
Der Polizeichef winkt uns näher. Die Alte zerrt mich vor bis zum Gitter, liefert mich ab wie eilig bestellte Ware und bleibt erwartungsvoll neben mir stehen. Der Polizeichef jedoch scheucht sie mit einem ungnädigen Wink zurück, während er dem Wärter einen Befehl zuraunt.
Der Schlüssel klappert im Schloss, dann öffnet sich die Gittertür, der Wärter bugsiert mich unsanft in den Flur und schubst mich vor den Polizeichef.
»Ist das die Frau, die Sie suchen?«, richtet der Polizeichef sich an den Grauhaarigen.
Angespannt hebe ich den Kopf und versuche, meinen sich überschlagenden Puls wieder unter Kontrolle zu bringen. Mein Blick streift den Grauhaarigen, dann den blonden Mann seitlich hinter ihm. Er ist etwas kleiner, aber kräftiger als der Grauhaarige, und deutlich jünger. Ich bemerke sein verstohlenes Nicken, die wortlose Kommunikation zwischen ihm und dem Grauhaarigen, seine hastig zu Boden gerichteten Augen, als er meinem Blick ausweicht. Ich wage kaum zu atmen, so sehr hoffe ich inzwischen, dass sie mich kennen und sich die ganze Situation als Missverständnis aufklärt. Oder dass sie mir wenigstens eine winzige, verschwörerische Geste zuwerfen, um mir zu signalisieren, dass sie mich hier herausholen werden.
Doch es folgt keine Geste, nur die Bestätigung des Grauhaarigen, dass ich die gesuchte Frau sei. Die Worte zerschießen meine Hoffnung. Ich bin die gesuchte Frau – der Fahndungsaufruf ist also korrekt.
Er reicht dem Polizeichef die Hand. »Vielen Dank. Ich werde Ihre hervorragende Arbeit bei meinem Dienstchef erwähnen. Wenn jeder seinen Job so effizient erledigen würde, Sir, hätten wir deutlich weniger Probleme.«
Sogleich schwillt die Brust des Polizeichefs etwas mehr an, er ist sichtlich um Worte verlegen, da tritt der Grauhaarige vor und legt besitzergreifend seine Hand auf meine Schulter. »Mit Ihrem Einverständnis übernehmen wir jetzt die Gefangene.«
Übernehmen? Ich horche auf. Was bedeutet das für mich?
Wer ist dieser Mann, der mich nun so zielstrebig den dreckigen Gang entlangschiebt?
Nervös lausche ich dem Geplänkel der Männer. Ein laues Hin und Her, das Gejammer des Polizeichefs über mangelnde Ausstattung, die Versicherung des Grauhaarigen, dass er sich bei entsprechender Stelle für eine bessere Ausstattung einsetzen werde – nach einem so wichtigen Fang, einer so hervorragenden Arbeit, einer so komplikationslosen Kooperation … Nach ein paar Sätzen blende ich das Geplänkel aus. Jeder Ton klingt falsch und heuchlerisch, und die einzige Wahrheit, die ich dabei heraushören kann, ist das Englisch des Grauhaarigen: klar und akzentfrei, eindeutig britisch. Ein Botschaftsmitarbeiter? Erneut kriecht Hoffnung in mir hoch. Hat ihn jemand geschickt, um mich nach Hause zu holen? Mein Freund? Meine Eltern? Kollegen? In meinem Rücken spüre ich den Blick des Blonden. Er muss mich anstarren, so intensiv ist das Gefühl, beobachtet zu werden.
Ich sehe an mir hinunter. Arme und Beine schmutzig und sonnenverbrannt. Barfuß. Das Kleid verknittert und fleckig. Wie mein Gesicht aussieht, möchte ich lieber nicht wissen. Ich wirke völlig verwahrlost. Stammt daher der intensive Blick in meinem Rücken? Weil ihn mein verwahrlostes Aussehen überrascht? Er muss derjenige sein, der wusste, wie ich aussehen würde. Er hat mich identifiziert und sein Wissen durch ein Nicken kundgetan. Als sei er, der Stille im Hintergrund, der wahre Auftraggeber. Meine Gedanken halten kurz inne: Auftraggeber … wofür?
… übernehmen wir jetzt die Gefangene, hat der Grauhaarige gesagt – aber weder er noch der Blonde hat bislang das Wort an mich gerichtet. Hätten sie nicht längst mit mir reden müssen? Mich über meine Rechte aufklären und mir sagen, wer sie überhaupt sind? Angestrengt versuche ich, aus dem Geplänkel relevante Informationen herauszulesen. Der Grauhaarige wollte sich für den Polizeichef einsetzen, ihm zu einer besseren Ausstattung verhelfen … War das schon Bestechung? Warum allerdings würde jemand den Polizeichef bestechen, um mich aus der Zelle zu holen? Wer würde das veranlassen?
Den Blick des Blonden in meinem Rücken. Wie Laserpointer. Ein Kribbeln läuft meine Wirbelsäule hinunter. Der Blick ist zu intensiv für jemanden, der keinen persönlichen Bezug zu mir hat. Aber wenn das so ist, warum offenbart er sich dann nicht? Ich kann seine Emotionen spüren, allerdings ohne sie zuordnen zu können. Was fühlt er? Nervosität? Wut? Sorge? Es muss eine Beziehung zu diesem Mann geben – und welcher Natur sie auch ist, sie ist intensiv.
Ich wende mich um. Sofort senkt er seinen Blick. Geradezu als hätte ich ihn beim Spannen ertappt.
Da erreichen wir die schwere Eisentür am Durchgang zum Präsidium. Ein Wärter kauert zusammengekrümmt auf einem Schemel, der Körperhaltung nach ist er nur Sekunden vom Eindösen entfernt. Der Polizeichef schnauzt ihn an, und er springt auf, das Gesicht dunkelrot. Er stammelt etwas und nickt dabei unaufhörlich, wobei seine Hände ungeschickt mit dem Schlüsselbund an seinem Gürtel kämpfen. Ungelenk sperrt er auf und senkt ehrfürchtig den Blick, als der Polizeichef an ihm vorbei durch die Tür tritt.
Sogleich wird es heller. Anstatt der nackten Glühbirnen, die zuvor in unregelmäßigen Abständen von der gräulich verfärbten Decke baumelten, ist nun warmes, freundliches Tageslicht die vorherrschende Lichtquelle. Hinter uns fällt die schwere Eisentür ins Schloss, der Schlüssel dreht sich, und das Geräusch weckt in mir den Impuls zu fliehen. Ich muss gezuckt, vielleicht aber auch nur eine zu schnelle Bewegung gemacht haben, denn der Griff um meine Schulter verstärkt sich wie eine lautlose Warnung.
5
Die klimatisierte Luft wirbelt wie eine eisige Kaltfront durch das Auto. Ich fröstele und umfasse meine Arme, um mich zu wärmen. Meinen Blick richte ich bewusst weg von dem Blonden neben mir auf der Rückbank. Ich sehe aus dem Fenster, auf die Straßenhändler, die hinter ihren Waren hocken. Gemüse und Gewürze in allen Farben, in Körben oder auf Tüchern am Boden ausgebreitet, Fische auf wackeligen Tischen, Tücher in ramponierten Pappkartons. Dann werden die Händler weniger. Wir fahren an kleinen Läden vorbei, an vereinzelten Werkstätten, an Arbeitern, die am Straßenrand Stühle und Tische schleifen, an Häusern, deren Größe und baulicher Zustand sich mit jedem gefahrenen Meter verschlechtert, bis nur noch von Müll gesäumte Baracken übrig bleiben. Schließlich lassen wir die Stadt hinter uns, und vereinzelte Bäume und Palmen setzen grüne Tupfen in die karge Landschaft.
Erst da drehe ich das erste Mal den Kopf zu dem Blonden. Wie erwartet huschen seine Augen zu mir, nur um sich sogleich wieder der vorbeiziehenden Landschaft zuzuwenden. Etwas an ihm irritiert mich. Er brennt darauf, mich anzusprechen. Ich kann es spüren, seine innere Spannung ist überdeutlich – es zerreißt ihn förmlich, und trotzdem bleibt er stumm wie ein Schnitzstock. Und ich kann noch etwas anderes fühlen: die Spannung zwischen den beiden Männern.
Gesprochen hat mit mir bislang jedoch nur der Grauhaarige, der am Steuer sitzt. Ein Mr. Wilson, wenn ich seinen Namen richtig abgespeichert habe. Er hat sich als Mitarbeiter der Britischen Botschaft vorgestellt, beauftragt, mich nach London zu überstellen. Er hat mir nur drei Fragen gestellt: Ob ich etwas zum Aufenthaltsort des Kindes sagen kann, ob ich tatsächlich über keinerlei Erinnerung verfüge und ob ich korrekt behandelt worden sei. Mehr nicht, und dafür war ich ihm dankbar. Auf eine weitere Fragesession, in der sich mein Part auf die Wiederholung von ›ich weiß es nicht‹ reduzierte, konnte ich gut verzichten.
Wilson kennt sich offenbar in der Gegend aus. Selbst ohne Navigationssystem hat er noch kein einziges Mal gezögert, wenn wir uns einer Kreuzung oder Abzweigung näherten. Ganz im Gegensatz zu dem Blonden. Bei jedem Schild verweilt sein Blick ratlos auf der schwarzen Schrift, bevor seine Augen erneut zu mir wandern.
Wer ist er? Mit jedem Blick von ihm wird die Frage drängender. Wilson hatte bei dem kurzen Gespräch nur sich selbst vorgestellt – wie zuvor im Gefängnis blieb auch hier der Blonde im Hintergrund. Aus den Augenwinkeln linse ich wieder zu ihm hinüber. Er sieht müde aus. Dunkle Schatten unter ruhelosen blauen Augen, unrasiert, das Hemd verknittert, als hätte er darin geschlafen. Mein Blick bleibt an seiner Nase hängen. An dem leichten Knubbel an der Spitze, als habe die Natur nicht gewusst, wohin mit der überschüssigen Knorpelmasse.
Ich knabbere an meiner aufgesprungenen Lippe und wandere durch die Ebene meines Gedächtnisses, die sich nicht mehr durchsuchen lässt. Ich versuche es dennoch, präge mir den Knubbel auf der Nase ein und warte auf eine Rückmeldung – denn inzwischen bin ich mir sicher: Es muss eine Verbindung zwischen uns geben. Aber welche? Wenn er mein Mann oder Freund oder Kollege oder auch Auftraggeber ist – warum sagt er mir das nicht einfach und erlöst mich aus dieser quälenden Wissensblindheit? Mit einem Mal schießt in mir die Antwort hoch wie eine heiße Fontäne.
Er ist der Vater des entführten Kindes.
Hastig drehe ich den Kopf zum Fenster, hoffe, dass er mein Unbehagen nicht bemerkt.
Ich konzentriere mich auf die karge Hügellandschaft, auf das vertrocknete Gras, die von struppigen Büschen und zierlichen Bäumen gesäumte Straße.
Dann platzt etwas in mir. Ich halte die stumme Anspannung im Auto nicht mehr aus – ich muss wissen, wer der Mann neben mir ist. Doch ihn zu fragen, traue ich mich nicht. Also richte ich meinen Blick nach vorne und fixiere Wilsons Hinterkopf, bis unsere Augen sich im Rückspiegel treffen.
»Wer bin ich?«, frage ich, in der Hoffnung, ein Gespräch in Gang zu bringen.
»Clare Brent«, antwortet der Blonde.
»Ja, das weiß ich«, sage ich, ohne ihn anzuschauen, »aber wer ist Clare Brent?«
»Das kann …«
»Sie sind britische Staatsbürgerin«, unterbricht Wilson den Blonden, ohne den Blick von der Straße zu nehmen. »Siebenunddreißig Jahre, wohnhaft seit 2007 in London, geboren in Plymouth. Mutter Italienerin, Vater Engländer, mit fünfzehn Verlust beider Eltern bei einem Autounfall.«
»Meine Eltern sind … tot?«, entfährt es mir. Die Information trifft mich unvorbereitet. Selbst ohne zu wissen, wer ich bin, hatte ich angenommen, irgendwo Eltern zu haben, die mich, egal was ich getan hatte, nicht im Stich lassen würden. Waise und kein Ehering, du bist völlig auf dich gestellt, schießt es mir durch den Kopf, und ich wünschte, ich könnte die Frage zurückziehen. Der Blonde rutscht unruhig neben mir herum.
»Am Unfallort verstorben«, bestätigt Wilson. »Darauf folgend Heimunterbringung bis Abschluss der Schule, dann Medizinstudium mit Schwerpunkt Pädiatrie, später Weiterbildung zur Kinderosteopathin. Internationale Auszeichnungen in dem Bereich alternative Heilmethoden bei Kleinkindern.«
Kinderärztin. Osteopathin. Daher also stammen die Fachbegriffe in meinem Kopf. Allerdings macht es das Ganze nur noch unverständlicher – warum sollte eine anerkannte Kinderärztin und Osteopathin ein Kind entführen und um die halbe Welt schleppen? Oder …
Die nächste Frage drängt sich mir schmerzhaft auf: Habe ich das Kind gekannt? War es ein Patient von mir?
»Und das Kind?«, frage ich mit belegter Stimme.
Der Blonde beugt sich zu mir. »Bonnie …«
»Fragen zu dem Kind werden wir später beantworten.« Wilsons Ton ist scharf. Ruckartig dreht er sich nach hinten und wirft ihm einen warnenden Blick zu.
Bonnie. Ein Mädchen. Ich presse die Hand auf den Mund. Wieder eine Frage, die ich lieber nicht hätte stellen sollen. Bisher war die Anschuldigung, ein Kind entführt zu haben, in meinem Kopf abstrakt geblieben. Ich hatte jeden Mechanismus, der mir zur Verfügung stand, genutzt, um es von mir wegzuschieben. Verleugnung, Verdrängung – nur ein Missverständnis, hatte ich mir eingeredet. Aber nun … Wilson hat mich gefragt, ob ich weiß, wo das Kind ist. Es ist also noch verschwunden. Und er hat damit bestätigt, dass ich die Entführerin bin – die Frau, die wissen sollte, wo das Kind ist. Und nun hat das Kind auch noch ein Geschlecht und einen Namen. Ein Mädchen namens Bonnie.
Jemand hat mich zusammengeschlagen und ins Meer geworfen. Mich, eine erwachsene Frau. Was würden diese Leute dem kleinen Mädchen antun? Ich versuche den Gedanken wegzuschieben, ich ertrage die plötzliche Gewissheit nicht, dass das Mädchen meinetwegen entweder tot oder in der Gewalt von menschlichen Monstern sein musste.
Plötzlich verlangsamt sich die Fahrt, der Wagen biegt in eine unbefestigte Schotterstraße und kommt holpernd zum Stillstand. Verwundert sehe ich mich um. Weit und breit ist kein Haus, keine Abzweigung, es gibt keinen Grund, hier anzuhalten.
Doch. Einen Grund gibt es, unübersehbar und Angst einflößend: Der Blonde ist Bonnies Vater und hat Wilson angeheuert, um an die Entführerin seiner Tochter zu kommen. Um ihren Aufenthaltsort von mir zu erfahren. Wie weit würden sie gehen, um an meine verschüttete Erinnerung zu gelangen?
Ich taste nach dem Türgriff. Welche Chance hätte ich, wenn ich aus dem Wagen springen und wegrennen würde?
Da steigt Wilson aus. Im Rückspiegel sehe ich, wie der Kofferraumdeckel nach oben schwingt. Instinktiv reiße ich am Türgriff, doch dann lasse ich ihn wieder los. Was immer sie vorhaben, es gibt kein Entrinnen. Und vielleicht ist das auch gut so. Egal was ich tun soll, um das Mädchen zu finden, ich werde es tun.
Da öffnet Wilson meine Tür und drückt mir ein Bündel in die Hand. »Hier. Ziehen Sie sich um.«
Verblüfft betrachte ich die Kleidungsstücke. Unterwäsche, eine helle Leinenhose, eine grüne Tunika, grüne Stoffschuhe. Dann verstehe ich: In dem verwahrlosten Zustand können sie mit mir nirgendwo auftreten. Ich würde nur die Blicke auf mich ziehen. Wilson wendet sich ab, ich nehme an, um mir etwas Privatsphäre zu gönnen, doch der Blonde bleibt neben mir sitzen. Als befürchte er, ich würde das Auto hijacken, wenn er auch aussteigt.
»Drei Minuten. Beeilen Sie sich.« Wilson muss mein Zögern bemerkt haben. Er zündet sich eine Zigarette an.
Ich fasse unter das Kleid und ziehe im Sitzen den Slip herunter. Die verletzten Rippen schmerzen beim Vorbeugen, doch ich beiße die Zähne zusammen, greife nach dem frischen Slip und schlüpfe hinein. Dann in die Hose. Sie passt genau und fühlt sich angenehm sauber und frisch auf meinem ungewaschenen Körper an. Es ist mir peinlich, dass der Blonde mir beim Umziehen zusieht. Und das tut er. Ich spüre es, auch ohne ihn anzusehen. Ich nehme den BH und verschließe ihn unter dem Kleid, bevor ich es mir behutsam über den Kopf ziehe.
»Was zum Teufel …!«, flucht der Blonde plötzlich.
Noch bevor ich mich über seinen Ausbruch wundern kann, streichen seine Finger schon über meinen Rücken. Die Berührung durchzuckt mich wie ein elektrischer Schlag.
»Scheiße, Clare, was haben sie mit dir gemacht?«
Mit dir, Clare?
Fieberhaft versuche ich seine Worte in den bisherigen Kontext einzuordnen. Bislang hat nur Wilson mit mir gesprochen. Er hat mich Mrs. Brent genannt und mich nach meiner Bestätigung, dass ich mich an nichts erinnern kann, in Ruhe gelassen. Zu keiner Zeit hatte ich das Gefühl, er würde mich kennen. Sein Ton war distanziert und sachlich. Ganz anders der Ton des Blonden – so redet man nur, wenn man jemanden gut kennt. Aber warum hat er das bislang nicht zugegeben? Seine Finger tasten meine Wirbelsäule entlang, streifen den BH, und mit einem Mal bin ich mir wieder meiner Nacktheit bewusst. Schnell streife ich mir die Träger des BHs über und schlüpfe mit den Armen in die Tunika.
»Halt still!« Seine Hand drückt mich sanft nach vorne. »Ich muss deinen Rücken untersuchen.«
Unschlüssig halte ich die Tunika vor die Brust, während seine Finger weiter über den Rücken gleiten und ein Kribbeln auf meiner Haut hinterlassen. Ich spüre dem Gefühl nach, versuche es einzuordnen – ist es angenehm oder unangenehm? Angenehm, beschließe ich, als reagiere meine Haut unabhängig von meinem Kopf. Was bedeutet das?
Ich muss deinen Rücken untersuchen. Ein Arzt würde so etwas sagen. Laut Wilson bin ich Kinderärztin – ist der Blonde also ein Kollege?
Ich sehe zu dem rauchenden Wilson hinaus, erinnere mich, wie er dem Blonden mehrmals ins Wort gefallen ist. Wenn ich etwas wissen will, ist jetzt der beste Zeitpunkt.
»Wer sind Sie?«, frage ich ihn schnell.
In dem Moment tritt Wilson seine Zigarette aus. Hastig kommt er zum Wagen, die Brauen verärgert zusammengezogen. »Was soll das?«, schnauzt er den Blonden an. »Was machen Sie da?«
»Sie ist verletzt«, sagt der, ohne seine Hände von meinem Rücken zu nehmen. Fachkundig tasten seine Finger über die schmerzhaftesten Stellen. Nur mühsam unterdrücke ich ein Stöhnen.
»Verdammt!« Wilsons Gesicht rötet sich. »Hatte ich mich nicht klar ausgedrückt? Sie sollen sich zurückhalten, bis Sie in London sind.«
»Sagen Sie mir nicht, was ich zu tun habe! Ich habe genug von Ihren absurden Anweisungen!« Die Stimme des Blonden zittert vor unterdrückter Wut. Er nimmt mein Kinn und dreht meinen Kopf zu sich. »Du willst wissen, wer ich bin? Ich bin Paul. Ich bin dein Mann.«
Ich starre ihn an, die Tunika noch immer an die Brust gepresst, den Mund offen. Mein Mann? Nein, unmöglich, denke ich. Es kann nicht sein, dass ich neben meinem Mann sitze und ihn nicht erkenne. Sein Erscheinen, seine Stimme, spätestens seine Berührung hätte doch etwas in mir auslösen müssen. Ein Déjà-vu, eine Vertrautheit. Als Wilson sich vorgestellt hat, war der Blonde – Paul – im Hintergrund geblieben, als sei seine Anwesenheit ohne Bedeutung. Und jetzt behauptet dieser Paul, er sei mein Mann! Wilson hat nicht erwähnt, dass ich verheiratet bin. Allerdings – was er über mich gesagt hat, klang wie auswendig gelernt. Und Paul? Warum hat er mir das nicht schon im Gefängnis mitgeteilt?
Ich sehe ihn direkt an.
»Warum … warum sagst du das erst jetzt?«
»Weil das so abgesprochen war«, knurrt Wilson, bevor Paul antworten kann. »In Ihrem Zustand ist nicht absehbar, wie Sie darauf reagieren. Schock, Ablehnung, hysterischer Anfall … alles möglich.« Er beugt sich zu mir, keine Spur mehr von der distanzierten Höflichkeit des geschulten Botschaftsmitarbeiters. »Wir können uns kein Aufsehen leisten, kapiert?«
Dann knallt er die Tür zu, umrundet das Auto und lässt sich auf den Fahrersitz gleiten. Der Motor springt an, Sekunden später stößt der Wagen rückwärts über den Schotter und schießt mit aufheulendem Motor die Landstraße entlang. Seine Worte rotieren in meinem Kopf.
Wieder tasten die Finger des Blonden, Paul, korrigiere ich mich, über meinen Rücken. Er dreht mich zur Seite.
»Bleib genau so sitzen.« Dann höre ich das Klicken einer Kamera.
Wilson dreht hektisch den Kopf nach hinten. »Verdammt, Paul, was wird das nun wieder?«
»Beweisfotos. Schwere Misshandlung. Zwei Rippen sind mindestens angebrochen. Haben sie dir das im Gefängnis angetan?«
Ich schüttele den Kopf.
»Weißt du, wer das war?«
»Nein. Ich weiß gar nichts.«
Das Klicken hört auf. »Okay. Du kannst dich anziehen.«
Ich stülpe mir die Tunika über den Kopf.
Paul. Mein Mann.
Mit einem Mal durchströmt mich ein Gefühl von unfassbarer Dankbarkeit. Mein Mann sitzt neben mir. Er hat mich aus dem Gefängnis geholt. Und das heißt: Was immer geschehen ist, was immer geschehen wird – ich bin nicht allein. Unverhohlen beobachte ich ihn. Sein Gesicht bleibt mir fremd, seine Mimik ein Rätsel, aber das stört mich nicht. Er ist mein Mann, und ich werde ihn neu kennenlernen. Ich frage mich, ob er Grübchen beim Lachen hat oder ob er die Augen zusammenkneift und sich halbkreisförmige Lachfältchen zeigen.
»Mrs. Brent!«
Ich reiße meinen Blick von Paul los. Wilsons Gesicht ist nach wie vor gerötet.
»Hören Sie mir zu?«
»Tut mir leid. Was haben Sie gesagt?«
»Wir sind gleich am Flughafen. Nicht auffallen. Keine Fragen über das Gefängnis oder die Entführung oder Ihr Leben. Am besten gar keine Fragen – Sie wissen nie, wer mithört. Sie werden Ihre Antworten früh genug bekommen, glauben Sie mir.«
»Ja.«
Er seufzt, als habe ich die falsche Antwort gegeben. »Versuchen Sie nicht, wegzurennen oder sonst einen Blödsinn anzustellen. Ohne uns landen Sie in ein paar Stunden wieder in der Zelle. Haben Sie das verstanden?«
»Ja«, sage ich und meine es auch so. Ich habe nicht vor, wegzurennen oder sonst einen Blödsinn anzustellen. Warum auch? Ich bin dankbar, dass Wilson und Paul mich aus dem Gefängnis geholt haben und nach London bringen, und ich bin erleichtert, dass Paul mein Mann ist und ich all das, was nun auf mich zukommen wird, nicht alleine durchstehen muss. Die ersten Hinweisschilder zum Parkplatz des Flughafens tauchen in unserem Sichtfeld auf.
»Und in London? Wie geht es dort weiter?«, frage ich so beiläufig wie möglich und hoffe, dass Wilson die Frage durchgehen lässt.
»Ich bringe dich nach Hause«, sagt Paul und packt meine Hand. Der Griff ist fest, der Ausdruck auf seinem Gesicht jedoch so hart, dass die Süße des Wortes nach Hause verschwindet.
6
Bäume. Dichtes Laub.
Rauschen und Sirren wie tausend Bienenschwärme.
Darüber: Stille, lauter als das Rauschen.
Eine schmale Straße. Links, rechts, Bäume.
Ein Rastplatz.
Einsam in der frühen Dämmerung.
Nur ein Auto. Rot, alle Türen offen.
Keine Stimmen. Kein Rufen. Kein Lachen.
Nur Stille und das rote Auto.
Die Türen ausgebreitet wie Schmetterlingsflügel.
Sie nähert sich.
Zögerlich, den Blick starr auf die geöffneten Türen gerichtet. Ihr Atem ist schnell, getrieben von der Angst, was sie im Inneren erwarten würde.
7
London. Mein Blick fällt auf die winzigen Häuserblöcke und Straßen mit den Miniaturautos unter uns. Mit jeder Sekunde wachsen sie, das Grün bekommt Konturen, wird zu Bäumen und Hecken, die Blöcke zu einzelnen Häusern mit Garagen und Gärten.
Ich muss gähnen, und sogleich trifft mich Pauls aufmerksamer Blick. Er hat die ganze Zeit über mich gewacht, dafür gesorgt, dass ich zugedeckt war und genügend Wasser getrunken habe, um nicht zu dehydrieren. Das ist das Einzige, das sich seit dem Umstieg in Jakarta in meinem Gedächtnis verhakt hat. Der Rest hat nur ein schwaches Flirren hinterlassen, ein Hinein- und Hinausdösen aus diversen Filmen, begleitet von lähmender Müdigkeit. Wie jetzt auch. Mein Kopf arbeitet so langsam, meine Beine sind so schwer, als hätte ich eine Schlaftablette genommen.
Kurz darauf stehen wir im Flughafen. Immer noch sind meine Gedanken träge, ich habe das Gefühl, als sei mein Gehirn umnebelt. Aber ich spüre Pauls Arm um meine Taille, er ist stark und stützt mich auf dem Weg durch die breiten Flure, und obwohl ich mir nicht vorstellen kann, wie das ist, Tisch, Bett und mein ganzes Leben mit ihm zu teilen, bin ich froh, dass er es ist, der mich nun nach Hause bringt – wo immer das auch sein mag.
Dann sitzen wir im Taxi. Die Fahrt ist lang und still, und ich werde mir bewusst, dies ist die letzte Schonfrist, bevor Paul sein von Wilson auferlegtes Schweigen brechen darf. Nervös sehe ich aus dem Fenster. Sosehr ich wissen möchte, wer das gesuchte Mädchen ist und was meine Rolle bei seiner Entführung war, sosehr fürchte ich mich vor einer Wahrheit, an der ich verzweifeln würde. Feige schiebe ich den Gedanken beiseite und lehne den Kopf an die Scheibe.
Die Straßenzüge und die Hektik des Verkehrs fühlen sich vertrauter an als die indonesischen Farne und Palmen, manche Gebäude und Läden glaube ich sogar zu erkennen. Hin und wieder schwirren Ortsnamen durch meinen Kopf, und doch erscheint keine einzige lebendige Erinnerung, keine einzige Verbindung zu mir selbst. Die Gegend verändert sich, die Straßen werden gepflegter, schicke, weiß getünchte Townhouses wechseln sich mit alten, prunkvollen Apartmenthäusern ab, und die Ladengeschäfte werden exklusiver. Mein Blick gleitet über die Schaufenster, Chanel, Dolce & Gabana, Gucci, Tom Ford, Valentino, und bleibt an einem Straßenschild hängen. Sloane Street, Chelsea.
Das Taxi biegt ab, lässt die Luxusläden hinter sich und stoppt schließlich vor der Auffahrt eines großen Backsteingebäudes mit weiß abgesetzten Fenstern und Balkonen. Es ist eine ruhige Seitenstraße mit Blick auf einen winzigen Park. Ungläubig betrachte ich den noblen Eingang des Gebäudes. Eine Wohnung hier muss ein Vermögen kosten. Wenn Wilsons Aussage mit der Osteopathin stimmt, was für einen Beruf übt Paul dann aus, um sich hier eine Wohnung leisten zu können? Als einfacher Arzt würde er dafür niemals genug verdienen.
Paul drückt dem Taxifahrer mehrere Geldscheine in die Hand und wartet auf das Wechselgeld. Ungezählt steckt er es in die Jackentasche, ohne auch nur eine Sekunde seine Augen von mir zu nehmen. Ich bemerke die geballte Faust in seiner Jackentasche und spüre wieder seine Anspannung.
»Komm, Liebes, wir sind da.«
Liebes. Ich lausche dem Wort nach. Da schließen sich seine Finger um mein Handgelenk, so fest, dass sein Ehering sich schmerzhaft in meinen Knöchel bohrt.
Kaum auf dem Gehsteig, legt er seinen Arm um meine Schulter und steuert auf den Eingang des Apartmenthauses zu, aus dem uns ein Mann entgegenkommt.
»Guten Tag, Mr. Brent.«
»Danke …« Paul zögert.